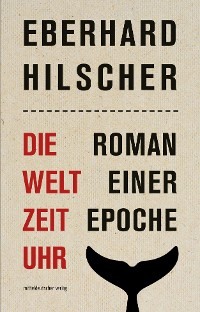Kitabı oku: «Die Weltzeituhr», sayfa 4
Zeitansage, 5. Jahr
26. Januar: Im Düsseldorfer Herrenklub sprach Ahi, der ehemalige Zirkusstar und Kehlkopfartist, wieder einmal über das kommende Reich der Liebe. Vor dreihundert versammelten Bankiers, Magnaten, Generaldirektoren und Geldnehmern redete er bewegt über seine pekuniäre Not und darüber, dass nur großzügige Geldgeber von heute ein Anrecht auf die Fülle von morgen hätten. Im Machtstaat der Zukunft werde er bolschewistische und demokratische Schweinereien unerbittlich ausrotten und zugleich riesige Lebensräume erkämpfen lassen für Volk und Volkswirtschaft. Durch diese Liebesbeteuerungen gerührt, öffneten die Industriellen den Fonds der Fronde und spendeten raschelnde Papiermillionen für die baldige Aufwertung der Deutschen Mark. – Unterdessen machten fröhliche Schowi-Trupps die Bevölkerung mit künftigem Glück bekannt. Sie verkündeten das freie Zeitalter der Rowdies, zogen musizierend durch die Straßen und benahmen sich heldisch, indem sie zu zwölft einzelne Leute verprügelten, lachend alte Weiber auszogen und in Gaststätten sorgfältig Mobiliar zerholzten. Selbstverständlich wiesen sie den Vorwurf des Terrorismus entrüstet zurück, denn Wildwestspiele und Zahngoldspuckreize seien Ehrensache und patriotische Taten von Revolutionstribunalen. Da die Gesetze der Republik eine derartige „ritterliche Opposition“ schätzten und schützten, gönnte der Boss seinen Getreuen tägliche Silvesterknallereien, Schadenfeuer und Schießübungen in Arbeitervierteln. – Sechs Monate später wählten siebenunddreißig Prozent des Volkes das demonstrierte Heil.
12. August: Besorgt über die Entartung des politischen und privaten Lebens erließ eine hohe Behörde Notverordnungen zur Wiederherstellung von Sicherheit und Sittlichkeit: Verbot von staatsgefährdender Freikörperbewegung, aufreizender Badekleidung, Nacktszenen im Theater, Film, Revue und Varieté; Gebot von christlichen, bauch- und busenverhüllenden Damentrikots und von züchtigen Zwickeleinsätzen in den zur Wasserbenetzung bestimmten Hosen der Herren. – Bei hochsommerlichen Temperaturen von dreißig Grad inspizierten Polizisten mit Ferngläsern die See- und Strandbäder des Reiches und erhoben von aufsässigen Nudisten Bußgelder bis zu 150 Mark. Unbefugte Flurhüter klebten in Erholungsparks auch auf unkeusche Plastiken die blauen Zahlungsbefehle des Regierungsamtes.
Doktorspiele
Wo hatte der Bengel nur diese Ausdrücke her! Sehr vergnügt sagte er „Arschloch“ und „Furz“. Obwohl ihn die Mutter darüber belehrte, dass man „so etwas“ nicht ausspreche, wiederholte er die Würzworte unentwegt. Da er auf Tadel lediglich durch gespanntes Aufblicken reagierte, entschloss sie sich dazu, einfach nicht mehr hinzuhören, bis Guido triumphierend verkündete: „Und vögeln kann ich auch noch.“ Nun lachte Frau Dagmar, denn es hätte vulgärer lauten können. Pädagogisch lobte sie die wunderschöne Benennung und fragte, ob sie wohl wissen dürfte, was das sei.
Er erklärte: „Na, wenn die Kinder nicht mehr tot sind.“
Sie meinte: „Aber dann wachsen sie doch im Bauch einer Mama.“
„Und wie kommen sie dort hinein?“
Es ergab sich ein ganz vernünftiges Gespräch über Ursprünge, Geburt und die Möglichkeit des anfänglichen „Lebens im Finstern.“
Beim Zeichnen offenbarte Guido weitere Spezialkenntnisse. Er malte Impressionen und Dada-Bilder mit grünem Himmel, gelbem Wasser und blauen Häusern, in denen Tische und Wallachsofa sichtbar waren. Ferner überragende Menschen, deren Melonenhäupter bisweilen zwei Nasen, drei Augen und aufgeklebte Dreieckshüte trugen. Auf unbekleideten, transparenten Rumpf-Ellipsen erschienen Herz, Magen und auffällige Fransenmarkierungen. Ungefragt erläuterte der Junge: „Die Frauen haben Haare unterm Bauch, damit man nicht sieht, wo der Puller fehlt. Und die Männer haben Haare auf der Brust, damit man nicht sieht, wo die Kullern fehlen.“
„Das sind ja lustige Ansichten“, bemerkte die Mutter. „Dann müsste auch unter den Haaren auf dem Kopf bei den meisten Leuten etwas fehlen.“
„Vielleicht Gehirn?“, mutmaßte der Sohn.
Dieser Annahme und jener von den eventuellen Vorzügen der Scheitelplatte des Vaters vermochte Frau Dagmar wenig entgegenzusetzen.
Etwas beunruhigt über Guidos Frühinformiertheit beobachtete sie ihn diskret bei seinem „Tagwerk“. Neben bunten, bizarren Malereien beschäftigte er sich damit, im Sandkasten Tunnel für Eidechsen zu graben und einen Swimmingpool für zwei Laubfrösche, deren Wetterprognosen er allerdings durch eifriges Begießen beeinträchtigte. Gern fuhr er mit dem Dreirad an Beerensträuchern entlang, um Grün-Weiß-Rot zu ernten. Besonders liebte er den Zauber des Winkels. Indem er über Stühle, Pfähle und Gezweig alte Decken spannte, schuf er Räume im Raum, geheimnisvolle Séparées, in denen er stundenlang hocken und sich im Verborgenen geborgen fühlen konnte.
Nur Annette durfte ihn in den Höhlen besuchen, während sie sonst meistens seine Partnerin in der Dreschschule, im Kaufmannsladen oder in „Himmel und Hölle“ war. Wenn sie Vater und Mutter miteinander mimten, verlangte der Junge merkwürdigerweise oft nach der Frauenrolle und den „väterlichen“ Zärtlichkeiten des schwarzhaarigen Mädchens.
Über allen Spielen stand jedoch das Doktorspiel. Innerhalb von zwei Stunden bekam Annette mindestens ein Dutzend Krankheiten, Knochenbrüche oder Verwundungen, die Guido gewissenhaft untersuchte und heilte. Er beklebte die Patientin kreuz und quer mit Pflaster, kurierte Blutvergiftungen mit Brausepulver, Kopfweh mit Bonbontabletten und die Masern mit Vasenolpulver. Zu den Höhepunkten der ärztlichen Universalbehandlung gehörten Zahnziehen, „Beißerchenbohren“ und beherzte chirurgische Schnitte über der Magengrube. Als die Freundin einmal eine Medizin gegen Bauchschmerzen verlangte, hielt der kleine Praktiker eine gründliche Inspektion unterhalb der Gürtellinie für erforderlich. Er musste einmal nachschauen, wo gemäß mütterlicher Auskunft die kleinen Kinder herauskamen. Behutsam betastete er die Weichteile zwischen Nabel und Steißbein, betrachtete interessiert die Leistenbeuge und stellte schließlich fest: „Ach, herrje, du hast ja zwei Pos. Wie lütt müssen Babys sein, die da rauskriechen können.“ Um der armen Kranken Linderung zu verschaffen, verordnete er ihr ein Klistier, was freilich nicht ohne Folgen blieb.
Am nächsten Vormittag erblickte Dr. Möglich das runde, schnurrbärtige Gesicht von Annettes Vater im Wartezimmer. „Hallo, Herr Nachbar“, sagte er, „was macht die Puste?“
Alban Holdheimer fühlte sich durch die gewohnte Anrede erleichtert, obwohl sie ihm die Sondermission vermutlich erschwerte. Schon seit Langem befand er sich in ärztlicher Behandlung wegen seiner Asthma-Anfälle, aber der Doktor (mit Routineuntersuchungen beschäftigt) verbreitete wieder einmal Optimismus: Gewiss kenne man heutzutage ungefähr zehntausend verschiedene Krankheiten oder Syndrome, doch infolge des wissenschaftlichen Fortschritts stürben die Leiden gleichsam schneller als die Leidenden. Selam für Methusalem! Ob man es denn vor hundert Jahren für möglich gehalten hätte, dass Epidemien wie Pocken, Cholera und Pest aus Europa verschwinden und bisher tödliche Mangelerscheinungen durch künstliche Insulin- oder Hormongaben behoben werden könnten? Na also! Ein bisschen Asthma bedeute an der medizinischen Front keinerlei Gefahr, da eine simple Adrenalinspritze zur Abwehr genüge.
„Dennoch pfiff ich gestern beinahe aus dem letzten Loch“, bemerkte der Nachbar.
Theo Möglich nahm die Goldrahmenbrille ab, wodurch seine hohe Stirn noch höher wirkte, und erklärte: „Dann müssen wir ein neues Allergen annehmen. Vielleicht auch ein Konfliktchen? Hoffentlich klappt es mit dem werten Liebesleben?“ „Auwei!“, fiepte Herr Holdheimer. Er legte den Kopf auf die rechte Schulter und sah momentan in seinem schwarzen Anzug wie ein melancholischer Geiger aus. Ein Weilchen überlegte er, ob er die Frage beantworten oder ausweichend über Guidos „unzüchtige Handlungen“ reden sollte. Am Ende rückte er näher an den Ordinationstisch heran und begann ein Gespräch unter Männern.
In der Tat gebe es gewisse Schwierigkeiten. Zwar wolle er sich nicht beklagen oder gar einen Zusammenhang zwischen Kalamität und Atemnot konstruieren, aber bekümmern tät ihn schon etwas. Mit seinem Weib wär’s im Ganzen recht nett, sie erfülle ihre Pflichten im Haus und Geschäft zur Zufriedenheit, wenngleich im Bett, sozusagen, nur anstandshalber. Freilich habe sie das Nettchen geboren, worüber er narrisch glücklich sei, obwohl sie bei der Empfängnis dagelegen hätt wie ein Kriegerdenkmal. Und so treibe sie’s fort: Kein Funken Gefühl bei der Kopulation, sondern stets ein Duldermäskchen wie die Heilige Jungfrau persönlich. Manchmal glaube er, das müsste ein Scheidungsgrund sein.
„Oha“, sagte Dr. Möglich, „für Sie oder Ihre Gattin? Wie benehmen Sie sich denn beim erotischen Hoppelpoppel? Immer Schnellbüffet, ja? Dachte ich’s mir doch, lieber Herr Holdheimer. Haben Sie schon mal überlegt, wie eine unzerkaut geschluckte Praline schmecken würde? Und Sie muten Ihrer armen Frau ständig zu, sie solle gewissermaßen an injizierter Nascherei Geschmack finden. Offenbar muss ich einem Delikatesswarenhändler eine Genießerlektion erteilen.“
„Ist’s wahr?!“, rief der Nachbar. Angesichts der eigenen beschämenden Unerfahrenheit erschien ihm seine „Sondermission“ samt beabsichtigtem Protest gegen den libidinösen Forschungseifer von Herrn Doktors Sprössling plötzlich recht läppisch.
Unterdessen dozierte der Arzt über die Wissenschaft vom bekömmlichen Liebesakt. Schon die alten Inder hätten, aufs Wort, vierundsechzig vergnügliche Positionen, Variationen und Spiele gekannt und dabei ein feines Empfinden für das zulängliche Zeitmaß bewiesen. Besonders gefalle ihm ein Vergleich, demzufolge wollüstige Bewegung ebenso langsam beginnen und sich allmählich beschleunigen solle wie Töpferscheibe, Kreisel oder Schaukel. Zur Ehe-Gymnastik seien Fantasie und Kunst vonnöten wie zum harmonischen Leben überhaupt.
„Harmonie? Gibt’s die denn noch?“, fragte Alban Holdheimer und entschloss sich dazu, das Zwiegespräch auszuweiten. „Wissen Sie, in der Liebe wird mir Ihr Rezept vielleicht helfen, schönen Dank, doch wie begegne ich der politischen Not, die mir Atemnot schafft? Ich fürchte, es geht nicht gut aus in Deutschland.“
„Man muss den Glauben an die Kraft der Humanität bewahren“, erklärte Dr. Möglich. „In der medizinischen Praxis bedienen wir uns des Placebo-Effekts, wobei sich zeigt, dass vierzig Prozent aller Patienten auf eine harmlose Zuckerpille genauso reagieren wie auf eine echte Droge. Auf Vertrauen kommt es an.“
Der Nachbar schüttelte den Kopf. „Ich wage nicht mehr, viel zu hoffen. Überall Drohung, Hass und Gewalttätigkeit. Verstehen Sie das? Als ob wir Juden nicht immer gute Deutsche gewesen wären! Und nun wollen die Schowis berühmte Gelehrte und Künstler, die zum deutschen Ansehen beitrugen, ansehen wie Parasiten.“
„Im Paradies blieb es bisher ruhig, lieber Herr Holdheimer.“
„Ja, gewiss. Aber was sind das für Sachen, die uns die Zeitungen täglich offerieren: Fememorde, geheime Aufrüstung, Gerangel an der Regierungsbank und das Gerede von der miserablen Rasse. Dazu ökonomischer Schlamassel, der einen Geschäftsmann zwackt wie Rheumatismus. Darf’s das geben in einem zivilisierten Establishment? Mir ist das unheimlich, lieber Doktor. Und wenn dieser Ahi an die Macht gelangt, denk ich, dann gnade uns Gott.“
Theo Möglich blätterte im Arzneibuch, als der Besucher leise hinzufügte: „Warum leben wir nur in einer derart schlimmen Zeit?“
„Um zu überleben, mein Freund.“
ZWEITES LUSTRUM
Sein Kampf in Bildern oder: Zeitansage, 6. Jahr
31. Januar (1. Bild): Nachdem der Boss den Bankiers und Finanziers baldige internationale Kreditwürdigkeit und Allerhöchsten Schutz versprochen hatte, ließen sie den Großkopfetenhut im Kreise herumgehen. Grinsend überreichten sie dem Retter der Nation drei Millionen Reichsmark als Morgengabe. Während Ahi auf die Kanzel hinaustrat, wo er aus dem Terzerol drei Schüsse abfeuerte, stellten die Konzernherren das Fließband zur Gangster-Show an. Vom Brandenburger Tor her beförderte die Rollbahn jubelnde Schowi-Trupps mit Fackeln, Fahnen und Fanfaren durch die Nacht. Transparente verkündeten den Kampf gegen Blähungen und unreines Blut, worauf viel Volk, vom Spektakel fasziniert, auf die Drehbühne sprang und zu den Rauschgiftbuden hindrängte. Berichterstatter Os prophezeite, der Spuk werde entweder zwölf Tage oder zwölf Jahre dauern. Aus dem Lautsprecher dröhnte hingegen eine rau-gutturale Stimme: „Ich werde ein Fundament für Jahrtausende bauen. Wenn von dieser großen Stadt und Metropole kein Stein mehr auf dem anderen liegt, soll die Welt noch immer unserer heiligen Bewegung gedenken.“
27. Februar (2. Bild): Am Nachthimmel über dem Reichstagsgebäude zu Berlin breitete sich Feuerschein aus. Gespenstisch spiegelte sich die brandumrandete Silhouette des Kuppelbaus in der Spree. Menschen rannten und gafften. Mit Verspätung trafen zehn Löschzüge ein, aus denen Wasserschläuche wie Anakonda-Schlangen hervorquollen und die Flammenflut im Parlament erstickten. Unterdessen tanzte Ahi in verqualmten Wandelgängen und schrie: „Jetzt hab ich sie! Es gibt kein Erbarmen. Lasst Köpfe rollen, Kerls, und killt! Schließlich senkte sich Dunkelheit über die Szenerie, doch in den Straßen kehrte nicht Stille ein wie sonst. Gestalten und abgeblendete Fahrzeuge huschten umher. ‚Du musst dich in Sicherheit bringen‘, dachte Os. Aber er wartete ab bis zum Hahnenruf.
21. März (3. Bild): Unweit eines Kurorts für Herzkrankheiten wurde das Konzentrationslager Rotenfeld eingeweiht. Wie die Staatszeitung meldete, äußerten sich Geistliche sehr anerkennend über die vorbildliche Unterbringung der Schutzhäftlinge in sauberen, luftigen Zimmern mit fließendem Wasser, über gesunde Kost und korrekte Behandlung. Vom Appellplatz her näherte sich im Laufschritt eine nummerierte Kreatur mit gelbem Kürbiskopf, blauem Auge und Zahnlücken. Mühsam erkannte der Besucher den ehemaligen Berichterstatter Os, dessen Atem pfiff und leise Worte ausstieß: „Sagen Sie den Freunden, es ist bald vorüber, bald aus. Ich bin am Ende, und das ist gut. Ich wollte nur Güte und Frieden.“ – Wie die Wandzeitung meldete, gelten die sumateraischen Batakstämme als die letzten Menschenfresser, die Gefangene auf Bambusstangen rösten und zum Reis verspeisen. Gemäß moderner wissenschaftlicher Erkenntnis bietet jeder frische Leichnam zwölf Pfund Proteine und Rohstoff für fünf Pfund Leim, ein Pfund Salz, ein Viertelpfund Zucker und diverse Mengen Phosphor und Eisen.
10. Mai (4. Bild): Am Nachthimmel über dem Opernplatz zu Berlin breitete sich Feuerschein aus. Doch kein Löschzug erschien im Zentrum. Unter den Linden marschierten Schowi-Kolonnen, oder sie brachten auf Lastautos und Ochsenkarren Bücherballen herbei. Während Blechkapellen musizierten, Licht- und Schalltrichter in Aktion waren, Volkslieder erklangen und die Kameraleute der Universum-Film-AG munter kurbelten, warfen Studenten mit lauten Bannflüchen „undeutsches“ Schrifttum in lodernde Scheiterhaufen. Telepathisch zuckte der Berichterstatter Os im Rotenfeld zusammen. Begeistert begrüßte die Versammlung den Entschluss Ahis, künftig allen Ehepaaren, ausgezeichneten Schülern und Erziehern den „Kampf“ zu verordnen, um jedermann darüber zu belehren, dass sich ein politisches Genie große Versprechungen im Leben und in einem Literaturwerk dreitausend Sprachfehler leisten darf.
Eine schöne Bescherung
Doktor Domagk liebte weiße Mäuse. Wenn er sie im gekachelten, wintergartenähnlichen Laboratorium fütterte, pflegte er sie zu streicheln, denn er sympathisierte mit ihrem unzeitgemäßen Kosmopolitismus und Kulturbedarf. Kopfschüttelnd hörte die Assistentin zu, als er den langgeschwänzten Albinos ein langgezogenes Flötenmotiv von Mozart vorpfiff und sie zum Liebestod für die Menschheit zu begeistern suchte. „Stellvertretung bald unerwünscht“, kommentierte ein unsichtbarer Boss.
Doktor Domagk vervollständigte mit rechtsschräger Schrift, deutsche und lateinische Buchstaben hochverräterisch mischend, Rotauges Chronik und Trimmprogramm. Er zog den weißen Kittel aus und sagte bye-bye. Von Station Westende aus hätte er bequem mit der Schwebebahn in Richtung Vohwinkel fahren können. Aber da er täglich stundenlang auf einem Drehschemel sitzen musste, schien es ihm ratsam, im vierzigsten Lebensjahr etwas gegen Hämorrhoiden und für die arterielle Strömungsgeschwindigkeit von 50 cm/sec. zu tun. Folglich marschierte er allmorgendlich vom Wohnhaus zum Pathologischen Institut und allabendlich zurück ins Zooviertel.
Doktor Domagk lief durch den Schwarzen Weg und die Tiergartenstraße. Ausblick: bewaldete Höhen, das Wupper-Wasser im Tal, mausgraue Grünanlagen, Viadukte und Villen unter Wolken, die den Dezember milde machten. Anblick: stattlicher Herr mit Vierkantschädel, Fledermausohren, rotbackigem Gesicht, kleinen Augen, fast wimpern- und brauenlos. Einblick: Gedanken an Erdbeeren, steigende Eierpreise, Bakterien, befohlene Volks- und Leistungsgemeinschaft, Abneigung gegen Teamwork.
„Als ich nach Hause kam“, erzählte der Chef den weißen Mäusen und der Assistentin, „sah ich den Schrei und ein Mädchen in Rot. Unverständlich, warum man mich nicht gerufen hatte. Von Ihnen, geschätzte Mitarbeiterin, wäre in vergleichbarer Situation sicher ein Telefonat geführt worden?“ Da sie nickte, sagte er: „Falsch! Die Experimente eines Forschers darf niemand stören. Wissen Sie, es gab nur ein bisschen Aufregung, weil mein Töchterchen Hilla beim Spielen eine Nähnadel zum Impfen benutzen oder die Festigkeit des Handwurzelknochens testen wollte. Kurzum, die Spitze brach ab, Geheul brach aus, ein Kollege von der Chirurgie entfernte den Fremdkörper und verschrieb der kleinen Patientin schmerzstillendes Brausepulver.“
Nun setzte der Pharmakologe die Versuchsserie fort. Er würzte Eibouillon mit Streptokokken, angelte nacheinander am Rückenfellchen zwei Dutzend Mäuse aus dem Gehege und lud sie zum Karma-Yoga ein. Per os verabreichte er ihnen mittels Kanüle die Mikrobensuppe und animierte die Tiere zum Fifty-fifty-Spiel. Nach einer Stunde (und nochmals am Nachmittag) durfte nur Rotauges Truppe erneut zur Nackenmassage antreten und zugleich je einen Kubikzentimeter basischen Azofarbstoff schlucken. Diese Prontosil-Limonade tropfte Domagk auch auf Spaltpilzlösung in Reagenzgläsern. Bald darauf untersuchte er sowohl Gewebeproben der beiden Mäuse-Korporationen wie den Pilzschnaps unterm Mikroskop und gewahrte mennigrote oder tintige Pünktchen, die in bestimmten Präparaten gleichsam wegtauten. – Am nächsten Tage meldete Rotauges Chronik das muntere Überleben seines gesamten Clans und das klägliche Abnibbeln der separierten, unversorgten Mäuse-Elf.
In der Weihnachtswoche wurde Doktor Domagk zu Hause vom Chirurgen erwartet, der eine ernste Aussprache wünschte. Trotz korrekter Entfernung der Nadelspitze, erklärte der Kollege, und trotz mehrerer Inzisionen habe sich der Zustand der kleinen Kranken überraschend verschlimmert. Die Ausbreitung der Phlegmone sei in einem Maße bedenklich, dass er, sozusagen, dringend die Amputation des Unterarms empfehle. „Fällt Ihnen gar nichts anderes ein?“, fragte der beglückte Vater. „Hoffentlich möchten Sie das Pfötchen nebst Elle nicht sofort in der Aktentasche mitnehmen. Ob Sie sich mit der famosen Spirituskonservierung noch ein wenig gedulden können? – Recht herzlichen Dank!“
Nach der Verabschiedung des Arztes stand der Forscher lange an Hillas Lager, wo er seine Forschheit rasch verlor. Ach, es sah wirklich übel aus mit dem lieben Kind: Patscherl wie Bärenpranke, Schüttelfrost, anhaltendes und ansteigendes Fieber, alarmierende Blutbildbefunde. Natürlich lag eine Infektion vor. Aber während man bei Bayer & Co. die Erreger fernster Tropenkrankheiten entdeckt und bekämpfbar gemacht hatte, gab es gegen viele europäische Seuchen und die Streptokokken dieser simplen Sepsis noch fast keine geeigneten Mittel.
Was tun? Wenn nicht bald etwas geschah, würde Hilla tatsächlich nur durchs Hackebeilchen zu retten sein. Vielleicht sollte man versuchen, alle Faktoren bedenkend, die verursachenden Bakterien zu bekriegen? Nun ja, durch Prontosil-Gaben wie bei den weißen Mäusen. Die jüngsten Experimente hatten doch zuverlässige Wirkungen erwiesen und ohnehin eine Anwendung in der Humanmedizin nahegelegt. Warum zögerte er? Uff! Weil ein Mädchen eben kein Mäuschen war. Weil das an Tieren erprobte Sulfonamid beim Menschen, bei einem liebsten Menschen, nicht unbedingt dieselben Reaktionen und Heileffekte hervorrufen musste.
Um Himmels willen, wenn seine Frau ahnte, welche Wagnisse er erwog! Als er dann sehr behutsam um ihre unumgängliche Zustimmung zur eventuellen Chemotherapie bat, antwortete sie ungewöhnlich pathetisch: „Ich schenke dir mein Vertrauen.“ Das erleichterte ihm seinen Entschluss keineswegs. Vertrauen? Er selbst brauchte es vor allem, denn wenn seine Forschungsergebnisse an Rotäuglein und weißen Mäusen im Mindesten trogen und sich in Großorganismen nicht bewährten, hegte er jetzt mörderische Gedanken. Mit einem Male fühlte er sich ungeheuer einsam, zumal ihm bewusst wurde, dass er sich zur riskanten Injektion bei einem fremden Menschen leichter bereitfände … Unterdessen begann Hilla von einem Zeppelin zu fantasieren, auf dem sie schwimmen und Blumen pflücken wollte, doch ihr Arm sei „so komisch schwer“ wie ein Ruder.
Erschrocken fuhr Doktor Domagk auf. Offenbar galt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Aus einem Medikamentenkästchen entnahm er drei Ampullen mit je fünf Kubikzentimetern Prontosil solubile, bereitete daraus ein Klistier und führte dem benommenen Kinde die Sonde ein. Außerdem gab er ihm Prontosil-„Limonade“ zu trinken. – Obwohl nichts Bedrohliches geschah, wagte er nicht aufzuatmen. Im Tierversuch pflegten sich Auswirkungen erst nach Stunden zu zeigen; wie nun, wenn er die Droge zu hoch dosiert hatte? Unruhig kontrollierte er Atmung, Pulsschlag und die unverändert hitzige Körpertemperatur der kleinen Tochter, deren Brechreiz er durch Luminal überwand. Vor dem Einschlafen verordnete er ihr tapfer eine weitere Prontosil-Tablette.
In der Nacht wachte der Vater in Hillas Zimmer. Nachdem er die Stehlampe zur Bettseite hin abgedunkelt hatte, saß er lesend im Lehnstuhl. Er blätterte in einer Zeitung, die von erstaunlichen Protesten der Bekennenden Kirche gegen die „falsche Lehre“ und Herrschaftsanmaßung weltlicher Behörden berichtete, von Volksgerichtshof, Hamsterkäufen und Winterhilfswerk. Dann vertiefte er sich in die Geschichte eines Wahrheitssuchers.
Im Helden erkannte er seine eigene Forscherneugier wieder: die Fahndung nach dem Bösen. Obwohl Gutes gelang, misslang das Bemühen um Weltverbesserung, weil die bedeutsame medizinische Erfindung auch Gesundheitsindustrie und Geschäfte mit der Krankheit ermöglichte. Musste sich der Entdecker rechtfertigen? Ließ sich sein Tun nicht vergleichen mit zwanghaftem, befreiendem Kunstschaffen, wobei experimentelle Präzision undenkbar war ohne Fantasie? Aus der Kriegserfahrung ärztlicher Machtlosigkeit erwuchsen produktive Ideen … Über die Maas sprangen tintige Heupferde, verbargen sich am Boden im Pilzgeflecht und schoben sich wie Perlschnüre in Schützenlöcher hinein. Im märkischen Lago amore, den Akazien und Buchen umstanden, tummelten sich bemooste Karpfen, während vom Johanniterberg eigentümlich stummelschwänzige Albino-Mäuse ins Binnenmeer sprangen und mondsüchtig Mozart pfiffen. Es roch nach Borke und Blaubeeren. Dazwischen schwebten, wie auf Präsent-Aquarellen vom alten Freund Rohlfs, gelbe, rufende Blumen.
Hilla rief. Und sie schrie, als sie beim Pullern zu bluten schien. Aber der Vater beruhigte sie über das vom Azofarbstoff erzeugte „Feuerwasser“. Bevor er wieder im Lehnstuhl Platz nahm und sich verantwortungsbewusstes Wachbleiben befahl, prüfte er ihren Puls und die Temperatur, schüttelte den Kopf und gab bange acht auf Atemzüge, halblaute Wortfragmente und Bewegungen, von denen er binnen Kurzem zwanzig zählte. Oh, wie sehr bat er insgeheim um die Mithilfe des geliebten Mädchens! Nur wenn es ihn mit natürlichen Widerstandskräften unterstützte, konnten die vom Prontosil geschwächten Bakterien endgültig ausgeboxt werden.
Am nächsten Morgen zog sich das Fieber um vier Teilstriche aus der Quecksilbersäule zurück.
In den folgenden Tagen benahm sich die Patientin, wie es sich für eine Romanheldin geziemt. Sobald Doktor Domagk frohlockte, jagte sie ihm mit Hitzerekorden nahe der Vierzig-Grad-Grenze argen Schrecken ein; sobald er sich bekümmert zeigte, bescherte sie ihm überraschend ein Temperaturtief. Übrigens ließ sie sich nur noch in den Po spritzen und zum Trinken der „ollen Tomatenlimonade“ bewegen, wenn man ihr dafür heute allerlei Belohnungen „für morgen“ versprach.
Doch am Ende gab es eine schöne Weihnachtsbescherung. Hilla blieb vom Hackebeilchen verschont und wurde gesund, und die Mutter sagte: „Was Vater tut, ist immer recht.“