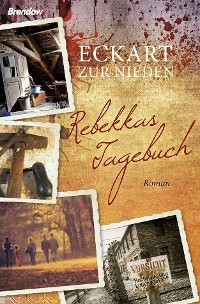Kitabı oku: «Rebekkas Tagebuch», sayfa 3
6
Ein schmutziger kleiner LKW fuhr auf den Hof, und ein Mann in ölverschmiertem blauem Arbeitsanzug stieg aus. Zielstrebig ging er auf die Tenne zu, in der Harald Born seinen Oldtimer stehen hatte.
Stefanie sah ihn durchs Fenster und kam auf den Hof. „Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?“
„Ich bin angemeldet“, sagte der Fremde. „Ich soll den Wagen von Herrn Born ... “
„Ist schon in Ordnung!“, rief Harald vom Fachwerkhaus aus und kam herüber. „Ich habe Herrn Wehmeier hergebeten, wieder mal“, erklärte er der Frau seines Enkels. „So ein Oldtimer muss immer mal bewegt werden. Und kontrolliert.“
Der Mechaniker nickte. „Und es gibt Teile, die lösen sich auf, auch wenn man gar nichts damit macht. Dichtungen zum Beispiel.“
Harald Born öffnete die beiden hölzernen Flügel. Da stand das Prachtstück, beigefarben und leicht verstaubt.
„Da geht einem das Herz auf!“, behauptete Herr Wehmeier mit einem Blick auf den alten Wagen. „Eine echte Borgward Isabella! Ein Schatz aus einer anderen Zeit!“
Stefanie konnte die Begeisterung der beiden Männer für das alte Auto nicht nachvollziehen. Sie wollte sich wieder zurück an ihre Hausarbeit begeben, entschloss sich dann aber doch, noch eine Weile zuzusehen.
Wehmeier setzte sich in das Auto und wollte es offenbar starten, was aber nicht ging. Lag das an der Batterie? Stefanie hatte keine Ahnung von so etwas. Sie musste aber wohl mit ihrer Vermutung recht gehabt haben, denn der Mechaniker fuhr nun sein eignes Auto dichter heran, klappte beide Motorhauben hoch und stellte eine Kabelverbindung her. Tatsächlich lief bald der Motor des alten Borgward.
Wehmeier fuhr seinen eigenen Wagen etwas zur Seite, um für den Oldtimer den Weg frei zu machen, stieg in diesen ein und fuhr ihn auf den Hof.
„Hier ist mehr Licht und mehr Platz“, sagte er zu dem stolzen Besitzer. „Ich sehe mir erst mal alles an, und dann fahre ich in meine Werkstatt. Heute Abend, spätestens morgen, bringe ich ihn wieder her. Mein Auto lasse ich solange hier stehen. Da stört es doch niemanden, oder?“
„Ist recht, Herr Wehmeier“, nickte Harald.
„Setzen Sie sich mal rein und betätigen Blinker, Bremse und so weiter! Ich kontrolliere die Lichter.“
Er musste jetzt seine Stimme etwas anheben, da gerade in Pauls Werkstatt die Schleifmaschine anfing zu laufen und ein kreischendes Geräusch zu machen.
Offenbar fiel die Kontrolle der Lichter befriedigend aus. Herr Wehmeier setzte sich nun wieder hinter das Steuer des Borgward und kurvte ein wenig auf dem Hof herum.
Stefanie fragte: „Sag mal, Großvater, willst du dir nicht mal ein neues Auto kaufen? Ich meine, es kann ja ruhig gebraucht sein, aber nicht so uralt wie das. Bei dem weißt du ja nie, ob du auch da ankommst, wo du hinwillst.“
„Ich fahre ja sowieso nicht damit. Wo sollte ich denn hinfahren?“
„Na, da muss man doch erst recht fragen, warum du die alte Kiste noch behalten willst und pflegen lässt.“
„Das verstehst du nicht. Es ist ein wertvoller Oldtimer. Der dient nicht zum Fahren, jedenfalls nicht hauptsächlich.“
„Sondern? Als Geldanlage?“
„Auch. Aber vor allem als Liebhaberstück.“
Der Mechaniker hielt kurz an, öffnete die Tür und rief: „Alles klar. Ich fahre dann.“ Er legte den Gang ein und ließ behutsam die Kupplung gehen. Sanft fuhr das alte Auto vom Hof.
„Dass man an so etwas Freude haben kann!“, staunte Stefanie und grinste Harald an. Sie sagte nicht, was ihr auch durch den Kopf ging: Besser, er beschäftigt sich mit einer alten Limousine als mit einem Panzer. Na ja, das ginge wohl schlecht. Aber mit Waffen und solchen Dingen.
„Weißt du, Stefanie, wenn man so jung ist wie du, blickt man in die Zukunft. In meinem Alter blickt man in die Vergangenheit. Du musst dich nach vorn ausrichten, Pläne machen, von Dingen träumen, die du erreichen willst. Bei mir kommt nicht mehr viel. Ich beschäftige mich mehr mit dem, was war.“
„Das verstehe ich“, nickte die junge Frau.
„Und zu dem, was war, gehört auch meine alte Luxuslimousine. Übrigens – sie kann auch eine Bedeutung für die Zukunft bekommen. Wenn ich mal gestorben bin, könnt ihr sie verkaufen. Sie hat einen hohen Wert.“
„Hast du sie schon mal schätzen lassen?“ Sie grinste, um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, sie warte auf den Erbschaftsfall.
„Du wirst überrascht sein, denke ich. Positiv überrascht.“
„Dass du noch eine Weile am Leben bleibst, ist wichtiger als dein Erbe“, schob Stefanie sicherheitshalber nach.
„Danke! Sehr freundlich.“
„Zumal wir ja gerade reich beschenkt worden sind.“
Harald nickte. „Ich habe es gehört. Erst von Leoni, dann von Paul und schließlich von Thea. Erstaunlich! 25.000 Mark!“
„Du kannst dir nicht denken, wer der edle Spender ist?“
„Ich kann es mir durchaus denken. Aber meine Tochter bestreitet es vehement.“
„Pauls Vater?“
„Natürlich. Wer sonst? Auch wenn Thea behauptet, der lebt nicht mehr.“
Harald setzte sich auf eine alte, grobgezimmerte Bank, die vor dem Haupthaus stand und auf der wohl frühere Generationen von Bauern pfeiferauchend gesessen und den Feierabend nach der harten Feldarbeit genossen hatten.
Stefanie setzte sich neben ihn, nachdem sie den Staub von der Sitzfläche geblasen hatte.
„Warst du – hoffentlich nimmst du es mir nicht übel, wenn ich das frage –, warst du sehr böse, als deine Tochter ein Kind bekam, ohne verheiratet zu sein? Ich meine, damals waren die Moralvorstellungen ja noch nicht so locker wie heute.“
„Natürlich war ich zunächst – nun, sagen wir: nicht besonders glücklich. Böse war ich ihr nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Nur darüber war ich ihr böse, dass sie mir weder verraten wollte, von wem das Kind ist, noch etwas unternahm, um alles in ordentliche Bahnen zu lenken. Sprich: den Mann zu heiraten.“
„Sie sagt, der lebt nicht mehr.“
„Das habe ich immer für eine Ausrede gehalten.“
Sie schwiegen eine Weile. Das Schleifen aus Pauls Werkstatt war inzwischen in ein Hämmern übergegangen.
Dann ergriff der alte Mann noch einmal das Wort. „Du darfst aber nicht denken, dass ich gegenüber Paul voreingenommen bin, weil er nicht aus einer ordentlichen Ehe stammt. Wäre Thea verheiratet, wäre Paul kein besserer Enkel als jetzt. Ich habe ihn gern. Und besonders meine Urenkelin.“
Dann fiel ihm noch etwas ein: „Und dich selbstverständlich auch!“
Stefanie schmunzelte, wurde aber gleich wieder ernst. „Leoni liebt dich auch.“
Er nickte. „Paul hat mit mir gesprochen, ich soll ihr nichts vom Krieg erzählen. Thea hat das auch schon gesagt. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass ihr das schaden würde, aber ich akzeptiere euren Wunsch.“
„Danke! Verstehst du, ich will verhindern ... “
Harald hob die Hand und schnitt ihr damit das Wort ab. „Ist gut. Lass uns nicht darüber diskutieren. Ich halte mich an eure Erziehungsgrundsätze. Punkt.“
Wieder schwiegen beide. Die Katze kam angeschlichen, blieb vor Stefanie sitzen, sah zu ihr auf und miaute. Dann sprang sie mit einem Satz auf ihren Schoß. Stefanie kraulte sie am Hals.
„Ja, die Erziehungsgrundsätze ... “, murmelte Harald überlegend. „Manches ist so völlig anders als zu meiner Zeit, dass ich es überhaupt nicht verstehe. Was muss das früher für die Alten eine befriedigende Situation gewesen sein, zu beobachten, dass die Kinder und Enkel ihre Wertvorstellungen übernommen haben. Der Urenkel des Bäckers wollte genauso erfolgreich Brot backen wie der Urgroßvater, der Kaufmann das Geschäft des Gründers von vor vielen Generationen weiterführen, und der junge Ritter wollte genau so ein Kriegsheld werden wie sein Ahnherr, den irgendein König vor Jahrhunderten zum Ritter geschlagen hatte.“
„Da hast du recht, so ist es heute nicht mehr. Sonst müsste Paul ein Bauer sein. Aber du warst ja auch schon keiner.“
Darauf ging der Alte nicht ein. „Bei manchen Dingen habe ich den Eindruck, heute wird genau so gedacht wie vor meiner Jugend. Bei uns gab es so viel Neues, das uns begeistert hat. Es fiel uns wie Schuppen von den Augen, und auf einmal sahen es alle so. Zum Beispiel die Größe unseres Volkes. Oder die Fehlentwicklung der Weimarer Demokratie. Oder das Verderben, das durch die Juden kam. Aber alle diese Gedanken und Erkenntnisse sind verschwunden. Man darf noch nicht mal davon reden.“
Stefanie erschrak. Und sie beschloss, auch nicht davon zu reden. Er hatte ja schon deutlich gemacht, dass es keinen Sinn hatte zu diskutieren. Klar: Der alte Mann hatte seltsame Ansichten. Aber sonst war er ein netter Großvater und Urgroßvater. Ändern würde sie ihn nicht.
Leoni kam über den Hof gelaufen.
„Da bist du, Mama! Ich habe dich gesucht!“
„Setz dich zu Uropa, Leoni, und nimm Muschi auf den Schoß. Die ist anscheinend zurzeit besonders anlehnungsbedürftig. Ich muss bügeln.“
7
„Schlürf nicht so mit deiner Suppe!“, mahnte Stefanie ihre Tochter.
Paul fragte: „Wie war‘s denn heute im Kindergarten?“
„Schön. Ich habe mit Kai gespielt.“
„Mit Puppen?“, fragte Paul leicht verwundert.
„Nein, mit der Kugelbahn. Du, Papa!“
„Hm?“, machte der mit vollem Mund.
„Das Auto war da. Vorne an der Ecke.“
„Da sind öfter mal Autos. Welches meinst du denn?“
„Na, wo der Mann mir das Geld gegeben hat, für dich.“
Paul verschluckte sich fast. „Der Mann ... Hast du das Auto wiedererkannt?“
„Ja, weil da an der Seite, an der Tür, da war so was gemalt.“
Paul sprang auf und sagte zu Stefanie: „Ob uns der beobachtet? Vielleicht steht er ja noch da. Ich renne mal schnell hin.“ Er warf fast den Stuhl um und lief zur Tür. Da drehte er sich noch einmal um.
„Leoni, was war auf das Auto gemalt?“
„So zwei Räder. Solche mit Zacken drumrum.“
„Zahnräder?“
„Ja, Zahnräder. Eins war hier so ... “ Sie zeigte es mit der einen Hand in der Luft und deutete mit der anderen eine Position schräg rechts darunter an. „Und das kleinere hier.“
„Welche Farbe hatte das Auto?“
„Äh, so wie ... die Jacke von meiner Puppe.“ Als Paul ahnungslos guckte, erklärte Stefanie: „Hellblau.“
„Bin gleich wieder da!“ Er rannte los.
An der Ecke, die seine Tochter offenbar gemeint hatte, stand kein Auto. Auch sonst parkten an der Dorfstraße nur der Kombi des Bäckers und der rote VW von Hans Hebel, den kannte er. Eine Weile stand er unschlüssig da und sah sich um. Dann ging er in den Bäckerladen.
„Hallo, Liesbeth. Sag mal, hast du zufällig vor kurzem hier auf der Straße einen hellblauen PKW gesehen, mit einem Firmensignet an der Seite: zwei Zahnrädern?“
„Nee, Paul. Ich gucke aber auch nicht dauernd auf die Straße. Was hat‘s denn damit auf sich?“
„Ach, nichts Wichtiges. Nichts für ungut! Grüß Herbert von mir, wenn du dran denkst! Tschüss.“ Weg war er.
Zu Hause angekommen, informierte er seine Frau nur mit einem Kopfschütteln. „Schade“, sagte die. „Hätte doch zu gerne gewusst, wer unser Wohltäter ist.“
„Und weshalb er hier ... Vielleicht wollte er nachsehen, ob ich schon den Unimog gekauft habe.“
„Nun iss erst mal fertig!“
Das tat Paul. Als sie fertig waren mit der Mahlzeit, ging er ans Telefon und blätterte im Telefonbuch.
„Wen willst du denn anrufen? Suchst du nach Zahnradfabriken?“
„Die Industrie- und Handelskammer. Da kenne ich den – Moment, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Ich weiß nur noch, dass er Heinrich heißt ... es war so ein komischer Name ... irgendwas Schlimmes. Ah, jetzt weiß ich‘s wieder: Übler heißt er, Heinrich Übler.“
Er fand die Industrie- und Handelskammer und ließ sich zu Herrn Übler durchstellen.
„Hallo, Heinrich! Hier ist Paul, Paul Born. Weißt du noch, wer ich bin? Na, prima! Ja, waren tolle Zeiten, ich denke gerne daran. – Du, Heinrich, du könntest mir einen Gefallen tun. Kennst du eine Firma, oder kannst du sie ausfindig machen, die ein Emblem hat mit zwei Zahnrädern? Das größere oben und das kleinere schräg rechts darunter. – Das kann ich dir nicht sagen, ich habe es selbst nicht gesehen. – Da wäre ich dir dankbar. Ruf mich einfach an, wenn du was gefunden hast. Ich sage dir noch meine Nummer.“
Das tat Paul, und dann legte er auf.
„Meinst du, er kann dir helfen?“, fragte Stefanie.
„Er will‘s versuchen. Er hätte zwar gern Genaueres gewusst ... “
Das Telefon klingelte. Paul hob ab. „Na, das ging aber schnell, Heinrich!“
„Äh – das muss ein Irrtum sein. Hier ist kein Heinrich.“
„Oh – entschuldigen Sie bitte! Ich erwartete einen Rückruf.“
„Spreche ich mit Herrn Paul Born?“
„Ja.“
„Hier ist das Bürgermeisteramt der Großgemeinde Pfalzhof. Einen Moment bitte, ich verbinde Sie mit Bürgermeister Buchner.“
Es dauerte einige Augenblicke, dann meldete sich eine tiefe Stimme. „Herr Born? Buchner hier. Haben Sie ein paar Minuten, Herr Born?“
„Natürlich, Herr Buchner.“
„Wir sind uns schon mal begegnet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern.“
„Aber ja. Ich kenne Sie von verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. Voriges Jahr – nein, es war schon vor zwei Jahren – hatte ich den neuen Brunnen gestaltet. Da habe ich beim anschließenden Festbankett neben Ihnen gesessen.“
„Beziehungsweise ich neben Ihnen. Bei so einem Anlass sitzt nicht der Künstler neben dem Bürgermeister, sondern der Bürgermeister neben dem Künstler. Auch ich erinnere mich gut daran. Und das ist auch der Anlass, weshalb ich anrufe. Unser Stadtrat hat beschlossen, eine kleine Gedenkstätte zu errichten für die jüdischen Mitbürger unserer Gemeinde, die während des sogenannten Dritten Reiches verschleppt wurden und umgekommen sind. Es ist ja reichlich spät dafür, zugegeben, aber unsere Vorgänger hatten dafür wohl kein Interesse. Nachdem nun aber mehrfach aus der Bürgerschaft Anträge kamen, Anregungen, Vorschläge, manche wütend fordernd, andere mit höflicher Zurückhaltung, haben wir uns dazu entschlossen. Wenn die Recherchen meines Büros richtig sind, müssen es dreiundzwanzig Personen sein. Wir stellen uns eine lichte, offene Anlage vor, mit einer Gedenktafel, auf der die Namen stehen. Aber das Ganze soll natürlich künstlerisch gestaltet sein. Alle im Stadtrat fanden es naheliegend, damit einen Künstler aus unsrer Gemeinde zu beauftragen. Zumal Sie mit dem Brunnen ja schon einen Beweis Ihres Könnens abgeliefert haben.“
„Es würde mich freuen, wenn ich den Auftrag bekäme.“
„So ganz einfach ist es natürlich nicht. Wir müssen auch noch andere Künstler fragen, uns Entwürfe vorlegen lassen und über den Preis reden.“
„Dass wir über den Preis reden müssen, ist klar. Aber mit einem Entwurf ist das nicht so einfach. Sie wissen vielleicht noch, wie meine Arbeitsweise ist, Herr Buchner. Am Brunnen kann man das auch sehen. Ich suche große Steine – meistens im Steinbruch, manchmal auch mit besonderer Genehmigung in Bachbetten. Wenn die eine Besonderheit aufweisen, die ich herausarbeiten kann, lasse ich die so zur Geltung kommen, wie es von der Natur vorgegeben ist. Ich kann Ihnen also einen Entwurf der Gesamtanlage vorlegen, wenn ich das Gelände gesehen habe. Aber den Stein muss ich erst noch suchen.“
„Hm, ja, verstehe. Vielleicht, Herr Born, sollten Sie mal zu einer Sitzung unseres Stadtrates kommen und Ihre Vorstellungen grob skizzieren.“
„Ja, gern. Nennen Sie mir einen Termin!“
„Nun, Sie müssen sich ja erst mal Gedanken machen. Es eilt ja auch nicht. Die Informationen, die Sie brauchen, bekommen Sie von unsrer Sekretärin. Auch mit Herrn Eberhard Blei vom Geschichtsverein können Sie sprechen, er ist mit der Sache schon länger befasst. In einigen Tagen sollten wir noch mal telefonieren und einen Termin ausmachen.“
„Einverstanden. Ich sehe mir den Platz an, suche einen geeigneten Stein und mache mir Gedanken. Und im Übrigen warte ich auf Ihren Anruf.“
„So machen wir‘s. Auf Wiederhören, Herr Born.“
„Auf Wie ... ach, noch etwas, Herr Buchner. Die Namen der Juden aus unserem Ort, die umgekommen sind – haben Sie die aus so einer Art Einwohner-Melderegister?“
„Ja. Aber es sind auch welche dabei, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich umgekommen sind. Klar ist nur, dass sie verschleppt wurden. Es hat sich da jemand viel Mühe gemacht, die Namen zusammenzutragen.“
„Kann es sein, dass auch Juden irgendwo versteckt waren, die nicht erfasst sind? Weil sie gar nicht in unserer Gemeinde gemeldet waren, aber eben hier Zuflucht gefunden haben?“
„Natürlich kann das sein. Aber woher sollen wir dann ihre Namen kennen? Ich weiß nicht, ob das vom künstlerischen Standpunkt aus geht, aber vielleicht können Sie die Namen auf der Tafel oder dem Stein so anordnen, dass man Namen nachtragen kann, falls später noch welche bekannt werden.“
„Ich fürchte, das wird nicht gehen, vom ästhetischen Gesichtspunkt aus ... Ein leerer Platz ... “
„Machen Sie‘s, wie Sie denken. Sie verstehen mehr davon. Sie entschuldigen mich, Herr Born, ich habe gleich einen wichtigen Termin.“
„Klar, es ist ja auch das Wichtigste besprochen. Auf Wiederhören!“
8
Stefanie hatte die nächste Eintragung im Tagebuch schon einmal durchgelesen und sich Notizen gemacht. So konnte sie besonders schwer zu entziffernde Stellen flüssig vorlesen. Ein wenig spielte auch die Neugier mit. Sie hatte keine Geduld, zu warten, bis Paul Zeit hatte, zuzuhören.
14. August 1941
Wir kamen beide fast gleichzeitig auf den Gedanken. Als uns Elisabeth erzählte, dass die Heidelbeeren reif seien, sie aber keine Zeit habe, welche zu pflücken, sagte ich: „Aber wir!“ Und Aaron ergänzte: „Wir müssen unbedingt mal hier raus! Man wird ja verrückt, wenn man so lange eingesperrt ist. Und da ist das Heidelbeerpflücken ideal! Im Wald sucht uns keiner. Und wenn doch mal ein Wanderer oder ein Pflücker kommt, weiß er ja nicht, wer wir sind. Gefährlich ist es, wenn uns jemand im Hof sieht. Jeder im Dorf weiß, dass wir nicht hierhingehören. Aber im Wald ... “
„Wir verlassen den Hof morgens bei Dunkelheit und kommen erst spätabends wieder“, ergänzte ich. „Dann kann gar nichts passieren.“
Nach einigem Zögern stimmte Elisabeth zu. „Gut. Ich bringe euch heute Abend noch etwas zu essen, das ihr morgen mitnehmen könnt. Und Gefäße für die Beeren.“
„Ja!“, sagte Aaron begeistert. „Mehrere Eimer! Wenn wir den ganzen Tag pflücken, kommt eine Menge zusammen.“
Elisabeth beschrieb uns sehr genau, wo wir ergiebige Heidelbeerfelder finden könnten. Sie hatte Erfahrung aus früheren Jahren.
Wir hatten keinen Wecker, aber wir waren am nächsten Morgen schon wach, ehe der Hahn krähte. Vorsichtig stiegen wir die Leiter hinunter und schlichen uns vom Hof. Während wir zu dem beschriebenen Wald unterwegs waren, begann es langsam hell zu werden, sodass wir, als wir ankamen, sofort mit dem Pflücken beginnen konnten. Tatsächlich schimmerte hier sehr viel Blau zwischen den kleinen grünen Blättern, der Tag versprach eine reiche Ernte.
Aber unsere anfängliche Begeisterung überstieg deutlich unsere körperlichen Fähigkeiten. Wir waren diese Arbeit nicht gewohnt. Bald tat mir der Rücken weh, und ich konnte nur noch kniend oder im Sitzen pflücken. Bald gab es auch blaue Flecken auf meinem Rock. Aber – was machte das schon! Es sollte uns ja sowieso niemand sehen.
Zweimal kamen Menschen vorbei: Ein älterer Herr mit Hund machte wohl einen Spaziergang. Wir nickten grüßend. Und eine Frau in etwa meinem Alter kam auch mit einer Milchkanne. Anscheinend kannte sie noch ein anderes Gebiet mit vielen Heidelbeeren, denn als sie uns sah, meinte sie wohl, wir hätten hier unseren Claim abgesteckt, und ging weiter.
Als die Sonne hoch am Himmel stand, machten wir Mittagspause. Wir aßen das Brot, das uns Elisabeth mitgegeben hatte, tranken Wasser aus einer zweckentfremdeten Bierflasche und bewunderten mit einem Blick in den Eimer unseren bisherigen Erfolg.
Nach kurzem Dösen – auf dem weichen Waldboden mit Fichtennadeln und Ameisen liegend – machten wir uns wieder ans Werk.
Dabei kamen wir zu einem dicht mit Sträuchern bewachsenen Hang, der zu einem kleinen Bach abfiel, eher einem Rinnsal.
Plötzlich hörten wir aus einiger Entfernung das hohe Geschrei von Kinderstimmen. Wir richteten uns auf – froh, mal das Kreuz strecken zu können – und lauschten. Es kam auf uns zu und wurde immer lauter.
Da sprangen einige Jungen aus dem Wald – nicht direkt auf uns zu, aber so, dass sie wohl nahe bei uns vorbeikommen mussten. Hitlerjungen offenbar, denn sie trugen alle die gleichen Hemden mit Halstüchern. Sie waren so zwischen acht und elf Jahren alt, schätzte ich. Zunächst waren es sechs oder sieben. Als sie den Bach erreicht hatten, sprangen sie hinüber und blieben keuchend stehen. Uns schienen sie gar nicht zu bemerken. Dann folgte noch ein Pulk von fünf Jungen, danach noch ein paar einzelne.
Sie alle sprangen über den Bach und schauten, nachdem sie teilweise gebückt Atem geschöpft hatten, zurück, wer da noch kommen sollte.
Tatsächlich kamen noch zwei Jungen völlig entkräftet angerannt und zum Schluss ein kleiner, vielleicht acht Jahre alt. Er konnte kaum noch. Er war auch etwas pummelig und offenbar nicht sehr sportlich.
Als die Gruppe jenseits des Baches ihn beobachtete, wie er kraftlos angestolpert kam, schrien sie ihm laut entgegen. Das Stimmengewirr war aber so durcheinander, dass wir nichts verstehen konnten.
Der Junge wurde immer langsamer und blieb etwa zwanzig Meter vor dem Bach stehen. Die andern brüllten. Allmählich konnten wir einiges von ihrem Geschrei verstehen. „Komm her, Feigling!“, „Karlchen ist der Letzte!“, „Karlchen ist der Jude!“.
Der Jude? Was hatte das zu bedeuten?
Einige größere Jungen sprangen wieder über den Bach zurück und ergriffen das Kind, das offenbar Karlchen hieß. Unter dem Gejohle der anderen führten sie Karlchen zu einem Baum, stellten ihn davor, bogen seine Arme nach hinten und fesselten sie mit einem Bindfaden. Der Junge weinte.
Jetzt schritt einer der Größeren die Entfernung ab: zehn Schritte von dem Baum mit dem Gefesselten. Sie zogen einen Strich mit den Schuhen in den Boden, andere legten Äste dazu. Unter wildem Geschrei holten nun die Jungen mit den Händen Schlamm aus dem Bach, stellten sich an der Grenzlinie auf und bewarfen Karl damit. Dabei schrien sie: „Jude! Jude! Karlchen ist unser Jude. Gebt es ihm!“
Karlchen wurde von dem Schlamm überall getroffen, auch im Gesicht. Er heulte, aber nicht laut.
Ich sah Aaron an und bemerkte, wie sein Gesicht vor Zorn rot wurde. Nach den ersten Sekunden, die er brauchte, um zu verstehen, was hier geschah, rannte er los.
„Was macht ihr da?“, rief er. „Aufhören! Hört sofort auf!“
Die Jungen waren im ersten Augenblick erschrocken, dass sich da ein Erwachsener einmischte. Aber dann protestierten sie: „Es ist ein Spiel!“, „Er war der Letzte, also ist er der Jude!“, „Das muss er sich gefallen lassen!“. Andere sagten gar nichts, bewarfen den Kleinen nur fleißig weiter.
Mir schwante Unheil, und ich rannte hinter Aaron her. Der riss gerade einen der größeren Jungen zurück, der im Begriff war, einen Dreckklumpen zu werfen, in den er einen Tannenzapfen eingeknetet hatte. Aber der Junge entwand sich seinem Griff und warf schnell, ohne jedoch zu treffen. Dafür trafen andere. Es war unmöglich, diese wild gewordene Schar von fünfzehn oder zwanzig Jungen zu bändigen.
„Warum soll er denn ein Jude sein?“, fragte Aaron hilflos. Einer antwortete hämisch grinsend: „Na ja, über einen Juden können wir uns hermachen. Der hat es verdient.“
„Habt ihr kein Mitleid mit Karlchen?“
„Mitleid? Wieso? Er war der Letzte. Schwächlinge wollen wir sowieso nicht bei uns haben.“
Da lief Aaron zu dem Baum mit dem Jungen. Was sollte das? Mir stockte der Atem. Aaron stellte sich vor Karlchen, blitzte die anderen Jungen zornig an und rief: „Ich bin Jude! Bewerft mich!“
Es wurde mit einem Mal still. Einen Erwachsenen mit Dreck zu bewerfen, trauten sie sich anscheinend nicht. Das war wohl auch Aarons Plan. Einige Jungen traten etwas zurück und wirkten verlegen, andere kneteten weiter an ihren Wurfgeschossen. Es sah so aus, als würden sie nach dem ersten Zögern doch auf diesen Mann werfen wollen, der ihnen den Spaß verdarb.
Aaron winkte mir. Ich verstand, was er wollte. Ich lief hin, knotete Karlchens Fesseln auf und führte den immer noch weinenden Jungen zum Bach. Dort half ich ihm, sich einigermaßen sauberzumachen, soweit das möglich war.
„Was wollen Sie?“, schrien einige der Jungen. „Es geht Sie gar nichts an, was wir spielen!“
„Ihr spielt nicht! Ihr fügt Karlchen Schaden zu. Selbst wenn ihr ihn nicht verletzt ... ihr beleidigt ihn, ihr erniedrigt ihn!“
„Er ist so ein Waschlappen, den kann man gar nicht erniedrigen.“
Ein anderer Junge rief: „Aber wenn Sie unbedingt der Jude sein wollen – das können Sie haben!“ Und er warf einen Kiefernzapfen nach Aaron.
Es war ein Test. Sie rechneten damit, dass er sich jetzt aus der Schusslinie zurückziehen würde. Das tat er aber nicht, und das wiederum ermutigte andere, auch zu werfen.
„Schluss jetzt!“
Am Waldrand erschien ein junger Mann, vielleicht neunzehn oder zwanzig Jahre alt. Da er genauso wie die Jungen gekleidet war, nur statt einer kurzen eine lange Hose trug, musste er wohl der Gruppenleiter sein. Er kam heran.
„Stillgestanden!“
Die Jungen rührten sich nicht und ließen ihre Wurfgeschosse fallen. Der junge Mann wandte sich an Aaron.
„Ich muss mich entschuldigen für meine wilde Bande. Manchmal kennen sie die Grenzen nicht.“ Dann wandte er sich an die Schar. „Erich, Dankmar, Detlef! Ihr helft der Dame, Karlchen sauberzumachen. Die anderen zurück ins Lager! Aber zack, zack!“
Alles funktionierte reibungslos. Der junge Mann kam auf Aaron zu und reichte ihm die Hand. „Heinze mein Name. Ich leite die Gruppe. Wir haben hier in der Nähe ein Zeltlager.“
„Schimmel.“
„Angenehm. Meine Anerkennung für Ihren Mut einzugreifen. Obwohl es nicht nötig gewesen wäre.“
„Nicht nötig? Der arme Junge kann einen Knacks fürs ganze Leben kriegen, wenn andere ihn so fertigmachen.“
„Was uns nicht umbringt, macht uns stark!“, schnarrte der junge Mann. Es klang auswendig gelernt. „Und wenn er das nicht vertragen kann, dann passt er nicht in unsere neue Gesellschaft.“
Mir kam die Galle hoch bei diesen hochnäsigen Worten aus dem Mund eines Schnösels, der noch kaum etwas vom Leben erfahren haben konnte. Ich hoffte inständig, Aaron, der sicher ähnlich empfand wie ich, würde sich beherrschen.
„Und mutig von Ihnen, sich als Jude zu bezeichnen!“, sagte der Herr Heinze. „Ich habś gehört, von da oben.“
„Warum ist das mutig?“ Aaron bebte innerlich, das konnte ich sehen, aber er sprach mit beherrschter Stimme.
„Warum? Na, wer will schon freiwillig ein verdammter Jude sein!“
„Kennen Sie einen Juden persönlich?“
„Gott sei Dank nicht! Ich will auch keinen kennenlernen.“
„Woher kommt dann Ihr negatives Urteil?“
Ich hielt die Luft an. Aaron redete sich um Kopf und Kragen!
Der Gruppenleiter lachte laut. „Das klingt ja jetzt, als wollten Sie die Juden verteidigen! Aber Scherz beiseite – tut mir leid, dass Sie als harmloser Beerenpflücker so in diese Schlammschlacht geraten sind. So, jetzt muss ich aber ... Na, Karlchen! Alles einigermaßen sauber? Nun hör auf zu heulen! Ein echter Kerl heult nicht! Läufst halt nächstes Mal etwas schneller, dass ein anderer der Jude wird.“
Damit wandte er sich um und verschwand. Die vier Jungen folgten ihm.
Ich ging, als sie verschwunden waren, zu Aaron und legte ihm den Arm um die Schulter. „Aaron! Warum hast du das getan? Du hast mit dem Feuer gespielt!“
„Ich konnte nicht anders, Rebekka. Ich war so voller Wut, ich konnte nicht anders. Am liebsten hätte ich ... na, ich hab mich beherrscht. Tut mir leid, dass ich dir Angst eingejagt habe. Und dich in Gefahr gebracht! Das fällt mir erst jetzt ein.“
„Uns beide.“
„Ja. Komm, wir pflücken weiter! Dieses Eimerchen sollte auch noch voll werden.“
Es zeigte sich: Heidelbeeren pflücken war der beste Weg, innerlich zur Ruhe zu kommen. Man musste sich nicht so auf die Arbeit konzentrieren und konnte seinen Gedanken nachhängen. Das tat ich, bis die stürmische See in mir sich allmählich zu einem sanften Wellengang abgeschwächt hatte.
Als die Sonne sank, machten wir uns auf den Heimweg. Wir sprachen nicht mehr über das Erlebnis. Wahrscheinlich schwieg jeder von uns mit Rücksicht auf den anderen. Was gab es auch zu reden? Ändern konnten wir nichts an dem „neuen Geist“, der da im Land herrschte und der sogar den Kindern eingeimpft wurde. Was sollte daraus noch werden? Was sollte aus uns Juden werden?
Als Elisabeth später kam, überreichten wir ihr stolz unsere Ernte und erzählten kurz, was geschehen war. Sie war erschrocken und bestand darauf, dass wir zukünftig in unserem Versteck bleiben sollten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.