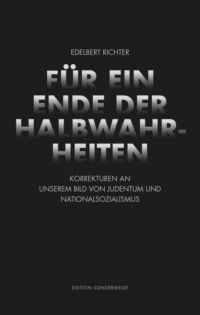Kitabı oku: «Für ein Ende der Halbwahrheiten», sayfa 5
10. Weitere jüdische Vertreter der »Blutsgemeinschaft«
Einen weiteren frühen Rasseideologen auf jüdischer Seite erwähnt allerdings auch Hannah Arendt nicht. Er ist durchaus nicht weniger prominent als Disraeli, nur gehört er nicht zur konservativ-restaurativen Strömung des 19. Jahrhunderts, sondern zunächst zur revolutionär-kommunistischen. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 emigrierte er aus Deutschland nach Frankreich und kam nach dem Studium der anwachsenden Literatur über die menschlichen Rassen zu dem Ergebnis, dass sich hier eine viel tiefere Dimension auftat als die politische und soziale. Die Rede ist von Moses Hess (1812–75), der eine Zeit lang mit Marx befreundet war und nun in seinem Buch Rom und Jerusalem (1862) schrieb: »Hinter den Nationalitäts- und Freiheitsfragen, welche heute die Welt bewegen, birgt sich eine noch weit tiefere, durch keine allgemeinen philanthropischen Redensarten zu beseitigende Rassenfrage (…), die, so alt wie die Geschichte, erst gelöst sein muss, bevor an eine definitive [sic] Lösung der politisch-sozialen Probleme weitergearbeitet werden kann.«119 Man konnte also auch von links her zur Rassenlehre kommen, freilich aufgrund des Scheiterns des eigenen Engagements und des Versuchs, die Ursachen zu erkennen. Offenbar war es der linke und jüdische Internationalismus, der da infrage gestellt war und nun ins Gegenteil eines extremen Nationalismus umschlug. »Die jüdische Rasse ist eine ursprüngliche, die sich trotz klimatischer Einflüsse in ihrer Integrität reproduziert. Der jüdische Typus ist sich im Laufe der Jahrhunderte stets gleichgeblieben.« Es helfe »den Juden und Jüdinnen nichts (…), durch Taufen und Untertauchen in das große Meer der indogermanischen und mongolischen Stämme ihre Abstammung zu verleugnen. Der jüdische Typus ist unvertilgbar. Er ist auch unverkennbar«.120 Zwar betont Hess auch die Bedeutung der Religion für das jahrtausendlange Bestehen dieses Volkes. Am Ende aber war sie für ihn doch nie etwas anderes »als ein aus Familientraditionen sich fortbildender nationaler Geschichtskultus«.121
Mit Moses Hess war wiederum Heinrich Graetz (1817–91) eng befreundet, der Verfasser der großen, umfangreichen und schulbildenden Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart (die ab 1853 erschien). Er war zwar kein Rassist, provozierte aber mit bestimmten polemischen Äußerungen Heinrich von Treitschke so sehr, dass es darüber 1879 zu dem bekannten Berliner Antisemitismusstreit kam. Treitschke schrieb in den Preußischen Jahrbüchern: »Man lese die Geschichte der Juden von Graetz: welche fanatische Wuth gegen den ›Erbfeind‹, das Christentum, welcher Todhaß grade wider die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens, von Luther bis herab auf Goethe und Fichte! Und welche hohle, beleidigende Selbstüberschätzung!«122 Graetz aber blieb in seiner Antwort an Schärfe nicht hinter dem deutschen Historiker zurück, sondern zitierte am Ende genau den Satz von Disraeli, den wir oben schon kennengelernt haben: »Sie können nicht eine reine Rasse von kaukasischer Organisation zerstören. Es ist ein physiologisches Factum, ein Naturgesetz, welches die egyptischen und assyrischen Könige, römische Kaiser und christliche Inquisitoren beschämt hat. Kein Strafgesetz, keine physische Tortur kann bewirken, dass eine höhere Rasse von einer niederen aufgesogen oder zerstört werde.«123
Dieser unerquickliche Streit sei erwähnt, weil die heutige selektive Geschichtsschreibung nur den bösen Antisemiten Treitschke kennen will, nicht aber Graetz, obwohl dieser in seinem völkischen Nationalismus ganz »ähnliche, bisweilen sogar identische Standpunkte formulierte«.124 Auch Treitschke war übrigens kein Rassist, wie etwa Stöcker, er drängte nur darauf, dass die Juden sich wirklich als »deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens«, wie es seit 1893 hieß, verstanden, nicht als Nation in der Nation.125
Weil der Zionismus, auf den ich gleich komme, stark vom Blut und Boden-Motiv geprägt war, will ich zeitlich etwas vorgreifen und hier noch auf Franz Rosenzweig hinweisen, der die Grundlage jüdischer Identität allein im Blut sah. Zugleich zögere ich, die entsprechenden Sätze von ihm zu zitieren und ihn als Rassenlehrer einzuordnen, weil sein Personalismus sehr anregend auf die christliche Theologie gewirkt hat. Aber seine Äußerungen sind ein weiterer Beleg dafür, wie lebendig der Gedanke des Bluts im Judentum war. So heißt es in Der Stern der Erlösung (1921) von den anderen Völkern, sie könnten »sich nicht genügen lassen an der Gemeinschaft des Blutes; sie treiben ihre Wurzeln in die Nacht derselben toten, doch lebensspendenden Erde und nehmen von ihrer Dauer Gewähr der eigenen Dauer. Am Boden und an seiner Herrschaft, dem Gebiet, klammert sich ihr Wille zur Ewigkeit fest (…). Wir allein vertrauten dem Blut und ließen das Land; also sparten wir den kostbaren Lebenssaft, der uns Gewähr der eigenen Ewigkeit bot, und lösten allein unter den Völkern der Erde unser Lebendiges aus jeder Gemeinschaft mit den Toten. Denn die Erde nährt, aber sie bindet auch (…) Und die Heimat, in die sich das Leben eines Weltvolkes einwohnt und einpflügt (…) – dem ewigen Volk wird sie nie in solchem Sinn eigen (…).«126
11. Der Zionismus: »typisch deutsch«
Man kann nun mit guten Gründen behaupten, dass die Integration der Juden im Wilhelminischen Reich doch in großem Umfang gelungen war. Denn gegen Ende des Jahrhunderts verlor der Antisemitismus wieder an Boden, was übrigens mit der endgültigen Überwindung der langen wirtschaftlichen Krisenzeit zusammenhängt. »Die nicht-antisemitischen Parteien haben die Antisemiten geschlagen und verdrängt und die Wähler zurückgewonnen. Diese Tatsache soll man nicht, wie gewöhnlich, verdrängen oder herunterspielen.«127 Trotz der antisemitischen Agitation blieb Deutschland bis 1914 und sogar bis 1933 die »Hochburg jüdischer Entfaltung«.128 Entsprechend groß war die Bereitschaft der Juden zur Assimilation. Es ist ja gerade das Paradoxe oder das nur »dialektisch« Verständliche, dass die Judenfeindschaft in Deutschland nach 1933 solche Ausmaße annehmen konnte! Und es straft alle linearen Ableitungen der Katastrophe aus einer besonderen deutschen Tradition oder gar Veranlagung Lügen. »Eine vergleichende Studie zu den antisemitischen Hetzkampagnen und den Einstellungen zum Judentum, die zwischen 1899 und 1939 in den Massenmedien vier europäischer Staaten zum Ausdruck kamen (Frankreich, England, Italien und Rumänien) verdeutlicht, dass die Deutschen vor 1933 das am wenigsten antisemitische Volk gewesen waren.«129
Wegen jener starken Assimilationsbereitschaft fand aber die andere Lösung des Problems der Volksreligion, die der Zionismus seit 1896 proklamierte, bei den Juden in Deutschland, jedenfalls bis 1916, nur wenig Widerhall. Denn sie wollten eben loyale Staatsbürger sein, und was Theodor Herzl anstrebte, stellte doch alles, was sie an Emanzipation erreicht hatten, ganz genauso infrage wie die Antisemiten! Diese Lösung war höchstens für die immer noch unterdrückten osteuropäischen Juden ein Gewinn. Aber auch die streng religiösen Juden lehnten den Zionismus ab. Gewiss ist diese Religion eine einzige große Sehnsucht nach Heimat. Die Liturgie des Passah-Fests endet bekanntlich mit dem Ausruf »Das kommende Jahr in Jerusalem!«, als Gebetswunsch schließt sich an: »Erbarme dich, Ewiger, unser Gott, über dein Volk Israel, über deine Stadt Jerusalem, über Zion, die Wohnung deiner Heiligkeit, über deinen Altar und über deinen Tempel. Erbaue bald und in unseren Tagen deine heilige Stadt Jerusalem, bringe uns dahin und erfreue uns durch ihre Wiederherstellung.« Aber diese Hoffnung soll der Messias erfüllen, und es war nicht nur säkular gedacht, sondern gegen Gott gerichtet, wenn man sich an seine Stelle setzen und sein Handeln vorwegnehmen wollte. Damit verlor die Verheißung auch ihre menschheitliche Pointe, und es konnte nur das Gegenteil herauskommen: ein ganz gewöhnlicher Staat im Machtgerangel dieser Welt. Vor dem Hintergrund dieser Kontroverse konnte der erste Zionistenkongress wegen des Widerstands der örtlichen israelitischen Gemeinde und des Deutschen Rabbinerverbandes 1897 nicht in München stattfinden, sondern musste nach Basel verlegt werden.130
Doch es gibt weitere, in gewisser Hinsicht sogar tiefere Einwände gegen Herzl und andere Vertreter des Zionismus. Da ist zunächst die Beobachtung, dass er selber ja nicht nur seiner Religion entfremdet war, sondern ein glühender Bewunderer Bismarcks und des neuen Deutschen Reiches war! Der Kaiser sollte ihn daher bei der Verwirklichung seines Plans gegenüber den Osmanen unterstützen. »Unter dem Protektorate dieses starken, großen, sittlichen, prachtvoll verwalteten, stramm organisierten Deutschlands zu stehen«, notierte er in seinem Tagebuch, »kann nur die heilsamsten Wirkungen für den jüdischen Volkscharakter haben (…). Durch den Zionismus wird es den Juden wieder möglich werden, dieses Deutschland zu lieben, an dem ja doch trotz alledem unser Herz hing!«131 So wurde Deutsch die Arbeitssprache der zionistischen Bewegung und Berlin ihre informelle Hauptstadt.
Bekanntlich war Bismarck aber ein Vertreter des außenpolitischen »Realismus«, und auch darin folgte ihm Herzl z.B. mit der These, dass ein nationaler Zusammenschluss überhaupt nur möglich ist gegen einen gemeinsamen Feind. Daraus folgte, dass er den Antisemitismus nicht etwa verurteilte und bekämpfte, sondern als Herausforderung begrüßte: Ohne ihn hätte das jüdische Volk schon in der Zerstreuung nicht überlebt, und jetzt brauche es ihn, um wieder ein Staatsvolk zu werden. Unsre Feinde, so meinte er, »werden unsere verlässlichsten Freunde und die antisemitischen Länder unsere Verbündeten sein«.132 In gewisser Hinsicht sollte er diesbezüglich sogar Recht bekommen, wir werden das später bei der Behandlung des Nationalsozialismus noch sehen.
Aus jener These folgte weiter, dass Herzl jene Regierungen, die die Juden am liebsten loswerden wollten, beim Wort nahm und an sie appellierte, doch sein Vorhaben zu unterstützen.133 Im Sinne des politischen Realismus war es auch, sich bei den mächtigsten Staaten anzubiedern, um Erfolg zu haben. Herzl selbst tat es bei der türkischen Regierung, spätere Zionisten bei Großbritannien und den USA. Hannah Arendt meint dazu sehr treffend, »dass, solange die Zeit des Messias noch nicht angebrochen ist, ein Bündnis zwischen einem Löwen und einem Lamm verheerende Folgen für das Lamm haben kann«.134
Herzl hat zwar den objektiven, auf die Herkunft abhebenden Begriff der Nation der deutschen und osteuropäischen Tradition übernommen, die Rassenlehre aber abgelehnt. Sand erzählt dazu die hübsche Geschichte vom Besuch des gutaussehenden Herzl bei einem jüdischen Schriftsteller in London, der für seine Hässlichkeit bekannt war. In seinem Tagebuch notiert Herzl dann: »Er steht aber auf dem Rassenstandpunkt, den ich schon nicht akzeptieren kann, wenn ich ihn und mich ansehe.«135 Wollte man damals jedoch wissenschaftlich auf dem neuesten Stand sein, so musste man mit der Rassentheorie operieren. Was andere führende Zionisten eben auch taten – womit wir erneut bei einer dieser Tatsachen sind, die heute gern ausgeblendet werden. Schon der Erfinder des Begriffs »Zionismus« Nathan Birnbaum (1864–1937) knüpfte bei Disraeli und Hess an und schrieb 1886: »Die geistigen und emotionalen Besonderheiten eines Volkes können nur durch die Naturwissenschaften erklärt werden. Ein großer Weiser unseres Volkes, Lord Beaconsfield [Benjamin Disraeli], sagte einmal, ›Die Rasse ist alles‹, in der Besonderheit der Rasse liegt die Einzigartigkeit des Volkes. In den Rasseunterschieden liegt die Quelle der vielen nationalen Varianten. Wegen des Gegensatzes zwischen den Rassen denkt und fühlt der Deutsche oder der Slawe anders als der Jude. Mit diesem Gegensatz kann man die Tatsache erklären, dass der Deutsche das Nibelungenlied schuf, der Jude hingegen – die Hebräische Bibel.«136 Auch Chamberlains Grundlagen des 19. Jahrhunderts fand seine Zustimmung, abgesehen natürlich von dessen antisemitischen Äußerungen. Vielleicht am ungeniertesten offenbarte sich der Zeitgeist bei dem damals sehr bekannten Intellektuellen Max Nordau, der in gewisser Weise zum »Chefideologen« der Zionisten wurde. Er kämpfte gegen die »Entartung« der Zivilisation (so der Titel seines viel gelesenen Buchs von 1892), die er in der modernen Kunst, der Homosexualität und den psychischen Krankheiten am Werke sah. Und er entdeckte im Zionismus die Chance einer Erneuerung der jüdischen Rasse, dieses uralten Blutes: Die Rückkehr in die alte Heimat, zur Muttererde, verbunden mit der Notwendigkeit, wieder Landwirtschaft zu betreiben und sich körperlich zu ertüchtigen, werde erst die Gesundheit des Volkes wiederherstellen. An der Gesundheit lag ihm so viel, dass er endlich wieder »Muskeljuden« sehen wollte, was in der Tat zur Gründung zionistischer Sportvereine führte. Vor seiner Rede auf dem Zweiten Zionistenkongress ließ er Musik aus Wagners Tannhäuser spielen.137 Zur Orientierung am Deutschen Reich kam also hier die konservative Zivilisationskritik hinzu, die am Ende des Jahrhunderts blühte. Sie enthält zwar ein Stück Wahrheit, wie wir heute, ökologisch belehrt, anerkennen müssen, war aber auch verlogen. Wenn diese zweideutige Romantik, diese Rückwendung zu vormodernen Zeiten nun den Deutschen gern vorgeworfen wird, warum dann nicht den frühen Zionisten? War die Rückkehr ins »Heilige Land« nach fast zweitausend Jahren und die anvisierte Wiedergründung des alten Staates Israel nicht eine viel weitergehende, überschwänglichere Romantik? Verlogen war diese Haltung auch insofern, als sie die Moderne zunächst in Gestalt des deutschen, später des britischen und amerikanischen Imperialismus voraussetzte. Für die Imperialisten aber war die Rückkehr des erwählten Volkes nur der Beweis dafür, dass man auch mit der Geschichte beliebig schalten und walten konnte und sie zum bloßen Material geworden war.
Weitere zionistische Vertreter des Blut und Boden-Mythos werden in Sands Buch aufgeführt und kommentiert, so dass ich darauf verweisen kann.138 Es sind so bekannte Persönlichkeiten wie der junge Martin Buber, Wladimir Jabotinsky, der Vater der »revisionistischen« Zionisten oder auch der Organisator der jüdischen Siedlungsbewegung in Palästina, Arthur Ruppin (1876–1943). Letzterer war seit den 1920er Jahren Dozent für die »Soziologie der Juden« an der Hebräischen Universität in Jerusalem, pflegte internationale Kontakte mit Eugenikern und besuchte noch nach Hitlers Machtergreifung den führenden Rassetheoretiker der Nationalsozialisten Hans F. K. Günther in Deutschland, um über die »jüdische Frage« zu diskutieren.139
12. Der Frontenwechsel des Judentums im Ersten Weltkrieg
Paradoxerweise war der Beginn des Ersten Weltkriegs wohl der Höhepunkt dessen, was man die deutsch-jüdische Symbiose genannt hat. Die meisten Juden sahen in Deutschland durchaus ihr Vaterland, sie folgten keineswegs widerwillig der Kriegspflicht, viele waren sogar vom Gefühl nationaler Solidarität ergriffen. Jüdische Intellektuelle teilten auch die »Ideen von 1914« mit ihrer Abgrenzung von der westlichen Zivilisation, ich erinnere an Max Scheler, Georg Simmel, Hermann Cohen. In unserem Zusammenhang ist am wichtigsten Cohens Schrift Deutschtum und Judentum aus dem Jahr 1915. Für ihn, den Neukantianer, war der deutsche Idealismus ohne Zweifel der Gipfel der abendländischen Philosophie. Er stehe mit seiner menschheitlichen Orientierung in Parallele zum jüdischen Monotheismus und Messianismus. Daher sei Deutschland für den Juden heute »das Mutterland seiner Seele«! Es habe die Aufgabe, der »Erziehungsgeist der Völker« zu sein. Diese Aufgabe müsse Deutschland nach dem Verteidigungskrieg, den es jetzt zu führen habe, wieder wahrnehmen. Der Krieg aber müsse die Vorbereitung des »ewigen Friedens« im Sinne Kants sein, d.h. eines Völkerbundes mit Deutschland als Mittelpunkt.140 Die Hoffnung der jüdischen Bürger auf entsprechende Fortschritte in der Gleichstellung schienen sich auch zu erfüllen. Juden konnten z.B. jetzt Offiziere werden oder führende Positionen in der staatlichen Lenkung der Wirtschaft einnehmen (erinnert sei an Walther Rathenau). Es wurde eigens eine jüdische Abteilung im Auswärtigen Amt geschaffen, in der z.B. Nahum Goldmann, der spätere Präsident des Jüdischen Weltkongresses, beschäftigt war.
Man kommt nicht umhin, zu dieser hochinteressanten Persönlichkeit wenigstens ein paar Sätze zu sagen. Goldmann war zwar im Unterschied zu Cohen ein überzeugter Zionist, aber zugleich deutscher Patriot. So betont er in seiner Schrift Von der weltkulturellen Bedeutung und der Aufgabe des Judentums (1916), dass die künftige Weltkultur »in ihrem tiefsten Wesen deutsch sein wird«, und sieht darin keinen Widerspruch. Denn Juden und Deutsche gehören schon aufgrund ihres unglücklichen historischen Schicksals zusammen, sind »die trotzigsten, steifnackigsten, zähesten und widerspruchsvollsten Völker der Geschichte«. Zweitens haben sie sich wechselseitig stärker befruchtet als andere Völker: »Kein europäisches Volk ist im letzten Jahrhundert von Juden und vom jüdischen Geiste stärkerbeeinflusst worden als das deutsche« wie umgekehrt »keine Kultur auf das moderne Judentum so stark und entscheidend eingewirkt hat wie die deutsche«.141 Und drittens verbinde sie eine gemeinsame »Auserwähltheit«, und zwar zu der Mission, der Menschheit den »sozialen Gedanken« zu vermitteln. Ich erwähne noch zwei weitere Feststellungen, die Goldmann trifft, und werde später auf sie zurückkommen. Wenn er von der weltkulturellen Aufgabe der Juden und Deutschen spricht, so meint er deren »sittlich-demokratisch-soziale Ausrichtung« im Gegensatz zum »künstlerisch-aristokratisch-individualistischen Lebensideal des Griechentums«.142 Die griechische Philosophie sei überhaupt für die Gegenwart viel weniger bedeutsam als die Bibel. Das schließt nicht nur eine Absage an Nietzsche mit ein, sondern zeigt auch den Widerspruch zur deutschen Orientierung am Griechentum bzw. an der klassischen Antike. Dabei war Goldmann ein großer Kenner und Verehrer Goethes. Andererseits grenzt er sich als Zionist aber auch vom Assimilationsjudentum ab, dessen Wurzeln im Kosmopolitismus der westlichen Aufklärung lägen, während das national denkende Judentum im deutschen Idealismus gründe, der gegen die nivellierende Tendenz des westlichen Kosmopolitismus die Menschheit in nationaler Vielfalt gedacht habe. So seien Fichte und Hegel die philosophischen Lehrmeister des Zionismus!143
Die Zionisten gründeten schon im August 1914 ein Komitee für den Osten, weil sie davon ausgingen, dass ein Sieg über das Zarenreich endlich die Befreiung der osteuropäischen Juden ermöglichen würde. »Es war die Absicht, die Kenntnisse und Beziehungen der Begründer zu den Ostjuden und den Juden in Amerika der deutschen Regierung zur Verfügung zu stellen, so zur Niederringung des zaristischen Russland beizutragen und den Juden im Osten die Bürgerrechte und die nationale Autonomie sicherzustellen. Zur Aufklärung der Bevölkerung im besetzten Gebiete wurde die Zeitschrift Kol Mevasser (Die Stimme des Verkünders) herausgegeben. Ein Vertreter des Comité wurde nach Amerika entsandt, wo er bis zum Ausbruch des deutschamerikanischen Krieges gewirkt hat.«144 Das Komitee arbeitete also eng mit den deutschen Behörden zusammen und sorgte z.B. für die Verbreitung deutscher Propaganda in den besetzten Gebieten. Von den Russen wurden die Juden daher als fünfte Kolonne der Deutschen betrachtet und behandelt. Umgekehrt beseitigte die deutsche Besatzungsmacht tatsächlich die diskriminierenden Gesetze des Zarenreichs und setzte sich auch gegenüber dem Osmanischen Reich für das zionistische Anliegen ein.
Es waren hauptsächlich zwei Ereignisse, die das gute Verhältnis zwischen Juden und Deutschen schließlich zerstören sollten: die sogenannte »Judenzählung« in Deutschland (1916) und die Balfour-Deklaration der Alliierten (1917). Da es sich einerseits um ein innerpolitisches, andererseits ein außenpolitisches Ereignis handelt, ist schwer zu entscheiden, was letztlich den Ausschlag gab.
Das Jahr 1916 war ein schlechtes Kriegsjahr für die Mittelmächte. Vor Verdun waren sie mit ungeheuren Opfern gescheitert, die britische Offensive an der Somme hatte zu weiteren schweren Verlusten geführt und eine russische Großoffensive hätte beinahe den Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Heeres gebracht. Die Kampfmoral und Disziplin der Soldaten sank, weil das Ausharren im Stellungskrieg zunehmend als sinnlos empfunden wurde. So kam statt des »Helden« der »Drückeberger« in den Blick, und hier setzte die antisemitische Hetze ein, die besonders die Juden der Drückebergerei verdächtigte. Daraufhin wurde im November 1916 eine statistische Erhebung über deren Beteiligung am Militärdienst angeordnet. Die Ergebnisse bestätigten den Verdacht keineswegs145 und wurden auch nicht veröffentlicht, aber der Vorgang der »Judenzählung« als solcher hat gerade die integrationsbereiten Juden, wie könnte es anders sein, zutiefst beleidigt.
In der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 versprach der britische Außenminister bekanntlich den Juden eine »Heimstatt« in Palästina. Die militärische Ausgangslage war aber in gewisser Hinsicht umgekehrt, denn jetzt befanden sich die Alliierten im Nachteil. Im Osten zeichnete sich ab, dass die Russen nach der letzten gescheiterten Offensive den Krieg nicht mehr weiterführen konnten und wollten. Im Fall eines Waffenstillstands, der im Dezember 1917 dann auch von der neuen russischen Revolutionsregierung abgeschlossen wurde, würden aber deutsche Armeen für die Westfront frei werden! Und da die Amerikaner zwar in den Krieg eingetreten, aber noch nicht präsent waren, konnte das die endgültige Niederlage der Alliierten bedeuten. Abgesehen von strategischen Überlegungen in Bezug auf den Suezkanal ging es angesichts dieser dramatischen Situation jetzt darum, die Juden in aller Welt für die eigene Sache zu gewinnen. Da viele mittel- und osteuropäische Juden bisher den Mittelmächten zugeneigt waren, war man von der Bedeutung des deklarierten Angebots überzeugt. »Ich glaube«, so der britische Diplomat Robert Cecil, »dass man die internationale Macht der Juden schwerlich übertreiben kann.«146 Seit dem Frühjahr 1918 nahm die jüdische Presse dann in der Tat nicht mehr Partei für Deutschland, sondern für die Alliierten.147 Dieser »Frontenwechsel« war offenbar so weitgehend gelungen, dass die Antisemiten in Deutschland die Umorientierung der Juden auch nach dem Krieg als Bestätigung ihrer Ansichten verstehen konnten (»Die Juden haben uns verraten«). Dieses Umschwenken war aber nichts anderes als die schon von Herzl betriebene Realpolitik. Um als Schwächerer Erfolg zu haben, musste man herausfinden, wer der Stärkste war und dessen Unterstützung gewinnen. Das Verhältnis von Stärke und Schwäche war zwar im Frühjahr 1918 noch nicht leicht zu bestimmen und insofern war der jüdische Wechsel zu den Alliierten kluge Voraussicht. Er wurde aber zweifellos »erleichtert« durch eben jene unsinnige »Judenzählung«. Auch die Juden konnten jedenfalls behaupten, Recht zu haben mit ihrer Entscheidung, obwohl sie eigentlich machtpolitisch motiviert war. Bedenkt man schließlich, dass die Engländer ihr Versprechen gar nicht gehalten haben, so zeigt sich, dass »Realpolitik« vielleicht doch nicht so klug ist, wie sie erscheint. Den letzten Anstoß zur jüdischen Umorientierung gab dann wohl die deutsche Niederlage, denn sie setzte der so enthusiastisch gepriesenen deutschen Menschheitsmission ein Ende. Auf der ideellen Ebene kann man das etwa an dem schon erwähnten Franz Rosenzweig beobachten, der ein Schüler Hermann Cohens war, sich aber 1918 deutlich von den Ansichten seines Lehrers abwandte. Cohens Ansatz von 1915, nach überstandenem Krieg müsse Deutschland mit seiner Philosophie und Kultur der »Erziehungsgeist der Völker« sein, fehlte mit dem Ausgang des Krieges jede Substanz. Umgekehrt fand Rosenzweig jetzt, dass die Assimilation die Juden in beschämender Weise ihrer eigenen Tradition entfremdet habe und das Ziel einer spezifisch jüdischen Erziehung darin bestehen müsse, gerade das Trennende, Besondere gegenüber der deutschen Kultur hervorzuheben.148 Das Eigenartige ist allerdings, dass diese Abgrenzung auf jüdischer Seite nun wieder in Kategorien erfolgt, die damals auch im Denken der Deutschen zu dominieren beginnen: Volk, Blut, Rasse. Die Frage an unsere Fachhistoriker lautet daher: Besteht denn nicht eine Parallele bzw. Wechselwirkung zwischen dieser Rückbesinnung der Juden auf ihre Tradition, dieser »jüdischen Renaissance« und dem erstarkenden Antisemitismus in Deutschland?