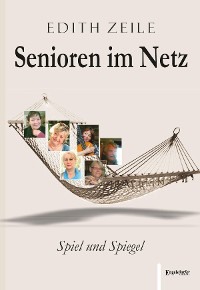Kitabı oku: «Senioren im Netz: Spiel und Spiegel», sayfa 3
Paulo Coelho – per aspera ad astra
Mehr als ein Dutzend Bücher des brasilianischen Autors Paulo Coelho hat inzwischen auf der ganzen Welt begeisterte Leser gefunden. In dürren Zahlen ausgedrückt. 200 Millionen Exemplare sind verkauft und in 66 Sprachen übersetzt worden. Damit hat der Autor, der schon als Dreizehnjähriger Schriftsteller werden wollte, den „einzigen Traum seines Lebens“ verwirklicht.
Wer Coelhos Werke liest, hält ihn wenn nicht gar für einen spirituellen Meister, so doch für einen fortgeschrittenen Sucher. Gerade dieser Aspekt, die ernsthafte Sinnsuche, hat ihn so überaus populär gemacht, obwohl viele seiner esoterischen Einsichten von Kirche und Wissenschaft vehement attackiert werden.
Wenn er vor der Niederschrift eines neuen Werks das uralte I Ging, das chinesische Buch der Wandlungen, befragt, um die Gunst des Augenblicks auszuloten, wenn er sich auf Geheiß seines Meisters J. 40 Tage in die südkalifornische Mojawe-Wüste auf die Suche nach seinem Schutzengel begibt und tatsächlich eine Botschaft von ihm erhält, so wird er doch von einigen verstanden. Sein Handbuch des Kriegers des Lichts kann als Wegweiser verstanden werden, da es hinter den Mauern eines krassen Materialismus das wahre Selbst zu entdecken gilt.
Wie Santiago, der andalusische Hirte in einem der schönsten Werke Coelhos – Der Alchimist – eine lange Reise antritt, um einen Schatz im fernen Ägypten zu finden, so macht sich der Leser auf einen langen, mühseligen Weg. Und der indische Avatar, Sathya Sai Baba, stellt in Übereinstimmung mit dem Autor fest: „Wenn der Weg zu Ende und das Ziel erreicht ist, erkennt der Pilger, dass er von sich selbst zum SELBST gewandert ist.“
Diese Schatzsuche, die den Schatz im Inneren entdecken will, ist das Lebensthema des Menschen und Schriftstellers Paulo Coelho.
Aus dem Werk Aleph erfährt der Leser, welche Stufe des Bewusstseins der Schriftsteller bereits erreicht hat. Willigis Jäger, Benediktiner und Zen-Meister greift in seinem Buch Wiederkehr der Mystik auf ein Modell von Ken Wilber zurück und stellt fest, dass die vorletzte Stufe – vor dem Ziel der Erleuchtung –, eine punktuelle Einheitserfahrung ist.
Coelho beschreibt diese Erfahrung an mehreren Stellen in seinem Werk Aleph, und es ist anzunehmen, dass er sie aus eigener Erfahrung kennt. Dabei erfährt das Bewusstsein des Suchers eine grandiose Ausweitung, die allerdings nicht lange bestehen bleibt.
***
Wer nun etwas mehr über den Autor erfahren möchte, der wie ein echter Zauberer die inneren Pforten der Seele zu öffnen vermag, kann zu der ersten und bislang einzigen Biographie von Fernando Morais greifen. Dieser hatte Zugang zu Coelhos 200 Tagebüchern und 100 Tonbändern, denen der Autor seine innersten Regungen anvertraute. Auf dieser Grundlage entstand die erste, vom Autor bestätigte 700seitige Biographie, die den Titel Der Magier trägt.
Wenn der 13-jährige Paulo von seinem Weltruhm als Schriftsteller träumt und dabei nur schwache Leistungen auf der Schule vorweisen kann, stößt er in seiner Umgebung auf Unverständnis und Kritik. Damit er wenigstens eine gute religiöse Grundlage bekommt, schicken ihn die Eltern auf eine Jesuitenschule. Damit erreichen sie jedoch das ganze Gegenteil. Paulo leidet unter nervösen Störungen, Asthmaanfällen, Tobsuchts- und Panikattacken, Selbstzweifeln, wird dreimal in die Psychiatrie eingewiesen, bekommt Elektroschocks und reißt dreimal aus. Man bescheinigt ihm, manisch-depressiv zu sein. Er probiert Drogen, hat zahllose Kontakte mit Prostituierten, führt die zweite Ehe zu viert, wird von der Militärjunta verhaftet und gefoltert. Seine Suche nach Selbsterkenntnis führt ihn von der Hare-Krishna-Bewegung bis zur Schwarzen Magie und endet mit dramatischen Exzessen. Aleister Crowley, der berüchtigte englische Magier, über den auch Somerset Maugham den Roman The Magician schrieb, fasziniert ihn. Er begegnet Dämonen aus der Vergangenheit und schließt einen Pakt mit dem Teufel.
Mit 38 Jahren bricht er total mit dieser Vergangenheit und begibt sich auf Geheiß seines Meisters J. als Pilger auf den Jakobsweg. Diese Erfahrung schildert er in seinem ersten Buch so überzeugend, dass die Zahl der Pilger in der folgenden Zeit dramatisch zunimmt. Statt 400 Pilger im Jahr gehen nun 4.000 täglich diesen Weg, stellt er später humorvoll fest.
Paulo Coelho ist, was sein Leben und Werk angeht, der beste Beweis dafür, was er seinen Lesern auf ihren eigenen Weg zur Entdeckung des wahren Selbst mitgibt.
Da er immer aus eigener Erfahrung spricht, wirkt er authentisch, Man kann ihm als Lehrer vertrauen und seine Ratschläge annehmen:
„Nur wer die Suche nicht aufgibt, kann gewinnen.“ (Brida, S. 38).
„Man kann den Menschen nur nahe sein, wenn man einer von ihnen ist.“ (Brida, S. 238)
„Und wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das gesamte Universum dazu beitragen, dass du es erreichst.“ (Der Alchemist, S. 29)
„Denn in dem Augenblick, wo wir uns auf die Suche nach Liebe machen, macht sie sich auf, uns zu finden – und uns zu retten.“ (Am Ufer des Rio Piedra saß ich und weinte, S. 93)
„In uns allen liegen unbekannte Kräfte verborgen, die, wenn sie an die Oberfläche kommen, Wunder wirken können.“ (Die Hexe von Portobello, S. 78)
Die Frau mit den drei Genies: Lou Andreas-Salomé
Wäre sie von drei Männern geliebt worden, würde sich heute wohl kaum jemand an sie erinnern.
Wäre ein Genie unter den drei Männern gewesen, wäre ihr Name sicher auch heute noch bekannt.
So ist z.B. Christiane Vulpius, die Goethe schließlich ehelichte, obwohl dies damals einem gesellschaftlichen Affront gleichkam, heute nach 200 Jahren noch vielen bekannt.
Aber drei Genies!
Das kann keine irdische Frau, das muss eine Göttin gewesen sein!
Die Rede ist von Lou Andreas-Salomé.
***
Betrachtet man das Foto, das auf der Frontseite der rororo-Monographie von Linde Salber (2001) zu sehen ist, so blickt man in das Gesicht einer jungen bildschönen Frau. Ein ovales ebenmäßiges Gesicht, dessen Liebreiz den Betrachter sofort gefangen nimmt, dunkle Augen und ein ausdrucksvoller Mund, eingerahmt von dunkelblondem Haar.
Man spürt, sie ist sich ihrer Schönheit bewusst, und doch wirkt die emotionale Offenheit ein wenig kindlich.
Wer sich mit Rainer Maria Rilke beschäftigt hat, kommt an Lou Andreas-Salomé nicht vorbei. Sie, 15 Jahre älter als er und längst verheiratet, reist mit dem jungen Dichter zweimal nach Russland. Obwohl es dort zu einer Trennung kommt, bleibt sie bis zu seinem Tod seine Seelengefährtin. Ihr Einfluss auf sein künstlerisches Werk kann nicht hoch genug angesetzt werden. Das Stundenbuch ist das Geschenk dieser Reisen. Wer ist sie also, die schon vor der Begegnung mit Rilke einem anderen Genie einen Korb gab, mehrere Heiratsanträge zurückwies, einige zu ‘Brüdern’ machte, schließlich selber heiratete, mit dem jungen Geliebten Reisen unternahm, bevor sie Schülerin eines dritten Genies wurde: Sigmund Freud.
Für alle war sie eine Herausforderung: Ihr klarer Intellekt, ihre mitreißende Phantasie, ihre Unkonventionalität faszinierten sie. Sie bewunderten ihre Autarkie, die vielen Rollen, die sie zu spielen wagte, als Kind, als Schwester älterer Brüder, als Ehefrau, als Geliebte, als Nicht-Mutter, als Künstlerin, als Narziss.
***
Louise von Salomé wird am 12. Februar 1861 in St. Petersburg geboren, im liberalen unkonventionellen Zeichen Wassermann. Die Familie stammte ursprünglich von Hugenotten ab, die im 16. Jahrhundert aus Frankreich vertrieben, lange im Baltikum lebte und 1810 schließlich nach St. Petersburg zog.
Als bindend erwies sich der Protestantismus.
Louise wird nach fünf Brüdern als letztes Kind lebhaft begrüßt. Sie entwickelt vor allem zu ihrem 57 Jahre alten Vater eine starke zärtliche Zuneigung.
Ihren Schulbesuch tut sie ab als „Ort, wo sie nichts lernte“.
Sie weigert sich, konfirmiert zu werden. Stattdessen nimmt sie Privatunterricht bei dem liberalen Geistlichen Hendrick Gillot, der die Religion als geschichtliches Phänomen ansieht. Gillot führt die 18-jährige in die Philosophie ein, liest mit ihr Spinoza, Leibniz, Kant und Kierkegaard.
Dabei verliebt sich der 42-jährige Familienvater in sie und macht ihr einen Heiratsantrag, worauf sie sich von ihm trennt.
1880 verlässt Lou mit ihrer Mutter Russland, um ein Studium in Zürich aufzunehmen. Theologie, Philosophie und Kunstgeschichte scheinen ihr die Disziplinen zu sein, die ihr eigenes Denken befruchten könnten.
Aber schon nach einem halben Jahr verlassen beide die Schweiz, da Lou erkrankt ist, und reisen in das klimatisch günstigere Italien, nach Rom.
Dort begegnet sie dem Philosophen Paul Ree, der schließlich einen Kontakt mit Nietzsche herbeiführt, weil er immer das Gefühl hatte, er müsse Lou „unsterblich machen“.
So lernt die 21-jährige den 37-jährigen Philosophen kennen, der zu dieser Zeit eher als „verschrobener Grübler“ gilt.
Beide machen ihr Heiratsanträge, die sie abweist. Es existiert ein vielsagendes Foto aus der Zeit, das die junge Frau, eine Peitsche schwingend, auf einem Leiterwagen zeigt, während die beiden Philosophen wie Pferde vor den Wagen gespannt sind.
Nietzsche charakterisiert sie so: „… scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe und zuletzt doch wie ein sehr mädchenhaftes Kind …“ Er bezeichnet sie als „Ideal auf Erden“. Als sie ihn verlässt, tadelt er ihr „Bedürfnis nach Expansion … ihre Unfähigkeit zur Liebe.“
***
Es folgen fünf gemeinsame Jahre mit Ree in Berlin, in dem sie eine Art Bruder sieht. In dieser Zeit entsteht ihr erster Roman Im Kampf um Gott, dem in der folgenden Zeit unzählige weitere Werke folgen.
1886, 25-jährig, lernt sie den Orientalisten Dr. Friedrich Carl Andreas kennen, Sohn einer deutschen Mutter und eines armenischen Vaters. Wieder – wie bei Gillot – versteht sie ihre Liebe als die der Tochter zum Vater. „Formen der Erwachsenensexualität klammert sie von Anfang an aus.“
In Henrik Ibsen entdeckt sie den Schriftsteller, der ihr Hauptproblem, wie sich in einer Ehe Spielraum für eine ‘Selbstrealisierung’ finden lasse, in seinen Werken behandelt.
Bald schreibt sie selber ein Buch über Ibsen, ein wenig später über Nietzsche, und sie findet nun zunehmend im Schreiben ihre Erfüllung.
Als ihr 1892 ein Politiker seine Liebe gesteht und sie aus ihrer Ehe „befreien“ möchte, entscheidet sie sich doch dagegen. Während der zweijährigen Ehekrise kommt allerdings sogar der Gedanke an einen gemeinsamen Selbstmord auf.
Als Hauptproblem des weiblichen Lebens erkennt sie, dass Ehe immer eine Einschränkung bedeutet, während sie mehrere Rollen spielen möchte.
1897 reist sie nach einem längeren Aufenthalt in Wien und interessanten Kontakten zu berühmten Künstlern wie Hugo von Hofmannsthal nach München, einer weiteren Kunstmetropole Europas. Dort lernt sie den 21-jährigen Rilke kennen, der ihr zunächst anonyme Briefe voller Verehrung schreibt. Diese schwärmerische Sehnsucht des jungen Dichters erinnert sie an einen rigoros verlassenen Punkt ihrer eigenen Entwicklung. Sie sieht eine Möglichkeit, etwas nachzuholen, was ihr verloren gegangen ist. Drei Jahre lang hält diese sehr intensive Liebesbeziehung an, sie machen zwei Reisen nach Russland, besuchen Tolstoj, Lou fühlt sich wohl in ihrer Heimat und kündigt dort vor dem Besuch ihrer Eltern die Trennung an.
Rilke flieht, heiratet schnell danach die Worpsweder Malerin Clara Westhoff, wird Vater und geht schon nach einem Jahr nach Paris, um bei dem berühmten Bildhauer Auguste Rodin zu arbeiten.
Lou bleibt aber bis zu seinem Tod seine Seelengefährtin.
***
Auch an Lou geht die Trennung nicht folgenlos vorüber. Von nun an wird sie immer wieder krank werden. Der behandelnde Arzt Pineles wird nun ihr Liebhaber, Lou wird schwanger, verliert aber das Kind durch einen Sturz von der Leiter beim Äpfelpflücken im Garten ihres Freundes.
Die Aufspaltung des Lebens in einen bürgerlichen Teil, Ehemann und hausfrauliche Pflichten im Haus in Göttingen und einen unkonventionellen Teil mit Liebhabern, Reisen und Arbeit als Schriftstellerin kommt ihrer Sehnsucht nach Vielseitigkeit entgegen. Aber das Verhältnis ihres Ehemanns mit seiner Haushälterin und die Geburt einer Tochter sind sicher auch eine Belastung für sie.
Um Rilke, der ebenfalls ständig unter merkwürdigen Seelenzuständen leidet, zu helfen, wendet sie sich ab 1906 der Psychologie zu.
Aber erst 1912/13 nimmt sie an den Mittwochabendseminaren von Sigmund Freud teil, der sich durch die Teilnahme einer damals schon berühmten Schriftstellerin sehr geehrt fühlt. Besonderes Interesse hat sie an Freuds Narzissmus-Aufsatz, in dem sie offenbar Phänomene ihrer eigenen Lebensgeschichte beschrieben sieht.
Ab 1915 führt sie in Göttingen selbständig Analysen durch. Dabei arbeitet sie oft bis zu 10 Stunden täglich, so dass Freud von einem „schlecht verhüllten Selbstmordversuch“ spricht.
1919 sieht sie Rilke zum letzten Mal. Sie kann nun eingestehen, wie sehr sie ihn braucht. „Du schenkst mir ein Stück Leben und ich brauche es noch inbrünstiger als Du weißt ...“
1937 stirbt sie an einem Krebsleiden. Eine Frau, die die weibliche Rolle ausweiten wollte, die sich ein Leben jenseits aller Konventionalität zutraute, dabei das Wesen der Liebe verstehen wollte und am Ende doch vielleicht daran zerbrach.
Eine Beschränkung wollte sie sich nicht auferlegen – deshalb musste das Schicksal eingreifen, schenkte ihr die Liebe und Verehrung von drei Genies, nahm ihr aber den Mann, das eigene Kind und die Gesundheit.
In den Liebesgedichten Rainer Maria Rilkes lebt sie weiter:
„Wie soll ich meine Seele halten, dass
Sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
Hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
An einer fremden stillen Stelle, die
Nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
Nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
Der aus zwei Saiten e i n e Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.“
Zit. nach Linde Salber, Lou Andreas-Salomé, (rororo, 2001)
Die Frau, die Nein sagt: Francoise Gilot
Ein Genie als Liebhaber? Ein Genie als Mann? Traum oder Alptraum aller Frauen?
Ich erinnere mich, wie fasziniert ich war, als ich als junge Anglistik-Studentin Aldous Huxleys Buch The Genius and the Goddess las.
Wie sehr ich mit der jungen Rose Beurre mit-litt, als das Genie Auguste Rodin sich nicht nur in jedes seiner Modelle verliebte, sondern auch der jungen bildschönen Bildhauerin Camille Claudel verfiel, sich dennoch nicht von seiner ‘Haushälterin’ Rose trennen konnte und Camille schließlich den Rest ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt verbringen musste.
Welche Rolle wird Frauen an der Seite eines Genies zugemutet?
Und was ist eigentlich ein Genie? Ist es jemand, der alle anderen überragt, im Guten wie im Bösen?
Eine Frau, die Nein sagt ist der Titel eines aufregend interessanten Buches von Malte Herwig (2015), das eine der vielen Frauen in Picassos Leben in den Mittelpunkt stellt. Picasso selber hat Francoise Gilot so genannt.
Andere Frauen haben JA gesagt und mit ihrem Leben bezahlt: Jacqueline Roque erschoss sich 13 Jahre nach Picassos Tod. Marie-Thérèse Walter erhängte sich. Olga Chochlowa und Dora Maar wurden irgendwann wahnsinnig.
Picasso, einer der berühmtesten Maler der Moderne, hinterließ eine beispiellose „Schneise der Verwüstung“. (S. 39)
Nur eine wagte es, nach einer zehnjährigen Ehe und zwei Kindern, diesen egomanischen Künstler zu verlassen: Francoise Gilot. Sie war die einzige Frau, die das Genie verließ, statt von ihm verstoßen zu werden.
***
Francoise wurde am 26. November 1921 in Paris in eine sehr begüterte Familie geboren. Ihr Vater hatte eigentlich einen Jungen gewollt, und sie hatte nichts dagegen, ein wenig härter erzogen zu werden. Sie erinnert sich – noch als 90jährige – an einen Besuch im Zoo, als der Vater sie einfach in einen Affenkäfig sperrte, der alte Affe ihr seine Pranke hinstreckte und die gaffenden Besucher draußen vor den Stäben schallend lachten.
Später schildert sie, wie der Blick durch die Stäbe des Käfigs hindurch sie verändert habe.
Fortan habe sie immer die „Welt hinter den Stäben“ sehen wollen, das, was sich hinter den Dingen verbarg. Das war der Grund, warum sie Malerin, Schriftstellerin und Philosophin wurde.
Ihre Mutter wurde ihre erste Lehrerin, die das Mal-Talent ihrer kleinen Tochter früh erkannte. Von ihr bekam sie den Rat, ihre Fehler nie wegzuwischen, sondern aus ihnen zu lernen.
Dies wird später zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Lebensphilosophie.
Mit 22 Jahren begegnete sie rein zufällig in einem kleinen Restaurant in Paris dem Maler, der fortan ihr Leben bestimmen, der sie vereinnahmen und dauerhaft an sich binden wollte.
Zunächst leben sie lange getrennt.
Auf einem weltbekannten Foto sieht man die 27jährige, eine strahlende, elfenhaft grazile Schönheit am Strand der Cote d’Azur, während Picasso ihr mit einem Sonnenschirm Schatten spendet. Er – Sonne und Schatten in einer Person.
Als sie schließlich, seinem unwiderstehlichen Charme verfallen, zu ihm zieht, versucht er, sie durch Kinder für immer an sich zu binden. Gleichzeitig demütigt er sie, nach der Geburt ihres zweiten Kindes, geschwächt und schmal geworden, indem er sagt, aus einer Venus sei ein Besenstiel geworden.
Als sie ihn lange danach darauf hinweist, dass sie ihn nicht mehr liebe und ihn verlassen werde, fertigt er die Skulptur einer schwangeren Frau an und hackt ihr die Füße ab.
Ein Voodoo-Zauber, der seine Wirkung aber verfehlte, denn Francoise verlässt mit ihren zwei Kindern Ende 1953 mit 32 Jahren Picasso, das Genie, das „Ungeheuer“.
In der Einsamkeit des Weihnachtsfestes malt er sie noch einmal zum letzten Mal: Sie liegt auf dem gemeinsamen Bett, und durch die Türöffnung fällt der lange Schatten eines Mannes auf ihren nackten Körper. Er hatte sie verloren, aber sie sollte ihm nicht entkommen, dachte er.
***
Zwei Jahre nach ihrem Weggang heiratete Francoise den Maler Luc Simon und bekam noch eine Tochter. Aber nach ein paar Jahren trennte sich das Paar.
Sehr viel länger hielt die Ehe mit dem Mediziner und Immunbiologen Jonas Salk, der mit seinem Impfstoff gegen Kinderlähmung vielen Menschen das Leben gerettet hatte.
Diese Ehe auf einer durch und durch freundschaftlichen Basis hielt immerhin 25 Jahre. Als Herwig Francoise Gilot fragte, wie sie das denn geschafft habe, sagte sie: „Wir haben einander völlige Freiheit gelassen. Er ging allein zu seinen wissenschaftlichen Veranstaltungen, und ich hatte auch meine eigenen Dinge zu tun. Also verbrachten wir einen Teil unserer Zeit zusammen und den anderen Teil getrennt.“
***
Vielleicht kämen wir in Versuchung, über das abenteuerliche Leben dieser Frau den Stab zu brechen. Dann hätten wir sie und ihr Anliegen missverstanden. Sie gehörte sehr früh zu jenen Frauen, die sich selber ganz und gar treu bleiben, die sehr früh ihre Gaben erkennen und sie nicht auf dem Altar einer falsch verstandenen Weiblichkeit opfern wollen.
Zwar hat sie Ehe und Mutterschaft, Picasso zuliebe, auf sich genommen, aber nie hat sie ihr letztes Ziel, die Wahrheit zu erkennen, aufs Spiel gesetzt oder gar aus den Augen verloren.
Tatsächlich ist die Philosophie, die sie schon während des Zweiten Weltkriegs studiert hatte, ihre lebenslange Leidenschaft gewesen.
Dabei stützt sie sich nicht auf irgendeine bestimmte Lehre, sondern entwickelt ihre eigene Lebensphilosophie, die auf ihren Lebens erfahrungen beruht. Immer wieder betont sie, dass ihr alles „geschehen“ sei, dass sie sich nie darum bemüht habe.
Man spürt, dass sie nicht nur als Touristin in Indien war, sondern dass sie sich auch mit der uralten Weisheitslehre auseinandergesetzt hat. „Ich habe jahrzehntelang mit Hilfe indischer Philosophie trainiert, alle meine subjektiven Eigenschaften zu verlieren.“ (S. 148). Sie unterschied nämlich die Persönlichkeit vom Selbst und wusste, dass die Persönlichkeit sich als Malerin und Schriftstellerin betätigte, aber dass dies nur zur Entwicklung des Selbst führte.
„Alles ist Teil des großen kosmischen Tanzes, dessen einzige Konstante der Wandel ist.“ (S. 43)
„In der Mitte liegt nur das Mittelmäßige.“ (S. 45)
„Ein ‚erfülltes Leben’ bekommt man nicht geschenkt. Man muss zum Brunnen gehen, auch wenn mal der Krug bricht.“
„Wir müssen mit unseren Möglichkeiten ebenso arbeiten wie mit unseren Fehlern.“ (S. 89)
„Fehler zu machen, ist kein Verhängnis. Aber man darf sie nicht verleugnen. Alles hat seinen Platz im Leben.“ (S. 95)
Der Einband des Buches, das auch viele Fotos und Zeichnungen enthält, zeigt die 90-jährige Malerin lächelnd, in einem roten Kleid, selbst-bewusst und doch nicht aufdringlich. Man spürt die innere Stärke, gepaart mit Zartheit. Malte Herwig nennt sie eine „Philosophin des Glücks“, die auch die schwärzesten Erfahrungen unbeschadet hinter sich lassen konnte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.