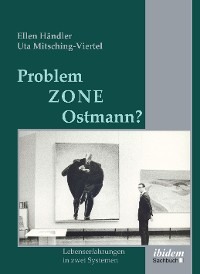Kitabı oku: «Problemzone Ostmann?», sayfa 2
Gerd, Jahrgang 1950 | 3 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Abitur mit Beruf Maurer, Oberbauleiter West: Baudezernent, Oberbürgermeister
»Meine Kugel ist tausendmal schneller
als ihr rennen könnt.«
Eines meiner frühesten Kindheitserlebnisse ist der 17. Juni 1953. Mein Großvater wurde in unserem Haus verhaftet. Ich war damals drei Jahre alt und habe das hautnah miterlebt. Mein Großvater und auch mein Vater waren selbstständige Unternehmer. Sie besaßen einen kleinen Betrieb mit 20 Angestellten. In den 1950er Jahren wurden bestimmte Unternehmer in der DDR kriminalisiert. Zum Glück erfolgte in unserem Fall ein Freispruch und keine entschädigungslose Enteignung. Der Betrieb existierte bis 1972. Es war ein Treibstoffhandel mit Heizöl und Benzin. Dazu gehörten zwei Tankstellen und der Vertrieb. 1972 führte kein Weg daran vorbei, der Betrieb musste an Volkseigentum* verkauft werden, weil zwei Landkreise an der Versorgung mit Benzin und Heizöl hingen. Bereits vorher hatte der Staat immer mehr versucht, Einfluss durch überhöhte Steuern, durch die Beschränkungen des Materialflusses, durch Probleme beim Erwerb von Autos zu nehmen. Dieser Betrieb hat natürlich meine und meines Bruders Kindheit und Jugend geprägt. Immer stand im Vordergrund, wie und ob man ihn aufrechterhalten kann. Und da war es selbstverständlich, dass zu Weihnachten, als Kesselwagen vor der Tür standen, sie entleert werden mussten, mein Bruder und ich die Tankwagen befüllen und ausfuhren. Der Betrieb wurde also 1972 verstaatlicht. Mein Vater übernahm die Betriebsleitung und blieb dies bis in sein Rentenalter. Im Jahr 1990 konnte er den Betrieb zurückkaufen und wurde mit 70 Jahren ›Jungunternehmer‹. Unser Betrieb wird noch heute durch meinen Bruder geführt. Diese Entwicklung zeigt exemplarisch die Widersprüche in der DDR.
Da nie klar war, ob der Betrieb privat bleibt, hatte mein Vater frühzeitig darauf gedrängt, dass wir drei Kinder ordentliche Berufe erlernen und studieren, um unabhängig von der Firma zu sein. Da ist es nur verständlich, dass ich kritisch zur DDR aufwuchs. Das führte zu Konflikten in der Erweiterten Oberschule. Um einen Schulverweis bin ich gerade so herumgekommen. In der 12. Klasse bin ich politisch angeeckt und bekam folgenden Satz vom Lehrer zu hören: »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Du hast noch nichts geleistet, der Steinbruch wäre für dich eine gute Arbeitsstelle.« Meine guten schulischen Leistungen haben mir aber ermöglicht, einen Studienplatz an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar zu bekommen. In dieser Zeit erlernte man neben dem Abitur einen Beruf. Als Maurer wurde ich damit Angehöriger der Arbeiterklasse. Das war wieder so ein Widerspruch in der DDR, wer gehört zur Intelligenz, wer zur Arbeiterklasse? Ich dachte immer, ein Arztsohn wäre Intelligenz, der Nachfahre des Arbeiters sollte als Angehöriger der Arbeiterklasse vorrangig studieren können. Was waren wir nun?
Nach dem Studium arbeitete ich als Bauleiter und als Oberbauleiter. Vielen Arbeitern fehlte der Stolz und das Engagement für die Arbeit. Das sagten sie auch. Das machte mich traurig. In der Bundesrepublik hörte man später: »Ich arbeite beim Bosch«, oder: »Ich fertige tolle optische Geräte«. Dieses Bewusstsein fehlte in der DDR. Die Kollegen durfte man nicht so sehr zur Arbeit anhalten, musste ihnen ihre Freiräume lassen. Diese Arbeitseinstellung wurde von oben geduldet. Andererseits war alles bei der Planerfüllung sehr bürokratisch. Im ersten Quartal musste genau ein Viertel produziert oder gebaut werden. Dass das widersinnig ist, weiß jeder. Da wurden im Herbst Bauleistungen angespart und im Frühjahr abgerechnet. Diese Widersprüche, diese Kluft von Anspruch der Politik, der Regierung und auch der Presse zur Wirklichkeit machten meine Frau und mich immer unzufriedener. Die täglichen Widersprüche wurden einfach totgeschwiegen. Es durfte darüber nicht gesprochen werden.
So entschieden wir noch im August 1989, einen Ausreiseantrag zu stellen. Denn mein Eindruck war: In der DDR läuft es wie in der Sowjetunion, jeder wusste über das Spionieren Bescheid, und die Wirklichkeit war anders als das, was propagiert wurde. Weil es vielen so ging, gab es letztlich die friedliche Revolution. Den Ausreiseantrag haben wir zurückgezogen. Wir wurden aber noch vom Rat des Kreises* vorgeladen und man teilte uns mit, dass wir jetzt ausreisen könnten. Das wollten wir nun nicht mehr und erklärten, dass wir hierblieben. Wir hatten den Eindruck, dass sich nun etwas veränderte, an dem wir mitwirken wollten. Die DDR war ja unsere Heimat, wir waren jung, wir haben auch viel Schönes erlebt.
Meine erste Frau habe ich während des Studiums kennengelernt. Wir haben 1974 geheiratet, nutzten die sozialpolitischen Maßnahmen wie den Ehekredit und hofften dadurch auf eine Wohnung. Meine erste Ehe hat leider nicht gehalten. Insgesamt habe ich drei Kinder gezeugt. Mit meiner ersten Frau zwei und mit meiner zweiten Frau eines. Seit 1985 bin ich das zweite Mal verheiratet. Meine Frau hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir alle guten Kontakt untereinander haben. Das betrifft sowohl meinen Kontakt zu den Kindern als auch aller Kinder untereinander. Als Vater und Opa lade ich alle Kinder möglichst zweimal im Jahr zu einem Treffen ein. Tradition ist unsere gemeinsame Wintersportwoche in Südtirol. Leider passt es manchmal nicht, dass alle Kinder und Enkel mitfahren können. Und im Herbst lade ich immer zu einer Kindertour ein. Wir sind gemeinsam auf dem Rennsteig gewandert, mit der alten Bahn durch den Thüringer Wald nach Neuhaus gefahren oder auf dem Mauerradweg um Berlin geradelt. Alle Kinder sind inzwischen verheiratet und leben verstreut in Ostdeutschland. Nur einer wohnt in Hannover. Ich habe fünf Enkelkinder. Mein ältestes Enkelkind hätte eigentlich jetzt Jugendweihe* gehabt, die fiel aber wegen Corona aus. Der Sohn meiner zweiten Frau hat zwei Kinder und unser jüngster gemeinsamer Sohn ebenfalls. Sie sind gerade in der Coronapandemie sehr belastet, weil sie in einer relativ kleinen Wohnung in Berlin wohnen und im Homeoffice arbeiten. Der Kleine wird am 30. Juni ein Jahr und die größere wird drei Jahre alt. Das sind sehr starke Belastungen.
Früher habe ich mich in der evangelischen Studentengemeinde engagiert. Das habe ich immer als Freiraum gesehen, um bestimmte Themen zu besprechen, und das auch sehr intensiv. Ich habe dabei viel in der Diskussionsführung gelernt, was ich später verwenden konnte. An Treffen mit westdeutschen Studentengemeinden in Berlin konnte ich auch teilnehmen. Später stellte sich heraus, dass wir immer einen von der Stasi an Bord hatten, den man nicht sah, der aber an unseren Gesprächen und Diskussionen sehr interessiert war. Dieses Überwachungssystem haben wir auch beim Stellen des Ausreiseantrags bemerkt. Unangenehm aufgestoßen ist uns, wie uns Leute bei der Ausreise beraten wollten, oder dass plötzlich Reparaturen an unserem Telefon, das ich betrieblich brauchte, nötig wurden. Möglicherweise hörte die Stasi mit. Ich hatte zu einer holländischen Kirchengemeinde Kontakt geknüpft, und diesen ganzen Schriftwechsel fand ich in den Unterlagen der Stasi-Behörde wieder. Es gab also kein Postgeheimnis. Der Schriftwechsel mit meiner Verwandtschaft wurde archiviert, darunter Bilder. Ich habe in meiner Stasi-Akte einige Dinge gefunden, aus denen ich erkennen konnte, wer uns überwacht hatte. Das habe ich aber nicht weiterverfolgt.
Als Bauleiter eines Baubetriebes in der Grenznähe mussten wir sogenannte LVO*-Maßnahmen durchführen. Die Landesverteidigung stand ja an erster Stelle. Wir hatten u.a. an der Grenze am Flussausbau sechs sogenannte Sperrwerke zu errichten, damit man nicht rüber schwimmen konnte. Ich musste alles vorher zur Überprüfung einreichen, nicht nur Namen, sondern auch die Arbeitslisten für die täglichen und wöchentlichen Arbeiten. An der Grenzkompanie gab ich einmal diese Liste ab, als ein junger Offiziersanwärter, ein sogenannter Fähnrich, sie entgegennahm. Ich vermute, dass dort mal was passiert war. Er sagte zu mir, einem zivilen Bauleiter: »Pass auf, in meinem Abschnitt haut keiner ab. Sag das deinen Leuten. Meine Kugel ist tausendmal schneller als ihr rennen könnt.«
In Eisenach war ich im Bauwesen integriert, engagierte mich frühzeitig in einer Arbeitsgruppe Stadtsanierung, die mehrmals tagte und sich mit den Missständen in der Stadt beschäftigte. Das war noch vor der Wende. Zu Wendezeiten wurde ich von dieser Gruppe als Ersatz für den damaligen Stadtbaudirektor vorgeschlagen. Der Anfang war schwierig, weil Vertrautes auf Neues traf. Ich kann mich noch an den Aufschrei erinnern, als wir eine Tchibo-Filiale in der Fußgängerzone eröffnen wollten und sie diese Passage neu strichen. Rundherum war alles Grau. Ich habe mich mit den Gesetzeswerken der DDR befasst, um zu sehen, was man tun kann und darf. Unterschiedliche Auslegungen waren immer möglich. Ich kann mich genau erinnern, dass nicht genau festgelegt war, wann eine Baugenehmigung erteilt werden konnte. Stattdessen gab es Kommissionen, aber Regeln für diese gab es nicht. Dadurch hatten wir viel Spielraum. Diese Tätigkeit habe ich eigentlich sehr gerne gemacht. Danach kamen Verwaltungsveränderungen. Ich wurde Baureferent und bin durch die gewählte Stadtverordnetenversammlung zum Stadtbaudirektor gewählt worden. Danach erhielt ich als Wahlbeamter die Stellung des Baubürgermeisters der Stadt. Das war ich von 1990 und bis 2000. Es war eine sehr interessante, aber auch aufwendige Arbeit, mit hohem Zeitaufwand. Ich war im Prinzip jeden Abend unterwegs. Das hat natürlich die Familie sehr belastet, das möchte ich ausdrücklich sagen. Heute noch bin ich meiner Frau dankbar, dass sie das durchgehalten hat. Als der damalige Oberbürgermeister aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat, wurde ich von 2002–2006 zum Oberbürgermeister gewählt. Bei der nächsten Wahl belegte ich den zweiten Platz. Dafür gibt es leider nichts. Manchmal bin ich abends noch um 22:00 Uhr ins Büro gefahren, um den Schriftverkehr zu erledigen, weil ich genau wusste, dass am nächsten Tag sonst doppelt so viel zu tun ist. Dazu gehörte viel Disziplin und Kraft.
1990 war ich im Neuen Forum* engagiert, das sich zu den Grünen entwickelt hat. Ich habe aber doch gesehen, das möchte ich ausdrücklich sagen, wer konsequent an der Wende – auch an der Vereinigung von Ost und West – gearbeitet hat. Das war Helmut Kohl. Deswegen und weil ich die Arbeit des damaligen Bürgermeisters sehr geschätzt habe, bin ich in die CDU eingetreten, ganz ohne Karriereabsicht, aber es hat sich eben so entwickelt.
Das war schon eine Veränderung, als ich auf einmal nicht mehr Oberbürgermeister war – von 120 Prozent auf null, und das mit 56 Jahren. Aber das ist eigentlich ein gutes Alter für einen Neustart. Gar nichts mehr zu machen, war für mich undenkbar. Einerseits brauchte ich Erholung von dem Stress, andererseits war ich dankbar, dass ich mich so lange für die Gesellschaft engagieren konnte. Ich wollte unbedingt weiter etwas für die Gesellschaft tun. So bin ich seit 2002 sehr aktiv im Deutschen Roten Kreuz tätig, bin hier der Präsident des Kreisverbandes. Zusätzlich übernahm ich noch die Funktion des stellvertretenden Landespräsidenten. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe im Ehrenamt. Darüber hinaus war ich elf Jahre Vorsitzender eines der größten Sportvereine hier in der Stadt. Dieser Sportverein macht die Basisarbeit für die sportlichen Entwicklungen der jungen Menschen, im Unterschied zu den Profiklubs. Und da muss man leider immer um eine entsprechende finanzielle Unterstützung kämpfen. Es gibt auch bestimmte Vorschriften, an die ich gebunden bin. Ich kann aus finanziellen Gründen nicht in den öffentlichen Dienst zurück. Ein Jahr wirkte ich bei der Stiftung Familiensinn des Landes Thüringen. Seit 2008 arbeite ich für den Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Das ist ein Lobbyverband, der sich besonders um die kleinen und mittleren Unternehmen kümmert, die sehr viel bürokratischen Aufwand betreiben müssen und nicht so reich mit Einkünften gesegnet sind und daher ein hohes Insolvenzrisiko tragen. Dieses Insolvenzrisiko belastet besonders die Ersparnisse der Unternehmer für das Alter. Mir hilft natürlich, dass ich aus einem kleinen mittelständischen Unternehmen komme. Es macht mir Spaß zu beraten, Hilfen zu geben. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
In der DDR hat der normale Werktätige, so wie ich ihn kenne, relativ wenig verdient. Durch Überstunden und Schichtdienst konnten sie den Lohn etwas aufbessern. Die Arbeiter hatten aber auch bestimmte Privilegien, sie konnten nicht so exakt die Arbeitszeit einhalten, sich Kraft für den Feierabend aufsparen. Die zeitlichen Normen waren gut auskömmlich, was den Ostmännern im Westen aufstieß. Der Westen hat sich auch mit Leistungen, mit Ängsten, mit viel Tränen, mit Insolvenzen entwickelt. Dies haben die Ostdeutschen im Westfernsehen aber nie gesehen. Ich habe so das Gefühl, dass viele Ostdeutsche die Vorstellung hatten: »Hier in der DDR werde ich nichts durch meine Arbeit. Wenn ich drüben wäre, dann werde ich was.« Das war der goldene Traum. Dass dieser Traum nur durch Leistung wahr werden kann, bedeutet für den Ostdeutschen: Er muss sich anpassen, er muss sich verändern, er muss sich darauf einstellen, die geforderte Leistung unter großem Einsatz zu erbringen. Für manche ist diese Umstellung sehr schwierig. Ich bin nicht von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen, zum Glück. Sehr viele traf es völlig unverschuldet. Plötzlich ohne Selbstverschulden und ohne Chancen aus einem sehr sicheren Arbeitsverhältnis in der DDR in ein unsicheres Leben zu gehen, hat sehr viele in Resignation und einige in Aggression getrieben.
Insofern ist ein kleinerer Teil der Ostmänner in der heutigen Bundesrepublik nicht angekommen. Menschen, die oft arbeitslos waren, heute mit Hartz IV leben, für die ist es schwierig, auch weil die Renten so klein bleiben werden. Ja, wir hatten in der DDR ein ausgeprägtes Sozialsystem, manche haben sich auch in diesem Sozialsystem eingerichtet. Manchen fehlt der Anreiz, wieder arbeiten zu wollen. Ja, wir haben mehr Freiheit bekommen, aber dieses Mehr an Freiheit bedeutet auch, dass man sie selbst gestalten muss.
Für mich war die DDR meine Jugend. Das bedeutet, dass man Ziele hat, etwas für die Gesellschaft tun will. Die gesellschaftlichen Ziele des Sozialismus hat die DDR geschickt ganz nach oben gestellt. Dabei verschwieg man die Widersprüche, die sie auch prägten. In mir ist allerdings nach wie vor der gesamtgesellschaftliche Gedanke, das Arbeiten für die Gesellschaft bedeutend. Dies hat sich verändert. Heute steht die Gestaltung des Individuums vor dem Gesellschaftlichen. Diesen Widerspruch in der DDR zwischen dem tatsächlichen Erleben und dem gesellschaftlichen Anspruch habe ich auch in mir gespürt. Ich habe mich gesellschaftlich in einem sehr starken Überwachungsstaat engagiert. Dieses Überwachen, das überall Hineinlenken und Leiten, sehe ich sehr kritisch. Auch wie man mit der Intelligenz umging, dass ich im Klassenbuch meiner Kinder als Unternehmer geführt wurde und dass dort stand, wer in welcher Partei war, welchen Beruf die Eltern hatten. Das ging zu weit. Eine andere Sache ist, was sie für die Gleichberechtigung der Frau getan haben, auch wenn sie sie als Arbeitskraft brauchten. Frauen wurden bedeutend besser gefördert als im Westen. Ich kann mich noch über das Erstaunen meine Frau erinnern, als sie ein Konto bei einer westdeutschen Bank nach der Wende eröffnen wollte und um meine Zustimmung gebeten wurde.
Nach wie vor stört mich die Bewertung derer, die uns die Freiheit zur Wende brachten. Dass die ehemalige SED als Partei weiter existieren kann, sich nie grundlegend mit ihren Fehlern auseinandersetzen musste, sich nicht neu gründete, sondern mit den alten Kadern weitergeführt wurde, finde ich nicht in Ordnung. Den rechten Rand, deren Forderungen und Hass, zum Beispiel gegen die Juden, kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Andererseits muss man aber bestimmte Themen, die auch von der AfD aufgegriffen werden, diskutieren. Man darf sie nicht totschweigen. Dass das nicht funktioniert, haben wir in der DDR erlebt. Es wird in der Gesellschaft immer unterschiedliche Ansichten geben, von Links, Mitte und Rechts. Man muss über diese intensiv diskutieren und natürlich Auswüchse mit dem Rechtsstaat bekämpfen. Ich würde mir wünschen, dass man sich heute nach über 30 Jahren mehr und intensiver mit der DDR-Geschichte, den Parteien, mit dem widersprüchlichen Leben auseinandersetzt.
Alfred, Jahrgang 1929 | 3 Kinder, verwitwet
Ost: Werkzeugmacher, Pionierleiter West: Tierparkbegleiter
Jugendherbergsleiter, Produktionslenker
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben
wie Vater und Mutter
Das letzte Aufgebot, ich gehörte dazu. 15-jährig waren meine Klassenkameraden für »Führer und Vaterland« als Soldaten der HJ-Division Dresden in Altenberg/Erzgebirge von der SS in den Tod getrieben worden. Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass ich zu diesem Zeitpunkt, am 9. Mai 1945, nicht mehr Teil dieser Einheit war. Für mich war der Krieg zu Ende, als einige Tage vorher unsere Gruppe im Müglitztal Panzer der Roten Armee mit unseren Panzerfäusten aufhalten sollten. Aber es kamen keine. Ein junger Leutnant der Wehrmacht fragte, ob wir mit ihm zu den Amis durchbrechen wollten. Wir wollten. So landeten Karabiner und Munition im Fluss.
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben wie Vater und Mutter. Es waren junge Antifaschisten der Antifa-Jugend Loschwitz und später die Kommunisten im Werkzeugbau des Sachsenwerkes/Niedersedlitz, die mir halfen, das faschistische Gedankengut aus dem Gehirn zu schwemmen. Elternhaus, Schule, Jungvolk und Hitlerjugend hatten es von früher Kindheit an bei mir und vielen meiner Altersgenossen tief im Kopf verwurzelt. Immer mehr wurde mir klar, was wir doch für eine betrogene Generation waren. Der größte Teil meiner ehemaligen Klassenkameraden aus der 17. Volksschule Dresden konnte diesen Prozess nicht mehr erleben. Sie waren für »Volk und Vaterland« gestorben.
Im Sachsenwerk/Niedersedlitz (SW) hatte ich meine Lehre als Werkzeugmacher 1943 begonnen und 1946 mit der Facharbeiterprüfung im »Roten Werkzeugbau« bestanden. Dies hieß so, weil hier eine Gruppe von Kommunisten tätig war, die während der Nazizeit als Mitglieder der VKA (Vereinigte Kletterabteilung, auch »Rote Bergsteiger« genannt) aktiv gegen die Nazis kämpften und dafür kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 in eines der ersten Konzentrationslager, die Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz), verbracht wurden. Gebrochen werden konnten sie aber nicht. Anfang März 1946 hatte ich ein Erlebnis, welches für mein Leben von großer Bedeutung werden sollte. Ich begleitete meine neuen Freunde der Antifa-Jugend Loschwitz in den Saal des Sachsenverlag Dresden. Hier fand die Gründung der FDJ* in Sachsen statt. Der Saal war brechend voll mit Jungen und Mädchen und ihren älteren Gefährten. Ich stand ganz hinten am Eingang. Ich gehörte ja nicht dazu, war nur Gast. Es wurden Reden gehalten. Das meiste verstand ich nicht. Alles war so neu, obwohl es die Sprache meiner Loschwitzer Freunde war. Am Schluss sang ein Chor ein Lied – und viele stimmten ein, nur einer nicht. Ich! »Es rosten die starken Maschinen ...« Das war die Sprache, die jeder verstand. Ich wollte mitmachen. So wurde ich am 13. September 1946 als Mitglied der FDJ* im Sachsenwerk aufgenommen.
Die FDJ-Gruppe von nicht einmal 30 Freunden wurde meine erste politische Heimat nach dem Krieg. Mitte 1948 wurde die FDJ-Leitung zu unserem sowjetischen Generaldirektor des SDAG* eingeladen. Noch in Uniform der Sowjetarmee hörte er sich unsere Nöte an. Dann sagte er: »Ihr müsst einen Wettbewerb machen. Kommt wieder und schreibt auf, was ihr als Prämien ausgeben wollt.« So entstand die Idee unseres ersten innerbetrieblichen Wettbewerbs. Viele Prämien wurden gebaut. Ich gehörte zu einer Gruppe, die Spielzeug für die Betriebskinder aus Blech bastelten. Am Schluss konnten sich viele Kinder über die Mini-Trümmerlok mit ihren Loren freuen. Mit solchen Initiativen wuchs unsere FDJ-Gruppe bis Ende 1948 auf über 300 Freunde. Von meinen Freunden wurde ich im März 1949 zum hauptamtlichen Pionierleiter gewählt und begann am 1. April meine Tätigkeit an der 88. Grundschule in Dresden-Pillnitz. Für die 180 Schulen gab es damals acht Pionierleiter. Nur wenige hatten zuvor mit Kindern gearbeitet. Logisch, dass wir zusammenhielten, wie eine kleine Familie. Wir teilten oft unser (karges) Brot, wie Geschwister. Als Werkzeugmacher verdiente ich immerhin um die 400 Mark. Das war damals ein recht guter Lohn. Natürlich nicht im Verhältnis zu den Schwarzmarktpreisen: Zwei Kilogramm Brot kosteten 80 Mark, eine (!) Zigarette im Schnitt drei Mark. Unser ›fürstliches Gehalt‹ als Pionierleiter betrug lange Zeit monatlich 180 Mark (brutto), das waren 168 Mark netto, und reichte vorne und hinten nicht.
Meine ersten Erfahrungen bei der Organisation, Versorgung und Betreuung vieler Kinder machte ich 1949 als Lagerleiter im Pionierlager Bräunsdorf. Dort hatte mich ein Mädchen beklaut. Meine 18 Mark waren weg, die Kinder waren alle so traurig und sammelten für mich. So kamen acht Mark zusammen.
Silvester 1948 begegnete ich meiner Inge das erste Mal im Erbgericht Kreischa. »Erbgericht« heißen hier die Dorfgaststätten. Als wir uns einige Zeit darauf wieder trafen, wurden wir uns einig, unser Leben zukünftig gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Edith verbringen zu wollen. Im Rosengarten an der Elbe steckten wir uns am 26. Juli 1949 die versilberten Ringe an die Finger. Jetzt waren wir verlobt! Ein Jahr später wanderten sie von der linken an die rechte Hand. Wir wurden Mann und Frau. Ab Februar 1950 lebten wir drei Erwachsene, Inges Oma kam zu uns, in zwölf Quadratmeter zur Untermiete unter dem Dach. Zumindest hatten wir fließendes Wasser, wenn auch nur bei Regen die Wand herunter. Sonst schleppten wir das Wasser von der ›Plumpe‹ auf dem Hof herauf. Wenigstens einen Ausguss gab es neben dem Kohleherd in der ›Küche‹. Im Winter fror das Wasser im Glas auf dem Nachttisch. Die Schlafzimmermöbel hatten wir auf Raten gebraucht gekauft. Wegen der Dachschräge zahlten wir nur für sechs Quadratmeter Miete, insgesamt 20 Mark. Unsere Wohnung erreichten wir über die ›Hühnerstiege‹, die Inge, hochschwanger, auf dem Hintern herunter segelte. Zum Glück kam sie mit nur ein paar blauen Flecken davon. Den Kampf um eine neue Wohnung habe ich gewonnen, weil ich eine Aktivistenurkunde von 1948 vorweisen konnte. Mit dem Einzug in die neue Wohnung musste ich lernen, die Vaterrolle zu spielen. Im Februar 1952 gab unsere Tochter Marita ihr erstes Brüllerchen von sich.
Große Hilfe erhielten wir von Oma Zuber, Inges Großmutter. Sie schlief neben dem Baby. Oma Zuber war die wichtigste Person in Inges Leben. Die Familie war aus Tschechien ausgewiesen worden, im Rahmen des Beneš-Dekret*. Inge trat als junge Kommunistin in die Fußstapfen von Opa und Vater und wurde jung Mitglied der Partei. Im gleichen Betrieb wie Vater arbeitete sie als Kernmacherin. Das war eine schwere Arbeit in der Gießerei. Auf der Kreisparteischule erwarb sie sich 1948 nicht nur erste Kenntnisse in den Gesellschaftswissenschaften, sondern verliebte sich auch noch in ihren Lehrer. Ergebnis: Edith, geboren am 21. Mai 1949. Dumm nur, dass der Herr Papa nicht der Papa sein wollte. So bot ich mich später an, Edith zu adoptieren. Inges Mutter war dagegen, nahm Edith zu sich. Sie hat nicht eine Nacht bei uns geschlafen. Entsprechend war die Bindung meiner Kinder zu ihr.
Unvergesslich waren für mich die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin vom 5. August bis zum 19. August 1951. Sie standen unter dem Motto: »Für Frieden und Freundschaft – gegen Atomwaffen«. Teilnehmer: 26.000 Jugendliche aus 104 Ländern, Ehrenpräsident war Prof. Joliot-Curie aus Frankreich, Präsident des Weltfriedensrates. Trotz vieler Repressalien durch die Polizei nahmen mehr als 35.000 junge Menschen aus der BRD und aus Westberlin am Festival teil. Danach wurde ich Instrukteur in der Stadtleitung der FDJ* Dresden. Wir bereiteten das erste Pioniertreffen im August 1952 in Dresden vor. Besonders viel Kraft steckten wir in die Vorbereitung der Pionierparade, die Pionierfeste im Großen Garten und im Pionierpalast, die Auftritte von Kulturgruppen, die Wettkämpfe der jungen Sportler im Rudolf-Harbig-Stadion. Martin Andersen Nexö, der dänische Romancier und Novellist, feierte seinen Geburtstag in seiner Villa auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Ich durfte ihm mit einigen Pionieren unsere Glückwünsche überbringen.
Und meine Inge hatte es wieder einmal eilig. Sie schaffte es nicht ins Krankenhaus, und so kam unser Sohn Jürgen in unserem Schlafzimmer zur Welt und ich fiel in Ohnmacht. Oma Zuber kümmert sich bis zu ihrem Tode liebevoll um ihre Urenkel und starb in unseren vier Wänden. Sie hatte sich in der Woche, wenn wir arbeiteten, um die Kinder gekümmert. Aber am Wochenende gehörten wir den Kindern. Oft spazierten wir durch den Großen Garten und besonders gern begleiteten wir die Kinder in den viertältesten Zoo Deutschlands, in Dresden gegründet 1861. Dorthin führten mich schon als Kind meine Eltern. Jetzt zeigte ich meinen Kindern und meiner Frau den 13 Hektar und damit 26 Fußballfelder großen Tierpark am Rande des Großen Gartens.
Nach dem Tod der Uroma gingen unsere Kinder in ein Wochenheim der VP*. Inge war mit der Pflege der Kranken in der Untersuchungshaftanstalt Dresden beschäftigt und ich trieb mich als Instrukteur in den Schulen der Stadt herum. 1956 wurde ich Lagerleiter für ein Winterlager der Kinder der Reichsbahnangestellten. Höhepunkt sollte ein Feuerwerk sein. Im Lager für Pyrotechnik in Pirna sollte ich das Zeug abholen. Im Knallerlager packte mir der Mitarbeiter den Rucksack voll. »Aber Vorsicht, das Zeug ist gefährlich!« Vorsichtshalber sagte ich nicht, dass ich mit dem Bus unterwegs war. Ich hockte auf der Rückbank und merkte, wie sie heiß wurde. Ich saß auf der Heizung – und mir wurde noch heißer. Den Rucksack hatte ich nun auf dem Schoß. Alles ging gut. Für die Kinder war das Feuerwerk eine wahnsinnige Überraschung, sie hatten so etwas noch nie erlebt. Für mich war es ein schweißtreibendes Erlebnis.
Im Frühjahr 1956 musste ich wegen meines fehlenden Hochschulabschlusses zur ›Runderneuerung‹ an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck an den Bogensee für fünfeinhalb Monate. Und schon war ich Lehrer!
In meiner politischen Arbeit spielte natürlich der Kalte Krieg gegen die DDR eine große Rolle. Wirtschaftlich litt die Volkswirtschaft der DDR unter dem vielseitigen Embargo. In Vietnam versuchten die USA, das vietnamesische Volk seit 1955 in die »Steinzeit zurück zu bomben«. Der Krieg dauerte bis 1975! Das war die Zeit, als die Kinder aufwuchsen, von denen mir ein Teil anvertraut war. Wenn die Generationen, die heute in Deutschland leben, keinen Krieg mehr am eigenen Leibe erfahren haben, so ist das auch den jüngsten Friedenskämpfern zu verdanken, die zum Beispiel 1958 auf dem Friedensmarsch nach Halle waren. Das darf man nie vergessen!
Von September 1958 bis zum August 1959 musste ich als Vorsitzender einer Kreisorganisation der Pioniere wieder zu einer ›Runderneuerung‹, diesmal als Student an die Bezirksparteischule der SED in Dresden. Zurück von der Parteischule wurde ich Stellvertretender Leiter des Pionierpalastes in Dresden, der in einem der Albrechtsschlösser über der Elbe 1951 eröffnet wurde. Zu meinen Aufgaben gehörten die Abteilungen Sport/Touristik, Naturwissenschaft (NAWI), Kunst und die Abteilung Massenarbeit. Nach Ideen und Vorschlägen der Kinder erstellten wir die Monatspläne und das Monatsplakat für das Kinderparadies, das die Kinder Dresdens an allen Litfaßsäulen der Stadt lesen konnten. Der Palast war für alle offen. Und vom Pionierpalast aus wurden Kinderfeste im Haus, im Park oder im Großen Garten für durchschnittlich 5.000 Kinder gestaltet. Bei den Kindern besonders beliebt waren Ostereiersuchen im Park oder die Märchenstunden im Türkischen Bad. Übrigens: Die Teilnahme am Pionier- oder Betriebsferienlager, 21 Tage, kostete einheitlich zwölf DDR-Mark. Da konnten selbst Arbeiterkinder aus der Bundesrepublik erholsame und interessante Ferientage verleben.
In meiner wenigen Freizeit spielte die Kultur eine große Rolle. Wir besaßen ein Theaterabonnement und jeden Monat war einmal Theatertag. Kultur gehörte zu unserem Leben wie das tägliche Brot.
Während des Pioniertreffens in Halle im August 1961 stand Inge kurz vor der vierten Entbindung. Jahre quälte sie sich mit der Erinnerung an die Geburt unseres Sohnes Lutz 1958. Er starb am gleichen Tag. Inge hatte ihn nicht sehen können. Als ich mich von ihm in der Pathologie verabschiedete, sah ich in ihm die Kleinausgabe von Jürgen, unserem zweiten gemeinsamen Kind. Ich werde das Bild nie vergessen. Sein Hals, er hatte sich mit der Nabelschnur bei der schweren Geburt selbst erdrosselt, war verbunden. Inge habe ich zu ihren Lebzeiten nie davon erzählt. Sie trug schwer daran – bis mir nichts Besseres einfiel, als ihr zu einer neuen Schwangerschaft zu verhelfen. Jetzt hatte sie wenigstens die Hoffnung, dass alles gut gehen würde. Unsere Tochter Annette wurde gesund geboren.
Für meine weitere Entwicklung benötigte ich nach Ansicht meiner Bezirksleitung der FDJ* einen Hochschulabschluss. Meine Abschlüsse als Pionierleiter und Lehrer der Unterstufe und bei der Partei hatten nur den Wert von Fachschulabschlüssen. An der Karl-Marx-Uni Leipzig stand ab September 1963 ein Platz im Fernstudium auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften für mich bereit. Mein Problem war Russisch. Auf diesem Gebiet war ich eine absolute null. Also nahm ich Nachhilfeunterricht bei einer rüstigen Frau, mindestens 80 Jahre alt, in einer piekfeinen Villa in Radebeul. An unseren Milchglasscheiben in unserer Wohnung, an Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer schrieb ich mit Kreide die Vokabeln des Tages, die ich jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete, erst übersetzte, bis sie saßen. Inge ermahnte die Kinder, das Geschreibsel nicht weg zu wischen, weil »Papa das braucht!«. Die Russisch-Prüfung endete in einem Blutbad – das ganze Blatt rot, aber bestanden. Ich wusste damals noch nicht, dass der Mann meiner Lehrerin der Vorsitzende Richter im Reichstagsbrand-Prozess von 1933 gewesen war. Seine Witwe meinte: »Mich belastet das sehr und ich möchte wenigstens an einem Kommunisten etwas gut machen. Deshalb möchte ich von ihnen kein Geld nehmen. Ich würde mich freuen, wenn sie mir ein paar Aufbaumarken besorgen könnten. Körperlich kann ich in meinem Alter nicht mehr beim Aufbau helfen.« Der Prozess endete mit einem »Freispruch aus Mangel an Beweisen«. Ihr Mann hatte die Erwartungen der Hitlerleute damit nicht erfüllt. Er starb 1937 in Leipzig aus Schmach, »Werkzeug gewesen zu sein«.