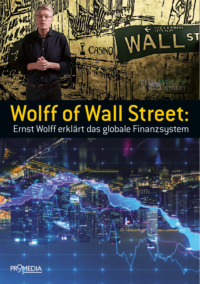Kitabı oku: «Wolff of Wall Street», sayfa 3
5. Petrodollar
Dieser Beitrag ist auch als Video verfügbar. Zum Link: https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-der-petrodollar/
1973 kam es im Nahen Osten zwischen einer Koalition aus arabischen Staaten einerseits und Israel andererseits zum Yom-Kippur-Krieg, den Israel gewann. Als Vergeltung für die Unterstützung Israels durch den Westen reagierten die arabischen Staaten mit einer Drosselung der Ölfördermengen und drastischen Öl-Preiserhöhungen von bis zu 400 Prozent. Das führte in den Industrieländern zu erheblichen Problemen, machte aber auch deutlich, welche Bedeutung das Öl für die gesamte Welt hatte. Vor allem aber brachte es die Regierung in Washington auf eine Idee: Da der Dollar nach der 1971 erfolgten Abkoppelung vom Gold ja an keinen festen Wert mehr gebunden war, konnte man ihn vielleicht an die meist gehandelte Ware der Welt, nämlich das Öl, binden. Aber wie?
Die Idee zur Lösung des Problems kam vom damaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Er nahm 1974 Kontakt mit Saudi-Arabien auf, das innerhalb der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) den Ton angab, und machte den Vertretern der dort herrschenden Monarchie folgende zwei Angebote:
Die Regierung in Washington würde dafür sorgen, dass Saudi-Arabien von seinen Feinden, insbesondere von Israel und Syrien, in Ruhe gelassen würde.
Die Regierung in Washington würde außerdem dafür sorgen, dass Saudi-Arabien ab sofort in unbegrenztem Umfang US-amerikanische Waffen beziehen könnte.
Als Gegenleistung forderte Kissinger vom saudischen Königshaus, innerhalb der OPEC dafür zu sorgen, Öl weltweit nur noch in Dollar zu handeln und die eigenen Gewinne größtenteils in US-Staatsanleihen anzulegen.
Das Königshaus Saud sah das Ganze als Win-Win-Situation und willigte sofort ein. Der Petrodollar war geboren und in den USA rieb sich die Finanzelite die Hände: Nachdem sie den Dollar 1944 bereits zur globalen Leitwährung gemacht hatten, verhalf die US-Regierung ihm nun – dreißig Jahre später – durch das Abkommen mit Saudi-Arabien auch noch zum Status der weltweit wichtigsten Reservewährung – ein Status, der den Dollar stärker als je zuvor gemacht hat. Denn da alle Länder der Erde zur Energieproduktion auf Öl angewiesen sind, müssen ihre Zentralbanken seit der Mitte der 1970er Jahre große Mengen an US-Dollar vorhalten, und zwar bis heute. 2018 bestanden die Währungsreserven aller Zentralbanken der Welt zu fast zwei Dritteln aus US-Dollar. Der Petro-Dollar ist damit ein enormes Druckmittel in den Händen der USA. Wie wichtig ihnen diese Funktion ist, zeigt sich immer dann, wenn er in Gefahr gerät. Der Irak und Libyen zum Beispiel wurden nicht etwa deshalb bombardiert, weil sie Massenvernichtungswaffen besaßen oder Massaker an der eigenen Bevölkerung zuließen, sondern weil ihre Regierungen den Petrodollar infrage stellten – Saddam Hussein, indem er sein Öl für Euro verkaufte, und Muammar Gaddafi, indem er den Petrodollar durch einen goldgedeckten nordafrikanischen Dinar ersetzen wollte.
Trotz dieser Kriege hat sich die Situation für den Petrodollar inzwischen allerdings weiter verschlechtert, und das hauptsächlich durch die Aktivitäten dreier Länder, die mit militärischen Mitteln nicht so einfach zu unterjochen sind wie der Irak und Libyen: Nämlich Iran, Russland und China.
Vor allem China spielt dabei eine wichtige Rolle: Das Land ist mittlerweile die größte Handelsnation der Erde und seine Währung, der Yuan, gewinnt zusehends an Bedeutung. Nach langem Zögern hat China inzwischen seine Zurückhaltung gegenüber dem Petrodollar abgelegt und nach diversen Handelsverträgen mit Partnern wie Russland und Iran im März 2018 sogar offiziell einen eigenen Terminhandel mit Rohöl in Yuan begonnen. Außerdem hat China in den vergangenen Jahren sehr große Goldvorräte angelegt, mit denen es die eigene Währung möglicherweise hinterlegen könnte. Noch ist es nicht so weit, denn noch ist China selbst vom US-Dollar abhängig, weil es US-Staatsanleihen in Höhe von mehr als einer Billion US-Dollar hält. Aber es ist bereits abzusehen, dass die Zeit des Petrodollars abläuft. Das bedeutet für die gesamte Welt allerdings eine große Gefahr. Sieht man nämlich in die Geschichte zurück, so hat noch kein Land freiwillig auf seine Macht und seinen Einfluss verzichtet.
Genau das dürfte der Grund sein, warum die USA derzeit aufrüsten wie seit langem nicht, warum sie immer mehr Militärs in die Regierung berufen und warum sie vor allem im Südchinesischen Meer immer wieder zündeln und provozieren.
6. Bretton Woods
Dieser Beitrag ist auch als Video verfügbar. Zum Link: https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-das-system-von-bretton-woods/
Der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 hat die Machtverhältnisse auf unserem Planeten grundlegend verändert. Vor dem Krieg hatte Großbritannien mehrere hundert Jahre lang mit seinem Kolonialreich – dem britischen Empire – einen Großteil der Welt beherrscht und das britische Pfund zur weltweit wichtigsten Währung gemacht. Damit war es am Ende des Zweiten Weltkrieges vorbei. Großbritannien war hoch verschuldet, die Wirtschaft lag am Boden und der Zerfall des Empires war nur noch eine Frage der Zeit.
Gleichzeitig hatte ein anderes Land einen kometenhaften Aufstieg hinter sich: Die USA verfügten über die stärkste Wirtschaft, die größten Goldvorräte, das schlagkräftigste Militär und besaßen als erstes und damals einziges Land die Atombombe. Die USA hatten allerdings ein Problem: Die Überproduktion. Die amerikanische Wirtschaft produzierte mehr Waren, als der heimische Markt aufnehmen konnte. Was sie also brauchten, waren Märkte, auf denen sie diese Waren loswerden konnten. Zu diesem Zweck fasste die Regierung in Washington einen Plan. Im Sommer 1944 lud sie die Vertreter von 42 Ländern zu einer Konferenz nach Bretton Woods, einem kleinen exklusiven Skiort an der amerikanischen Ostküste. Heute wissen wir, dass das Ganze im Grunde nur eine Schauveranstaltung war: Die Vertreter der USA und Großbritanniens hatten sich nämlich in den Jahren zuvor mehrmals zu Geheimverhandlungen getroffen und die wichtigsten Beschlüsse längst festgelegt.
Auf der Konferenz von Bretton Woods tat die US-Regierung etwas, was keine Regierung je zuvor getan hatte: Sie machte die eigene Währung zur weltweiten Leitwährung. Dazu wurde der US-Dollar an Gold gebunden, und zwar zum Preis von $ 35 je Feinunze. Außerdem wurden alle anderen Währungen der Welt zu festen Wechselkursen an den Dollar gebunden. Das Ergebnis dieser Beschlüsse war, dass die USA in den folgenden Jahrzehnten fast alle Märkte der Welt – mit Ausnahme der Planwirtschaften der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten – mit ihren Waren und ihrer Währung überschwemmen konnten. Ganz wesentlich ist dabei folgender Punkt: Obwohl der Dollar globale Leitwährung wurde, gab es auch nach 1944 nur eine einzige Organisation, die ihn schaffen durfte – die 1913 gegründete US-Zentralbank Federal Reserve, die sich bis heute im Besitz der reichsten Bankiersfamilien der USA befindet. Das heißt: Das Bretton-Woods-System hat einer kleinen Gruppe sehr wohlhabender Menschen in den USA dazu verholfen, das globale Finanzsystem der eigenen Währung zu unterwerfen und sich auf diese Weise weltweit in einem nie dagewesenen Ausmaß zu bereichern.
Dieser undemokratische – oder besser gesagt anti-demokratische – Charakter des Bretton-Woods-Systems ist übrigens kein Zufall: Die Idee zu einer globalen Leitwährung stammte nämlich gar nicht aus den USA, sondern von einem deutschen Nationalsozialisten. Der Mann hieß Walther Funk, war unter Adolf Hitler Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident und hatte in den 1930er Jahren den Plan entwickelt, die Reichsmark zur weltweiten Leitwährung zu machen.
Etwa 20 Jahre nach der Konferenz von Bretton Woods – Mitte der 1960er Jahre – zeigte sich, dass das System einen entscheidenden Schwachpunkt hatte: Dadurch, dass immer mehr US-Dollars gedruckt wurden und in aller Welt kursierten, die Goldmenge in den Tresoren der USA aber nur sehr langsam wuchs, entstand zwischen Dollar und Gold ein immer größeres Missverhältnis. Das ließ Investoren und Regierungen aufhorchen, weil sie fürchteten, dass zum Ausgleich dieses Missverhältnisses das Gold aufgewertet und der Dollar abgewertet werden könnte. Deshalb begannen sie, ihre Dollars in immer größeren Mengen in Gold umzutauschen – so lange, bis die Lage kritisch wurde und die USA einfach nicht mehr genug Gold besaßen, um die Nachfrage zu befriedigen.
Aus diesem Grund zog US-Präsident Nixon im August 1971 die Notbremse und verkündete die Abkoppelung des Dollars vom Gold. Das war eine für das globale Finanzsystem überaus wichtige Entscheidung, denn damit fiel nicht nur einer der beiden Eckpfeiler des Bretton-Woods-Systems: Damit wurde die weltweite Leitwährung zu einer sogenannten Fiat-Währung – also einer Währung, die durch keinen realen Wert gedeckt ist, sondern nur noch auf dem Vertrauen in die Übermacht der Nation, die sie herausgibt, basiert. Zwei Jahre später, also 1973, wurde dann wegen anhaltender Turbulenzen an den Geldmärkten auch noch die Bindung anderer Währungen an den Dollar zu einem festen Tauschverhältnis aufgehoben. Mit dieser Freigabe der Wechselkurse war das System von Bretton Woods endgültig beendet.
Nicht beendet war allerdings die Vorherrschaft des US-Dollars, denn schließlich hatte er das globale Finanzwesen als Leitwährung 30 Jahre lang bis in den hintersten Winkel der Erde durchdrungen und dadurch eine einzigartige Sonderstellung erlangt. Außerdem waren die USA noch immer die mit Abstand stärkste Wirtschafts- und Militärmacht der Welt und konnten ihre Interessen gegenüber ihren Konkurrenten jederzeit durchsetzen – entweder durch ökonomischen Druck oder, falls das nicht ausreichte, mit militärischer Gewalt.
7. Geldschöpfung
Dieser Beitrag ist auch als Video verfügbar. Zum Link: https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-die-geldschoepfung/
Geld regiert die Welt – das wissen wir alle. Aber wo kommt das Geld her? Wer erzeugt es und wie gelangt neues Geld ins System?
Es gibt insgesamt drei Prozesse, die für die Geldschöpfung verantwortlich sind:
Bargeldschöpfung durch die Zentralbanken
Geldschöpfung durch Kreditvergabe der Geschäftsbanken
Geldschöpfung durch Zentralbankkäufe bei den Geschäftsbanken
Fangen wir mit dem ersten Prozess an: Zentralbanken haben als einzige Banken das Recht, Münzen prägen und Noten drucken zu lassen, also Bargeld zu erzeugen. Sie leiten dieses Geld über die Geschäftsbanken, die bei der Zentralbank Konten unterhalten, in den Geldkreislauf ein. Bargeld macht weltweit heute aber nur noch etwa 10 bis 20 % des Geldbestandes aus. Viel wichtiger als Bargeld ist das Buchgeld oder Giralgeld, also Geld, das nur auf Konten existiert. Zu dessen Vermehrung trägt der zweite Prozess bei, die Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken. Hierzu ein Beispiel:
Ich gehe zu einer solchen Geschäftsbank und bitte um einen Kredit über 1.000 Euro. Zuerst verlangt die Bank eine Sicherheit, das heißt, ich muss nachweisen, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe oder über genügend Besitz verfüge, um die 1.000 Euro auch zurückzahlen zu können. Dann vereinbart die Bank mit mir eine Laufzeit, zum Beispiel ein Jahr, und einen Zinssatz, zum Beispiel 5 %. Schließlich zahlt sie mir das Geld aus – aber nicht in bar, sondern, indem sie per Mausklick 1.000 Euro auf mein Konto überweist. Damit schafft die Bank Geld, das vorher nicht da war.
Aber dieses Geld existiert nicht für immer. Wenn alles gut geht, überweise ich der Bank ein Jahr später den Kredit samt Zinsen. Was passiert? Das Geld, das die Bank aus dem Nichts heraus geschaffen hat, löst sich in Luft auf, ist nicht mehr vorhanden. Nur eines bleibt: Die Zinsen in Höhe von 50 Euro, die ich der Bank zahlen muss. Die waren schon vorher da, haben allerdings den Besitzer gewechselt. Die Geldschöpfung mittels Kreditvergabe hat also dazu geführt, dass Geld, das vorher mir gehörte, jetzt der Bank gehört. Das gleiche gilt übrigens für den Fall, dass ich den Kredit nicht zurückzahlen kann. Dann bedient sich die Bank an den Sicherheiten, die ich ihr vorher bieten musste.
Kommen wir zum dritten Prozess, der in unserer Zeit die wichtigste Rolle spielt und an dem sowohl die Geschäftsbanken als auch die Zentralbanken beteiligt sind. Nehmen wir an, eine Regierung braucht Geld. Was tut sie? Das gleiche wie wir alle: Sie leiht es sich. Dazu lässt sie zum Beispiel Staatsanleihen drucken, also Wertpapiere, auf denen wie bei einem Kredit eine bestimmte Summe, ein Zinssatz und eine Laufzeit festgelegt sind. Diese Staatsanleihen werden auf Auktionen an Geschäftsbanken verkauft. Dort bleiben sie aber nicht, denn anschließend kommt die Zentralbank ins Spiel und kauft den Geschäftsbanken diese Staatsanleihen ab – und zwar mit Zentralbankgeld, das nur zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken oder von den Geschäftsbanken untereinander benutzt wird. Und dieses Zentralbankgeld schöpft sie – aus dem Nichts heraus. Es war vorher nicht da und wurde nur zum Zweck des Kaufes geschaffen. Dieser Prozess gilt nicht nur für Staatsanleihen: Seit der Krise von 2007/2008, die ja das globale Finanzsystem von Grund auf verändert hat, kaufen Zentralbanken auch andere Wertpapiere wie Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Aktien und Verbriefungen.
Entscheidend dabei ist Folgendes: Die Zentralbanken kaufen alle diese Wertpapiere nie direkt von denen, die sie herausgeben – also zum Beispiel von Industriekonzernen, Aktiengesellschaften, Fonds oder – wie im Fall der Staatsanleihen – vom Finanzministerium, sondern immer von den Geschäftsbanken, die übrigens bei jedem einzelnen Verkauf eine Provisionsgebühr einstreichen. Dieser Prozess der Geldschöpfung – und das ist das alles Entscheidende – spielt sich also ausschließlich unter Bankern ab und begünstigt diejenigen Geschäftsbanken, die hauptsächlich an ihm beteiligt sind – und das sind die großen Banken.
Sehen wir uns alle drei Geldschöpfungsprozesse noch einmal an: Beim ersten – der Bargeldschöpfung – spielt nur die Zentralbank eine Rolle. Der zweite – die Buchgeldschöpfung durch Kreditvergabe – ist ausschließlich Sache der Geschäftsbanken. Beim dritten – der Geldschöpfung durch den Ankauf von Wertpapieren – spielen sowohl die Zentralbank als auch die großen Geschäftsbanken und – im Falle der Staatsanleihen – auch die Politik eine Rolle.
Wir – die normalen Bürger – sind an keinem dieser Prozesse beteiligt. Das System der parlamentarischen Demokratie lässt uns zwar alle vier Jahre zur Wahl gehen, sorgt aber seit seiner Einführung dafür, dass die Geldschöpfung ein uns allen entzogenes Sonderrecht ist, das den Zentralbanken, den Geschäftsbanken und – im Fall der Staatsanleihen – der Politik vorbehalten bleibt.
8. Hedgefonds
Dieser Beitrag ist auch als Video verfügbar. Zum Link: https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-die-hedgefonds/
Fonds sind Unternehmen, die das Geld von Investoren einsammeln, um es für sie anzulegen und auf diese Weise zu vermehren. Hedgefonds tun genau das, unterscheiden sich aber in mehreren Punkten von den übrigen Fonds:
Der erste Unterschied betrifft ihre Klientel. Während gewöhnliche Fonds auch Normalverdienern offen stehen, ist das bei Hedgefonds nicht der Fall. Wer als Privatperson in einen Hedgefonds investieren möchte, muss ein extrem hohes Vermögen nachweisen. Die meisten Menschen, die ihr Geld in Hedgefonds anlegen, gehören zu den sogenannten „Ultra High Net-Worth Individuals“, also den Ultrareichen dieser Welt.
Der zweite Unterschied betrifft die Strategie. Fonds konzentrieren sich in den meisten Fällen auf bestimmte Anlagebereiche, also zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Immobilien. Hedgefonds dagegen haben keinen fest umrissenen Anlagebereich. Ihre Manager durchkämmen die Finanzmärkte ständig auf der Suche nach Gelegenheiten, um ihr wichtigstes Ziel zu erreichen – in möglichst kurzer Zeit möglichst hohe Gewinne zu machen.
Häufiger Schwerpunkt der Hedgefonds-Strategie sind Wetten auf Kursoder Preisschwankungen, und zwar nicht nur auf Ausschläge nach oben, sondern auch nach unten. Hierzu dienen insbesondere Leerverkäufe. Bei einem Leerverkauf von Aktien zum Beispiel setzt der Anleger auf fallende Kurse: Er kauft die Aktien nicht, um sie später mit Gewinn zu einem höheren Preis zu verkaufen, sondern leiht sie sich, verkauft sie sofort, wartet dann ab, bis der Kurs gefallen ist, kauft sie dann wieder auf und gibt sie an den Eigentümer zurück. Auf diese Weise lässt sich sogar aus dem Kursrückgang einer Aktie Gewinn schlagen.
Ein weiteres von Hedgefonds häufig angewandtes Mittel ist das Leveraging, zu Deutsch „die Hebelung“. Das klingt kompliziert, ist aber im Grunde ganz einfach. Ein Hedgefonds schließt hierzu eine Wette ab und leiht sich anschließend Geld, um den eigenen Wetteinsatz zu erhöhen, oft bis zum 30- oder 40-fachen Wert. Anders ausgedrückt: Leveraging heißt nichts anderes als Spekulieren auf Kredit.
Damit wären wir auch schon beim dritten großen Unterschied zwischen Hedgefonds und den übrigen Fonds: der Risikobereitschaft. Mit der Hebelung ihrer Einsätze gehen Hedgefonds hohe Risiken ein, können also nicht nur sehr hohe Gewinne machen, sondern bei Fehlspekulationen auch sehr hohe Verluste erleiden. Wie gefährlich das werden kann, hat sich schon zweimal sehr eindrücklich gezeigt: 1998 hat sich ein amerikanischer Hedgefonds namens Long Term Capital Management im Währungsbereich verspekuliert und dadurch fast das globale Finanzsystem zum Einsturz gebracht. 2008 waren Hedgefonds mit ihren Wetten entscheidend daran beteiligt, dass das System nur durch das Eingreifen der Regierungen und der Zentralbanken gerettet werden konnte.
Kommen wir zum vierten Unterschied, der Aggressivität von Hedgefonds. Auf Grund ihrer Marktmacht und ihrer kurzfristig gewinnorientierten Strategie greifen sie gern zum Mittel der „feindlichen Übernahme“. Dabei schlucken sie Unternehmen gegen den Willen von Inhabern und Mitarbeitern, führen sie aber nicht langfristig weiter, sondern weiden sie aus, verkaufen die profitabelsten Teile mit Gewinn – und hinterlassen einen Scherbenhaufen.
Der fünfte und sechste Unterschied zwischen Hedgefonds und normalen Fonds besteht in der Steuervermeidung und der Intransparenz. Hedgefonds haben ihren Sitz zumeist an den Off-Shore-Finanzplätzen dieser Welt – den Steuerparadiesen, wo sie keinen Cent an Steuern zahlen müssen und wo ihnen außerdem ein Höchstmaß an Diskretion entgegengebracht wird, was wiederum dazu führt, dass die Vermögensverhältnisse oft äußerst undurchsichtig sind.
Historisch gesehen sind Hedgefonds eine sehr junge Erscheinung. Der erste Hedgefonds wurde Ende der 1940er Jahre gegründet, danach spielten Hedgefonds mehr als drei Jahrzehnte so gut wie keine Rolle, bevor ihre Zahl in den 1980er- und 1990er Jahren explosionsartig zunahm. Die Ursache für diesen Aufschwung liegt in der seit den 1970er Jahren praktizierten Deregulierung des Finanzsystems. Dadurch, dass dem Finanzsektor immer mehr Zugeständnisse gemacht wurden, konnten Hedgefonds wie Pilze aus dem Boden schießen und immer mächtiger werden.
Sind Hedgefonds zu einer Konkurrenz für die Großbanken geworden? Nein, im Gegenteil: Da Hedgefonds wie Banken operieren dürfen, deren Einschränkungen aber nicht unterliegen, haben zahlreiche Großbanken entweder eigene Hedgefonds gegründet oder sie lassen all die Geschäfte, die ihnen nicht erlaubt sind, über Hedgefonds erledigen. Im Grunde haben Hedgefonds so zu einer Erweiterung der Macht der Banken beigetragen.
Aber nicht nur das: Hedgefonds haben die Machtkonzentration im Finanzsektor erheblich vorangetrieben, das Vermögen der Ultrareichen erhöht und die soziale Ungleichheit weltweit verschärft – und zwar ganz legal, aber auf eine Art und Weise, die sowohl wirtschaftlich als auch sozial erheblichen Schaden angerichtet hat. Während klassische Spekulanten immerhin noch versucht haben, am Erfolg von Unternehmen teilzuhaben, ist Hedgefonds deren Wohlergehen vollkommen gleichgültig. Im Gegenteil: Wenn es ihnen nützt, führen sie deren Niedergang sogar vorsätzlich herbei. Hedgefonds erfüllen somit sowohl volkswirtschaftlich als auch gesellschaftlich keinerlei nützliche Funktion, sondern dienen einzig und allein der Bereicherung von Spekulanten. Kein Wunder also, dass man sie auch als Heuschrecken oder Aasgeier bezeichnet.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.