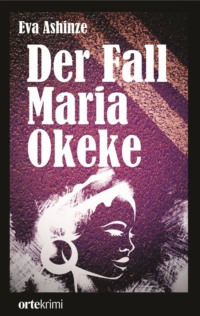Kitabı oku: «Der Fall Maria Okeke», sayfa 2
4
Zurück in meiner Wohnung mochte ich nicht einmal mehr meine letzte rituelle Zigarette vor dem Schlafengehen rauchen. Ich sank auf meine Matratze und war sofort weg.
In dieser Nacht träumte ich von meinem Vater. Er sass auf einem Holzstuhl in einem Innenhof, dessen Mauern von Bougainvillea überwuchert waren. Sein ebenholzfarbenes Gesicht war nicht mehr aufgedunsen wie früher, sondern schmal und faltig. Er trug eine Agbada, ein weites Gewand mit folkloristischem Muster. Auf seiner Schulter sass ein bunter Vogel. Mein Vater schaute finster drein. Sein strenger Blick galt mir.
«Es gibt keine Zufälle», sagte er. «Es gibt nur Gelegenheiten, die zu ergreifen man zu dumm ist, und Zusammenhänge, die wir nicht sehen.» Seine Stimme war tiefer, als ich sie in Erinnerung hatte und sein Akzent stark. «Moira, ergreife diese Chance. Bald hast du keine mehr.» Der Vogel erhob sich krächzend von seiner Schulter und flog hoch in die Luft.
Ich wachte schweissgebadet auf. Draussen war es heller Tag. Nun übernahm mein Vater den Part des allwissenden Weisen in meinen Träumen. Verdammt. Mit mir ging es bergab. Im wirklichen Leben hatte er es nicht weiter gebracht als zum Trinker und Taugenichts. Ich hatte meinen Vater vor 24 Jahren zum letzten Mal gesehen. Er war abgehauen, als ich fünfzehn war. Meine kleine Schwester war dreizehn. Sie heisst Maria. Maria und Moira. Meine Mutter musste die Namen im Vollrausch ausgewählt haben. Oder sie waren eine subtile Strafe für unsere Existenz. Schwestern Vornamen zu geben, die sich nicht nur ähnlich anhören und schreiben, sondern auch den gleichen Ursprung haben – Moira ist die gälische Form von Maria – ist, gelinde gesagt, speziell.
Irgendwie kann ich meinem Vater im Nachhinein keinen Vorwurf mehr machen, dass er Leine zog. Das Leben mit meiner Mutter war die reinste Hölle. Meine Mutter ist Alkoholikerin. Seit ich denken kann, hält sie in der einen Hand ein Glas mit einer berauschenden Flüssigkeit – Wein, Whiskey, Gin, alles läuft ihr gleich gut die Kehle runter. Meine Mutter wollte immer jemand anderer sein, als sie tatsächlich war. Wir wollen alle jemand anderer sein. Und manchmal schaffen wir es, uns selbst davon zu überzeugen. Aber dieser Zustand ist nie von Dauer. Am Ende kommt unser wahres, gebrochenes, vernarbtes Ich zum Vorschein.
Meine Mutter konnte in beliebige Rollen schlüpfen – treusorgende Ehefrau, liebende Mutter, galante Gastgeberin. Doch wir alle wussten, dass sie die Rollen nur spielte, und es brauchte nicht viel und schon war sie wieder die verbitterte und missgünstige Egoistin, als die wir sie kannten. Ein Schluck Alkohol zu viel oder zu wenig, und wir alle mussten uns in Acht nehmen vor ihrer scharfen Zunge und ihrer harten Hand. Sie scheute auch nicht davor zurück, unseren Vater zu schlagen, wenn sie wieder einmal bitter enttäuscht war von ihm, vom Leben. «Niemals hätte ich einen Afrikaner heiraten dürfen!», schrie sie bei jedem Streit. «Der isst mit den Händen und schläft mit seinen Ziegen in derselben Hütte. Und arbeiten kann er auch nicht, Mr. Afrika. Sieh mal, wie fett er geworden ist vom Nichtstun.» Mein Vater liess die Attacken über sich ergehen und spülte mit Whiskey nach. Dass er unglücklich war, konnte ich akzeptieren. Aber dass er schwach war, dafür verachtete ich ihn.
Meine Mutter stammte aus einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater war ein vermögender Holländer, der sich in der Schweiz niedergelassen und eine Industriellentochter geheiratet hatte. Mutter verachtete alle, die ihr Geld verdienen mussten. Neben ihrem Vermögen hatte sie auch eine herrschaftliche Villa an der Seidenstrasse geerbt; da fand unser Familienleben statt. Noch heute lebt meine Mutter dort, wenn gleich das Haus mittlerweile sehr heruntergekommen ist. Sie war von dem von ihren Eltern vorgegeben Lebensweg nicht abgewichen, bis sie 22 Jahre alt war. Dann liess sie ihrer ganzen angestauten Rebellion freien Lauf und heiratete meinen Vater, einen Nigerianer, der sich zu Studienzwecken in London aufhielt, wo sie ihn während eines Sprachaufenthaltes kennengelernt hatte. Diese Liaison sollte meine Mutter später bitter bereuen. Sie gab meinem Vater die Schuld daran, dass sie nicht die Grande Dame der lokalen Gesellschaft war und auch sonst keine nennenswerten Erfolge vorweisen konnte.
Mein Vater arrangierte sich mit den Gegebenheiten, so gut er konnte. Im Gegenzug für ihre Gemeinheiten gab er ihr Geld mit vollen Händen aus und hatte eine Geliebte nach der andern. Glücklich war auch er nicht. Eine Tages hatte er genug, packte seine Koffer und verliess meine Mutter und mit ihr meine Schwester und mich und ging zurück nach Nigeria. Die ersten Monate nach seinem Verschwinden erhielt ich immer wieder Briefe von ihm, in denen er sich zu erklären versuchte. Ich machte sie nicht auf. Irgendwann hörten die Briefe auf, und ich hörte gar nichts mehr. Bis vor ein paar Jahren, da erhielt ich eine Postkarte mit seiner Telefonnummer darauf. Der Mobilemarkt hatte Afrika erreicht, Halleluja. Sonst stand da nichts. Nur die Nummer und sein Name. Ich rief natürlich nicht an. Es interessierte mich nicht. Er interessierte mich nicht. Mich interessierte nur, dass er uns mit Mutter alleine gelassen hatte. Ich wünschte mir jahrelang, er möge eines qualvollen Todes sterben. Mittlerweile habe ich mit ihm abgeschlossen. Ich verstehe, dass er gegangen ist. Aber ich verstehe bis heute nicht, dass er Maria und mich zurückgelassen hat. Das kann ich ihm nicht vergeben.
Drei Jahre, nachdem mein Vater uns verlassen hatte, verschwand meine kleine Schwester. Niemand sah Maria je wieder.
5
Ich machte, was eigentlich dem Moment nach dem Sex vorbehalten ist: Ich zündete mir im Bett eine Zigarette an. Normalerweise rauche ich nur am offenen Fenster, doch dieser Traum hatte mich ziemlich aufgewühlt, so dass sich eine Ausnahme rechtfertigen liess. Danach erst sah ich auf die Uhr. Es war neun. Ich hatte immerhin sechs Stunden geschlafen. Das musste für heute reichen. Ich schwang mich aus dem Bett und stellte mich unter die Dusche. Beim Abtrocknen betrachtete ich mich im Spiegel. Ich sah müde aus. Für einen Mischling war meine Haut ziemlich dunkel und mein Haar kraus. Ich würde vielleicht als sehr helle Afrikanerin durchgehen, wären nicht meine Augen. Da hatte sich meine Mutter durchgesetzt. Meine Augen waren von einem auffallenden Grün wie die einer Katze.
«Es sind deine Augen. Damit machst du die Männer verrückt», hatte einer meiner Ex gesagt. «Und der Rest, naja, der Rest ist natürlich auch nicht übel.» Dabei hatte er mir auf den Po geklopft. Ich war mir vorgekommen wie ein Stück Vieh. Kurz darauf trennte ich mich von ihm. «Der Sex mit dir ist öde», sagte ich und klopfte ihm auf den Po. «Auch wenn gewisse Teile an dir nicht übel sind.»
Im Treppenhaus begegnete ich meinem betagten aber rüstigen Nachbarn und Vermieter, Willy Morgenroth. Sein Nachname mutet poetisch an, doch der Vorname zerstört alles. Was für unromantische Eltern muss der Kerl gehabt haben! Als Vermieter ist Willy super. Der Mietzins für meine geräumige Dachwohnung an der Rychenbergstrasse ist moderat, und ich kann in meinen vier Wänden tun und lassen, was ich will. Als Nachbar ist Willy Morgenroth ebenfalls schwer in Ordnung. Obwohl er dazu neigt, sich zu viele Gedanken und Sorgen um seine Mieter zu machen. Und da ich seine einzige Mieterin bin, trifft mich sein Wohlwollen mit voller Kraft. So auch heute.
«Moira, sind Sie krank?», fragte mich Willy.
«Nein.» Ich wollte an ihm vorbei und die Treppe runter.
«Sie sehen aber so aus.» Willys prüfender Blick musterte mich.
«Danke für das Kompliment», sagte ich. Doch Willy war immun gegen Sarkasmus.
«Ich zeige lediglich meine Besorgnis. Kommen Sie wenigstens auf einen Kaffee mit rein?» Er deutete auf seine offene Wohnungstür.
«Liebend gerne.» Ich zog an ihm vorbei. «Aber ich hab’s leider eilig», rief ich ihm über die Schulter zu.
Achselzuckend starrte er mir hinterher. Er ist zum Glück nicht empfindlich.
Am liebsten gehe ich zu Fuss in mein Büro in einem alten Backsteingebäude an der Ecke Wülflingerstrasse/Schaffhauserstrasse. Wenn ich schnell unterwegs bin, schaffe ich die Strecke in gut zehn Minuten. Nachdem ich mir in der Gemeinschaftsküche einen Espresso rausgelassen hatte, setzte ich mich an den Schreibtisch, checkte meine Mails, sah die Post durch und erledigte dies und das. Irgendwann konnte ich es aber nicht länger hinausschieben, das Telefonat mit Staatsanwalt Eckert, das ich Henry und Asim versprochen hatte. Ich griff zum Hörer. Nach ein bisschen Klatsch und Tratsch mit der Telefonistin hatte ich ihn am Apparat.
«Kollegin van der Meer, lang, lang ist’s her, seit ich die Ehre hatte», sülzte er. «Was kann ich für Sie tun, werte Kollegin?» Nie in meinem Leben würde ich einen Staatsanwalt mit «Herrn Kollega» anreden. Staatsanwälte sind die natürlichen Feinde von Strafverteidigern und Anwälten.
«Ich rufe an in der Angelegenheit Okeke. Maria Okeke.»
«Okeke, Okeke», murmelte er vor sich hin. «Ach ja, ich weiss. Der Suizid. Das Verfahren wird demnächst eingestellt, Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Aber was», fügte er hinzu, «was haben Sie bei diesem Fall verloren? Wollen Sie Geschädigtenansprüche gelten machen? Das ist so gut wie unmöglich bei Suizid, das wissen Sie.»
Ich konnte ihm sein Befremden nicht verübeln. Mir selbst war es gestern Abend ja ähnlich ergangen. «Der Vater hat mich beauftragt. Er glaubt nicht an Suizid.»
«Was glaubt er dann? Es war ein Unfall oder was?» Irgendwie erinnerte mich diese Unterhaltung ebenfalls stark an gestern Abend. «Ein Unfall kann aufgrund der Untersuchungsergebnisse so gut wie ausgeschlossen werden», fuhr Eckert fort. «Das Mädchen war sauber, keine Drogen, kein Alkohol und …»
«Nein», ich unterbrach ihn abrupt. «Mein Mandant glaubt auch nicht an einen Unfall. Er glaubt, es war Mord.»
«Mord? Sagten Sie Mord?» Eckert lachte laut. Ich schwieg demonstrativ.
Nach einer Weile riss Eckert sich zusammen. «Hören Sie, ich kann verstehen, dass der Vater nicht gerade glücklich ist über den Selbstmord seiner Tochter.»
Deswegen mochte ich Eckert nicht. Einen solchen Satz laut auszusprechen – und sei es nur gegenüber der Anwältin – zeugte von einem ausgesprochenen Mangel an Empathie.
«Aber ich war da. Ich habe das Mädchen gesehen. Ich habe die Örtlichkeit in Augenschein genommen. Ich habe mit den Autofahrern gesprochen, die, nebenbei gesagt, alle mehr oder minder traumatisiert sind von den Geschehnissen. Ich habe die Untersuchungsergebnisse studiert. Das war eindeutig Suizid.»
«Der Vater ist anderer Meinung. Er hat mich mandatiert, um entsprechende Abklärungen zu treffen. Und als Anwältin vertrete ich nun mal, wie Sie bestens wissen, die Interessen meiner Auftraggeber», sagte ich.
«Ist das wieder einmal einer Ihrer hoffnungslosen Fälle? Verdienen Sie eigentlich noch genügend Kohle neben all ihren Wohltätigkeitsmandaten, Sie Mutter Theresa unter der Anwälten?» Eckert lachte verächtlich. Ich ignorierte ihn, obwohl ich innerlich kochte.
«Geben Sie mir kurz eine Zusammenfassung, was sich in jener Nacht abgespielt hat», sagte ich.
«Eine Zusammenfassung? Sie wissen doch schon alles», erwiderte er kurzangebunden.
«Bitte», überwand ich mich zu sagen. «Ich kenne nur die Darstellung des Vaters. Ich brauche Ihre unvoreingenommene und professionelle Sicht auf die Dinge.» Nun schmeichelte ich dem Kerl auch noch! Aber es nützte offensichtlich.
«Na gut», sagte Eckert widerwillig. «Aber ich mach es kurz. Anfang März – das genaue Datum müsste ich in den Akten nachschauen – ging beim Polizeinotruf eine Meldung ein. Ein Autolenker war auf der A1 verunfallt und sein Auto hatte sich überschlagen. Die Kollegen vor Ort, zu denen ich später stiess, stellten fest, dass der Lenker sowie einige weitere Personenwagen über einen menschlichen Körper gefahren waren, der mitten auf der Autobahn gelegen hatte. Nach der Spurensicherung auf der Autobahn sowie auf der Strasse, die an dieser Stelle über die A1 führt, nach der Legalinspektion vor Ort durch den Bezirksarzt und schliesslich nach der Obduktion durch die Rechtsmedizin konnte Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Unter anderem fanden sich am Brückengeländer Fingerbadrücke des Opfers an eindeutigen Stellen, und ihre Handtasche hatte neben dem Geländer gelegen. Sie musste von dort oben gesprungen sein. Vielleicht war sie bereits beim Aufprall auf die A1 tot. Vielleicht war sie nur schwer verletzt und endgültig tot erst, nachdem sie von den Fahrzeugen überfahren worden war. Das kann nicht restlos geklärt werden. Es spielt auch keine Rolle. Aufjeden Fall ist es ein eindeutiger Fall von Suizid», schloss er. «Wenn auch mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen für die betroffenen Autolenker.»
Der Bericht des Staatsanwaltes enthielt nicht viel Neues. «Und als Grund für den Suizid vermuten Sie Schuldgefühle, weil Maria sich prostituiert haben soll», sagte ich.
«Nun ja. Die Ursache für einen Suizid zu ermitteln, gehört nicht zu den Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Aber auffällig war schon, dass das Opfer sehr spärlich und aufreizend bekleidet war. So was bekommt man sonst nur in einschlägigen Etablissements zu sehen.»
Du musst es ja wissen, dachte ich.
«Ausserdem», fuhr Eckert fort, «ausserdem wurde in ihrer Handtasche eine Karte von einer Beratungsstelle für Prostituierte gefunden. Arbeitende im Sexgewerbe heisst das heutzutage.» Er schnaubte belustigt. «Strada irgendwas heisst die Organisation.»
«La Strada.»
«La Strada, genau. Das und die Kleidung, da war der Schluss naheliegend, dass es ich um eine Prostituierte handelte. Und Sie wissen ja, Nigerianerin und Juju-Rituale und so.» Er schwieg bedeutungsvoll. «Sie wissen doch, was Juju ist.»
Ich seufzte gelangweilt. Ja, ich weiss, was Juju ist. Als Strafverteidigerin komme ich mit den seltsamsten Dingen in Kontakt. Juju ist eines davon. Ich hatte mich vor einigen Jahren in einem meiner Fälle vor Gericht als Strafbefreiungsgrund für meine Mandantin auf ein Juju-Ritual berufen. Und natürlich nicht Recht bekommen.
Im traditionellen Juju-Glauben, der vor allem in Nigeria praktiziert wird, existieren gute und böse Geister. Wird einem Gott ein Schwur geleistet und gebrochen, strafen die bösen Geister, die dead-dead, die Menschen und treiben sie in Tod und Wahnsinn. Mit diesen als schwarze Magie eingesetzten Juju-Ritualen werden Frauen kontrolliert, die nach Europa geschleust werden, um sich zu prostituieren. Die Frauen verpflichten sich vor der Abreise in einem von einem Juju-Priester durchgeführten Ritual, alle Kosten zurückzuzahlen und alles zu tun, was ihnen aufgetragen wird. Es wird eine starke psychische Abhängigkeit hergestellt.
Der Richter in meinem Fall damals war noch nicht so weit gewesen. Doch heutzutage sind die Macht des Juju und die psychische Gewalt, die dadurch auf die Frauen ausgeübt wird, auch in der Schweiz bekannt.
«Maria ist hier zur Welt gekommen», sagte ich zu Eckert. «Sie hat den Schweizer Pass. Nigeria hat sie kein einziges Mal besucht.» Das behauptete ich einfach mal. Tat aber wohl auch nichts zur Sache. «Wo bitte sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen ihrer angeblichen Prostitution und Juju? Hat allenfalls ein Voodoo-Priester aus Nigeria an der Langstrasse eine Zweigniederlassung eröffnet?»
«Hören Sie, ich habe Ihnen aus reinem Goodwill die Auskünfte gegeben, die Sie haben wollten. Der Vater hat keine Parteistellung, das wissen Sie so gut wie ich, also auch keine Rechte im Verfahren. Wär’s das also gewesen?», fragte Eckert gereizt.
«Nur noch eines: Ich brauche die vollständigen Akten», sagte ich. «Das Recht auf Akteinsicht hat er nämlich, der Vater, auch ohne Parteistellung.»
«Tja, dafür brauche ich zuerst eine Vollmacht von ihm. Danach erhalten Sie die Akten.»
«Können Sie keine Ausnahme machen? Ich könnte die Akten jetzt gleich abholen, die Vollmacht reiche ich nach.»
«Kein Ausnahme. Erst die Vollmacht. War’s das?», fragte er ungeduldig.
Ich hatte bekommen, was ich hatte bekommen wollen. Mit einer Hand hatte ich bereits begonnen, eine Mail an einen säumigen Mandanten zu schreiben. Dabei stiess ich meinen Kaffeebecher um und der Rest des Espressos tropfte auf meine beige Leinenhose. «Scheisse!», rief ich.
«Wie bitte?»
«Verdammt, habe ich das laut gesagt?», flötete ich in den Hörer. «Entschuldigung!! Die Vollmacht lasse ich Ihnen zukommen.» Ich legte auf. Immerhin hatte ich nun doch noch das letzte Wort gehabt.
6
Nur Sekunden, nachdem ich aufgelegt hatte, läutete mein Telefon. Ich kannte die Nummer auf dem Display: Es war Asim. Ich war noch immer dabei, meine Hose abzutupfen. Der Fleck war resistent gegen meine Reinigungsversuche.
«Du hast aber lange telefoniert», sagte Asim vorwurfsvoll.
«Guten Morgen, Moira. Wie geht es dir? Hast du gut geschlafen?», meinte ich ironisch.
«Guten Morgen, Moira. Wie geht es dir? Hast du gut geschlafen?», wiederholte er.
«Lass den Quatsch. Was willst du?», blaffte ich ihn an.
«Kommst du voran?», fragte er.
«Womit?» Ich spielte die Ahnungslose.
«Na, mit dem Fall. Mit Henrys Fall.»
«Asim», ich seufzte übertrieben laut. «Wann war ich bei dir im ‹Alibaba›?»
«Gestern», sagte er.
«Nein. Heute. Heute von Mitternacht bis kurz vor drei Uhr. Was erwartest du also?», fragte ich verärgert. Mein Telefonat mit dem Staatsanwalt verschwieg ich ihm wohlweislich. Goldene Anwaltsregel Nummer 1: Man sollte keinem Mandanten – oder einem Freund eines Mandanten – verraten, wie sehr man sich hinter die Sache klemmt. Ein bisschen Engagement ist in Ordnung. Zu viel, und du wirst alle zwei, drei Tage angerufen, und es wird nach Ergebnissen gefragt. Das musste man von vornherein unterbinden.
«Nun sei nicht gleich sauer», beschwichtigte mich Asim. «Ich rufe ja gar nicht deswegen an.»
«Ach nein? Weshalb dann?»
«Heute Nachmittag ist Marias Beerdigung. Henry möchte, dass du kommst.»
«Die Beerdigung ist erst heute?», wunderte ich mich.
«Maria ist vor wenigen Tagen freigegeben worden», sagte Asim.
«Natürlich, wie konnte ich das vergessen. Die Obduktion und der Gentest hatten Zeit in Anspruch genommen.»
«Kommst du also?» Es war mehr eine Aufforderung als eine Frage.
«Ich kann nicht. Ich muss arbeiten», versuchte ich mich herauszureden.
«Moira, ich bitte dich. Das dauert eine, vielleicht zwei Stunden. Es würde Henry viel bedeuten. Und mir auch.» Goldene Anwaltsregel Nummer 2: Nimm nie Aufträge von guten Freunden an. Oder von guten Freunden von guten Freunden. Du wirst emotional unter Druck gesetzt, und am Schluss kannst du nicht einmal dein volles Honorar verrechnen. Es wird unausgesprochen immer ein Freundschaftsrabatt verlangt. Es gibt auch noch die Goldene Anwaltsregel Nummer 3: Vermische nie Berufliches und Privates. Triff dich mit deinem Mandanten nur in deinem Büro, im Büro des Staatsanwaltes, im Gerichtssaal oder im Gefängnis. Triff dich nie mit deinem Mandanten in privaten Räumen oder an privaten Anlässen. So kommst du deinem Mandanten zu nahe. Und das macht dich angreifbar. Verletzlich. Leider verstosse ich regelmässig gegen eine oder mehrere der drei Regeln.
«Na gut», sagte ich zu Asim. «Ich komme.»
7
Die Beerdigung von Maria fand in der Kapelle Rosenberg statt, die beinahe zu klein war für alle Trauernden. Da waren Mitschüler, Freunde und einige ältere Frauen und Männer, von denen ich annahm, es handle sich um Marias Lehrer. Zudem viele Mitglieder der afrikanischen Gemeinde, wohl vor allem Freunde und Bekannte von Henry. Auf dem Altar stand ein grosses Foto von Maria. Eine Mitschülerin las ein Gedicht von Rilke vor. Ein Gospelchor sang zwei, drei Hymnen, und der schwarze Pfarrer sprach über Marias Leben, ihre Erfolge. Darüber, wie stolz ihr Vater auf sie gewesen war. Darüber, wie stolz die Gemeinde auf sie gewesen war. Welche Freude sie in die Welt gebracht hatte. Und darüber, wie leer diese Welt ohne Maria sei. Es war bewegend. Und traurig. Henry sass gramgebeugt da, das Gesicht vor Kummer ganz grau. Er weinte. Viele weinten.
Für meine Schwester hatte es keine Beerdigung gegeben. Es gab keine Möglichkeit, gemeinsam Abschied zu nehmen. Es gab keine Möglichkeit, gemeinsam zu trauern. Es war 1992, als Maria verschwand. Am frühen Abend des 4. Juni 1992 fuhr Maria mit dem Fahrrad zu einer Freundin. Sie trug eine verwaschene Jeans und ein pink-schwarz gestreiftes Shirt. Um die Handgelenke trug sie zehn schmale Reifen aus Goldimitat, und in den Ohrlöchern baumelten grosse Kreolen. Das krause dunkle Haar trug Maria offen, es umrahmte ihren Kopf wie eine Löwenmähne. Für die damalige Zeit war sie in unserer Kleinstadt durchaus eine aussergewöhnliche Erscheinung. Als sie davonfuhr, winkte Maria mir zu. Die goldenen Reifen klimperten. Niemand sah Maria je wieder. Es gab keine Spur, keine ernsthaften Verdächtigen, keine Hinweise. Maria verschwand und hinterliess nichts als ein Loch in der Welt, das ihren Umriss trug. Sie war aus der Welt herausgeschnitten worden.