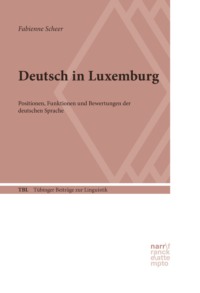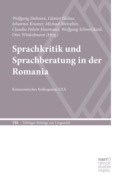Kitabı oku: «Deutsch in Luxemburg», sayfa 5
2.3 Äußerungen, Aussagen, Mentalitäten
„Wir müssen uns nicht einbilden, dass uns die Welt ein lesbares Gesicht zuwendet, welches wir nur zu entziffern haben“ (Foucault 1974/2007: 34).
Mit Foucault kann davon ausgegangen werden, dass ein als ‚Diskurs über die deutsche Sprache in Luxemburg’ re-konstituiertes Formationssystem, Einblicke in das ‚Spiel der Regeln’, in die Mentalitäten, in die Wissenssegmente verschafft, die in dieser Diskursgemeinschaft darüber befanden und befinden, welche Bedeutung der deutschen Sprache in verschiedenen Teilbereichen der luxemburgischen Gesellschaft zugestanden wird und über die Bedeutung und Funktionen von Sprache(n) entscheiden. Dieses Formationssystem, das man sich als „Fluss von Wissen durch die Zeit“ vorstellen kann, wird nur über seine Spuren, über die Äußerungen der jeweiligen Diskursteilnehmer, für eine Analyse zugänglich. Selbstverständlich umfasst es mehr als sprachliche Äußerungen und mehr als solche Äußerungen, in denen es explizit um die deutsche Sprache in Luxemburg geht. Denn Sprache hat nicht nur dort Bedeutung oder keine Bedeutung, wo man sich explizit auf sie bezieht. Ein erster Schritt wird darin bestehen, sämtlichen Hinweisen nachzugehen, die Informationen über dieses Mentalitätenwissen liefern, das bestimmt in welcher Sprache vorzugsweise geredet wird, welches Sprachwissen gefordert ist und welche Denkmuster an Sprache geknüpft werden.
Wer die Wissenssegmente aufspüren wolle, die über ein bestimmtes Thema in einer gegebenen Gesellschaft bestünden, müsse den Diskurs begreifen als das, was er sei, nämlich eine Menge von verstreuten Ereignissen, so Foucault (vgl. ebd.: 894). Ereignisse sind hier ganz allgemein Tatsachen, die ihren Ausdruck in Äußerungen finden (vgl. Jäger/Zimmermann 2010: 30). Die Unterscheidung zwischen Äußerungen (énonciations) und Aussagen (énoncés) ist bei Foucault zentral und wichtig für die methodische Vorgehensweise in diesem Buch.
Die Äußerung ist ein einmaliger Vorgang, der sich nicht wiederholt. Es ist ein Geschehnis mit spezifischen räumlichen, zeitlichen und personalen Koordinaten (vgl. Foucault 1981/2013: 148; Maingueneau 2000: 15). Wenn sich sprachliche Äußerungen, die im Geflecht diskursiver Beziehungen1 fallen, einer besonderen Funktion zuordnen lassen, und dementsprechend für die Wissensordnung eines Diskurses relevant werden, dann erlauben sie als sprachliche Manifestation Rückschlüsse auf die Aussagen, bzw. Wissenssegmente, ebendieses Diskurses:
Ganz allgemein kann man sagen, dass eine Sequenz von sprachlichen Elementen eine Aussage nur dann ist, wenn sie in ein Aussagefeld eingetaucht ist, wo sie dann als ein besonderes Element erscheint (Foucault 1981/2013: 144; eigene Hervorh.).
Keller (2011: 234) definiert die Aussage in Anlehnung an Foucault als „der typisierbare und typische Gehalt einer konkreten Äußerung bzw. einzelner darin enthaltener Sprachsequenzen, der sich in zahlreichen verstreuten Äußerungen rekonstruieren lässt“. Die Aussage ist gewissermaßen die Quintessenz, die in der Äußerung, dem Satz, Satzteil, Text, Textteil, in den Textbeziehungen, im Wort stecken kann, hinter ihnen waltet und sie verwaltet – kurz die Funktion(-en), die die sprachlichen Einheiten übernehmen (vgl. Busse 2013: 164).
Es handelt sich weniger um […] einen auf einer bestimmten Ebene der Analyse feststellbaren Ausschnitt, es handelt sich vielmehr um eine Funktion, die in Beziehung zu diesen verschiedenen Einheiten sich vertikal auswirkt und die von einer Serie von Zeichen zu sagen gestattet, ob sie darin vorhanden sind oder nicht. […] [S]ie [Anm. die Aussage] ist eine Existenzfunktion, die den Zeichen eigen ist und von der ausgehend man dann durch die Analyse sagen kann, ob sie einen ‚Sinn ergeben’ oder nicht, gemäß welcher Regel sie aufeinanderfolgen und nebeneinanderstehen, wovon sie Zeichen sind und welche Art von Akt sich durch ihre (mündliche oder schriftliche) Formulierung bewirkt findet. Man braucht also nicht zu staunen, dass man für die Aussage keine strukturellen Einheitskriterien gefunden hat. Das liegt daran, dass sie in sich selbst keine Einheit ist, sondern eine Funktion, die ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten durchkreuzt und sie mit konkreten Inhalten in der Zeit und im Raum erscheinen lässt (Foucault 1981/2013: 126; eigene Hervorh.).
Foucault bezeichnet die Aussagen auch als die „Atome des Diskurses“ (Foucault 1969/2013: 117). Sie sind die diskursbestimmenden und handlungssteuernden Wissenssegmente eines bestimmten Diskurses und werden analysierbar, wenn sie in Form von mündlichen oder schriftlichen Formulierungen zu einer Äußerung werden:
Die Aussagenanalyse kann niemals sich auf etwas anderes beziehen als auf gesagte Dinge, auf Sätze, die wirklich ausgesprochen oder geschrieben worden sind, auf Bedeutungselemente, die geschrieben oder artikuliert worden sind – und genauer auf jene Besonderheit, die sie existieren lässt […] (Foucault 1981/2013: 159).
Die Diskursanalyse analysiert dementsprechend die Möglichkeitsbedingungen für Äußerungen und deren Gestalt. Sie untersucht, warum etwas genau so und nicht anders gesagt wurde, welche Funktion eine Äußerung hat, welchem Aussagesystem sie gehorcht und was sie für den Diskurs bzw. für das Wissen über ein Thema bedeutet. Damit gelangt die Analyse zu den zentralen Aussagen, zu den Wissens- und Denkmustern, eines Diskurses. Man kann in Bezug auf Aussagen durchaus von Denk- und Handlungsmustern sprechen, schließlich betont Foucault, dass ein Kennzeichen der Aussage ihre Wiederholbarkeit sei (vgl. ebd.: 149). Wenn eine Aussage einen bestimmten Diskurs kennzeichnet, wird sie reproduziert werden. Foucaults Aussagenbegriff erscheint Angermüller (2007: 65) wie „eine Art Zwitter von Sprechakt und wiederholbarem Zeichen zu sein.“ Einerseits wird der Handlungscharakter der Aussage betont: die Aussage ist ein Fakt, hinterlässt Spuren im Diskurs und bestimmt das kollektive Wissen im Diskurs nachhaltig, konstituiert es und schreibt es weiter. Andererseits wird die Beständigkeit von Aussagen herausgestellt: als wiederkehrendes Zeichen verweist die Aussage auf anhaltende Denkmuster in einer Gesellschaft. Solche habituellen Muster des Denkens und Handelns wurden zuvor als Mentalitäten definiert.2
Die diskursive Praxis ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie der Diskurs funktioniert bzw. funktionieren darf. Sie wird mit dem Vorwissen der Diskursteilnehmer fortgeführt und durch die Progression des Diskurses gefestigt oder verändert:
Sie [Anm.: die diskursive Praxis] ist eine Gesamtheit von anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierenden Regeln, die in einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben (Foucault 1981/2013: 171).
Die Rolle, die eine Aussage in einem Diskurs einnimmt oder einnehmen darf, ihr „Anwendungsfeld“ und ihre Gültigkeit, können sich mit der Zeit verändern (vgl. ebd.: 150; 152). Der Status ‚diskursbestimmende Aussage’ „ist nie definitiv, sondern modifizierbar, relativ und kann immer in Frage gestellt werden“, schreibt Foucault (ebd.: 149).
Ein Mentalitätenwandel findet dementsprechend selten übergangslos statt und setzt dann auch nicht alle diskursiven Regeln und Verhaltensmuster auf einmal außer Kraft (vgl. Wengeler 2003: 65).3 Vielmehr werden einige Aussagen gefestigt, andere verändern sich, verlieren an Gültigkeit oder bleiben davon gänzlich unberührt. So zeigt sich die Beständigkeit von bestimmten Denkweisen darin, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg im Diskurs als Argumentationsmuster toleriert werden und in verschiedenen Äußerungen angebracht werden, um Positionen darzulegen (ebd.). Veränderungen in der Argumentation der Diskursteilnehmer deuten auf einen Wandel des Mentalitätenwissens hin. Dieser Wandel ist oft die Folge von so genannten diskursiven Ereignissen, die den einzelnen bei seiner routinemäßigen Einordnung in ein habituelles Bezugsschema stutzig werden und ihn über eine Neuauslegung des Mentalitätenwissens nachdenken lassen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 38f.). Foucault selbst definiert diskursive Ereignisse als Zäsuren, welche die bestehenden Wissenssegmente infrage stellen:
Wenn die diskursiven Ereignisse in homogenen, aber zueinander diskontinuierlichen Serien behandelt werden müssen – welcher Status ist dann diesem Diskontinuierlichen zuzusprechen? Es handelt sich dabei ja nicht um die Aufeinanderfolge der Augenblicke der Zeit und nicht um die Vielzahl der verschiedenen denkenden Subjekte. Es handelt sich um die Zäsuren, die den Augenblick zersplittern und das Subjekt in eine Vielzahl möglicher Positionen und Funktionen zerreißen (Foucault 1974/2007: 37; eigene Hervorh.).
EXKURS: Erläuterungen zu Bourdieus Habitus- und Feldbegriff
Nach Bourdieus Vorstellung ist die soziale Welt oder die soziale Praxis der Gesellschaft in Felder, man könnte auch sagen in Bereiche oder Räume, aufgeteilt (vgl. Krais/Gebauer 2002: 11). Die einzelnen Felder unterscheiden sich inhaltlich voneinander und werden durch eine eigene Ordnung oder Logik bestimmt (vgl. ebd.; Jurt 2004: 170; Bourdieu 1998: 149). Als Beispiele für solche Felder nennt er etwa das literarische, das juristische, das wissenschaftliche und das ökonomische Feld (vgl. Kajetzke 2008: 56). Krais und Gebauer (vgl. 2002: 56) führen aus, dass man nur dann von der Existenz eines Feldes sprechen kann, wenn es auch Personen gibt, die eine bestimmte Form der sozialen Praxis zu ihrem Beruf gemacht haben und diesen Beruf auf dem entsprechenden Feld ausüben. Soziale Felder spiegeln somit die vom Menschen vorgenommene Einteilung der gesellschaftlichen Praxis in arbeitsteilige Bereiche wider. Die einzelnen Felder werden von Bourdieu als Kräftefelder gedacht, in denen es um Einsätze und um das Aushandeln von Kapital geht, um Machtpotenziale und die Wahrung von Existenzen (vgl. ebd.). Damit unterteilt er die Gesellschaft in Klassen und schafft die Voraussetzung für einen Kampf um die verschiedenen Hierarchieebenen innerhalb dieser Bereiche. Nicht jedes Individuum ist auf allen Feldern aktiv, kann es aber auf mehreren sein (vgl. Bourdieu 1987/2012). Vielfach vergleicht er das soziale Feld mit einem Spiel. Auf jedem Feld gibt es Spielregeln, die dem Spieler, sofern er hier eine zentrale Rolle einnehmen will, bekannt sein müssen:
[…] die spezifische Logik eines jeden Feldes [legt] jeweils fest, was auf diesem Markt Kurs hat, was im betreffenden Spiel relevant und effizient ist, was in Beziehung auf dieses Feld als spezifisches Kapital und daher als Erklärungsfaktor der Formen von Praxis fungiert (ebd.; Hervorh. im O.).
Die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, also Felder, stellen unterschiedliche Anforderungen an denjenigen, der sich auf ihnen bewegt. Es wird ein jeweils anderes Handlungswissen verlangt und mit je spezifischem Kapital bezahlt.1 Dieses Wissen, von dem in Bezug auf das Mentalitätenwissen in dieser Arbeit gesprochen wird, ist ein erlerntes Denk- und Handlungswissen, das zum Habitus wird und es ist symbolisches Kapital, da sein Vorhandensein über den sozialen und beruflichen Aufstieg und über gesellschaftliche Akzeptanz mitentscheidet (vgl. Kajetzke 2008: 58f.). Sprachen als Bestandteil dieses Wissens können auf den einzelnen Feldern nicht nur Ausdrucksmittel sein, sondern zugleich den Stellenwert der Währung erhalten. So können Sprachkenntnisse auf manchen Feldern über berufliches Vorankommen entscheiden, aber auch die Kenntnis der Sprachverhaltensmuster auf den einzelnen Feldern kann Kapitalwert haben.2 Die habituellen und erwünschten Spracheinstellungen und Sprachverhaltensmuster divergieren von Feld zu Feld.
IV. Untersuchungskriterien
Das Verständnis von Diskurs als regulierter Praxis erlaubt es den Diskurs als ein Arrangement von Wissen und eine sich zugleich zeigende Praxis zu verstehen und ihn auf diese Weise zu untersuchen. Im empirischen Teil der Arbeit wird auf vergangene Aussagen zurückgeblickt, die in der Presse und in Fachkreisen über die luxemburgische Sprachensituation fielen und auf diese Weise dem Mentalitätenwissen der Diskursteilnehmer, den Veränderungen und Anpassungen dieses Wissens nachgespürt. Das Verständnis des Foucaultschen Formationssystems als „Fluss von Wissen durch die Zeit“ ermöglicht es ergänzend dazu Material, wie Buchbestsellerlisten, Kinoprogramme, Werbeanzeigen, Statistiken und Schreibproben von Schülern als zusätzliche Manifestationen dieses Wissens zu analysieren und zu zeigen wie Sprachhandeln funktioniert. Zudem werden die Praktiker1 auf den verschiedenen Feldern der Gesellschaft ‚zum Sprechen gebracht’, indem ihre Position in Form von zu diesem Zweck geführten Experteninterviews berücksichtigt wurde.
Die vorliegende Publikation unternimmt und motiviert so auf verschiedenen Diskursebenen, auf der Laien-, Medien-, Experten- und fachwissenschaftlichen Diskursebene, eine Wiederherstellung des Diskurses über die deutsche Sprache und über Sprachen in Luxemburg bzw. die Wiederherstellung der einzelnen Teildiskurse, die mit diesem Thema zusammenhängen. Sie rekonstituiert ein Formationssystem, das als ‚Diskurs über die deutsche Sprache in Luxemburg’ definiert werden kann und den Zeitraum von 1983 bis 2015 abdeckt.
Mithilfe eines plurimethodischen Zugangs werden Einblicke in das Mentalitätenwissen gewährt, in die Wissenssegmente, die in dieser Diskursgemeinschaft darüber befanden und befinden, welche Bedeutung der deutschen Sprache in verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft zugestanden wurde und wird, und welche Bedeutung und welche Funktionen die übrigen in Luxemburg vorkommenden Sprachen einnehmen.
1 Beschreibung des Untersuchungskorpus und des Analysezeitrahmens
1.1 Medienkorpus
Eine zentrale Herausforderung der Arbeit bestand in der Auswahl des Analysematerials. Es ging darum die zentralen Aussagen der luxemburgischen Diskursgemeinschaft zu sammeln, um herauszufinden, welchen Stellenwert sie der deutschen Sprache in der Vergangenheit zugestanden hat und gegenwärtig beimisst.
Methodologisch und forschungspraktisch schien es vorteilhaft auf Pressetexte zurückzugreifen: Sie geben zum einen Ausschnitte aus der Wirklichkeit wieder, zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass Pressebeiträge in bedeutsamer Weise auf die Meinungsbildung in Luxemburg einwirken und sich die Meinung der Bevölkerung wiederum über Leserbriefe in der Presse artikuliert – gerade in Luxemburg, so möchte man mit Hilgert (2004: 3) meinen, der das Land als eine „Nation von Zeitungslesern“ bezeichnet. Außerdem lässt sich ein Diskurs über die deutsche Sprache in Luxemburg auf der Basis von Pressetexten zum Thema chronologisch rekonstituieren. Diese Form der Korpuszusammenstellung wurde in linguistischen Diskursanalysen bereits mehrfach erfolgreich erprobt.
Berichte, Kommentare, Leitartikel und Leserbriefe, die sich in direkter oder indirekter Weise mit der deutschen Sprache auseinandersetzen und sich auf die allgemeine Sprachsituation im Land beziehen, werden zu einem Untersuchungskorpus zusammengefügt, das Schlussfolgerungen zum synchronen und diachronen Stellenwert der deutschen Sprache in Luxemburg erlaubt. Auf Basis dieses ermittelten Korpus geht es darum, die in den gesammelten Texten wiederkehrenden Aussagen oder auch Wissenssegmente zu ermitteln und zu beschreiben.
Es war zunächst vorgesehen über den Zeitraum Januar 1984 (Verabschiedung des Sprachengesetzes in Luxemburg) bis Dezember 2012 (Februar 2012 war Projektbeginn) die Ausgaben des Luxemburger Worts, als Tageszeitung mit der größten Leserschaft in Luxemburg, des Lëtzebuerger Lands als politisch weitestgehend unabhängige Wochenzeitung sowie des Le Jeudi als französischsprachige Wochenzeitung, zu durchsuchen.1 Von vornherein war klar, dass die Texte, die später analysiert werden sollten, in unterschiedlichen Sprachen verfasst sein würden.2 Mitte März 2012 begann ich mit der Sichtung des Luxemburger Worts (LW) im Archiv des Herausgebers der Zeitung Saint-Paul. Ich blätterte alle gebundenen Papierausgaben dieser Zeitung von Januar 1983 bis Dezember 1999 durch. Um die Diskussionen im Vorfeld des Sprachengesetzes zu berücksichtigen, erwies es sich als sinnvoll die Zeitungen aus dem Jahr 1983 mit zu betrachten. Alle relevanten Artikel wurden in einer Tabelle notiert. Die zurückbehaltenen LW-Artikel der Jahre 1983 bis 1999 habe ich dann vor Ort am Mikrofilmlesegerät kopiert. Alle LW-Ausgaben, die ab dem Jahr 2000 erschienen sind, sind digitalisiert und in einer elektronischen Datenbank bei Saint-Paul gespeichert. Die Datenbank kann nach bestimmten Kriterien durchsucht werden. Die Durchsicht der Jahre 2000 bis 2012 war somit schnell beendet. Eine Liste mit relevanten Stichwörtern (deutschen und französischen) wurde für die Suche in der Datenbank aufgestellt. Auf die Sichtung des Luxemburger Worts folgte die des Lëtzebuerger Lands. Zunächst wurden die Jahre 1983 bis 1999 in den gebundenen Papierausgaben nach relevanten Artikeln durchsucht. Es war nicht möglich sämtliche zurückbehaltenen Artikel am Mikrofilmlesegerät zu kopieren, da die Wochenzeitung im Archiv von Saint-Paul nicht vollständig auf Mikrofilm zur Verfügung stand.3 So entschied ich alle bis 1999 zurückbehaltenen Artikel aus den gebundenen Ausgaben abzufotografieren, was die Lesbarkeit der Artikel deutlich reduzierte. Die restlichen Artikel aus den Publikationsjahren 2000–2012 wurden über das Onlinearchiv des Luxemburger Lands aufgefunden und ausgedruckt. Die Wochenzeitung Le jeudi (Verlagshaus Editpress) war weder bei Saint-Paul noch bei ihrem Herausgeber in Esch-Alzette auf Mikrofilm verfügbar und musste so komplett in den gebundenen Ausgaben durchsucht und relevante Artikel anschließend abfotografiert werden. Die Zusammenstellung des Pressekorpus konnte im Dezember 2012 abgeschlossen werden. Das gesamte Korpusmaterial wurde sodann von mir thematisch und chronologisch nach Themen in Teildiskurse geordnet.
Auch wenn das Jahr 2012 anfangs als provisorischer Abschluss der Materialsuche angesetzt worden war, d.h. Meldungen und Ereignisse, die nach 2012 medial vermeldet und verarbeitet wurden, nicht mehr systematisch in das Korpus aufgenommen wurden, hatte ich stets die Tagesaktualität im Blick. Temporäre Schlussfolgerungen veränderten sich durch diese. Die beständige Erweiterung brachte mit sich, dass das Medienkorpus zwar auf den drei Zeitungen Luxemburger Wort, Lëtzebuerger Land und Le jeudi basierte, jedoch schlussendlich Texte aus diversen Luxemburger Medienorganen (wie etwa RTL, L’essentiel und Tageblatt) beinhaltete. Die Untersuchung fußt am Ende auf einem Medienkorpus von 835 Texten – neben Pressetexten zählen dazu auch Onlineberichte und Radiobeiträge. Das Korpus deckt den Zeitraum 1983–2015 ab. Es dient der Arbeit in weiten Teilen als Hintergrundinformation, konturiert die Arbeit und stellt Ereignisse aus über 30 Jahren wieder her. Verglichen mit der Menge an Artikeln, die sich im Korpus befanden, werden in der Publikation schlussendlich nur wenige direkt zitiert. Die zitierten Presseartikel stehen immer exemplarisch also stellvertretend für Meinungen, hier Diskursaussagen, die als Äußerungen in vielen Artikeln auftauchten und die sich bei der Durchsichtung und Lektüre des Pressekorpus als den Diskurs bestimmend erwiesen haben.
1.2 Erweiterung des Materials um Experteninterviews
Nach den ersten Recherchewochen im Gaspericher Archiv zeigte sich, dass eine Analyse, die sich einzig auf die Untersuchung von Medientexten beschränkt, der Zielsetzung der Arbeit nicht gerecht wird: In den Zeitungen tauchen nur bestimmte Teildiskurse und Argumentationsmuster auf, die es zwar ermöglichen Bewertungen der deutschen Sprache in Luxemburg zu entschlüsseln und erste Vermutungen über die Denkmuster der Gesamtgesellschaft anzustellen, die allerdings gleichermaßen vieles im Verborgenen lassen. Dazu gehört beispielsweise eine Antwort auf die Frage, inwieweit Bewertungen einer Sprache tatsächlich Auswirkungen auf deren Positionen und Funktionen innerhalb der Gesellschaft nehmen. Ferner wird im Mediendiskurs ein ‚Domänenwissen’ der Luxemburger Bevölkerung verhandelt, das in vielen Fällen schon nicht mehr dem faktischen Sprachhandeln auf den verschiedenen sozialen Feldern entspricht. Um das Mentalitätenwissen zu untersuchen – nicht nur das Arrangement von Wissen, sondern auch das faktische Sprachverhalten – ist es notwendig, sich den ‚Praktikern’ auf diesen sozialen Feldern weiter anzunähern.1 Ergänzend zum Medienkorpus wurden daher auch Experteninterviews durchgeführt, die die Befunde der Arbeit näher an die Praxis des Sprachhandelns heranrückten. Wissenssegmente werden folglich nicht mehr nur aus der Perspektive der Medien analysiert, sondern unter Beteiligung derjenigen, die sich auf den einzelnen Feldern bewegen, über die diskutiert wird. Die Experten sind ‚Zeugen’ oder in Anlehnung an Foucault ‚Praktiker’ der uns interessierenden Prozesse (vgl. Gläser/Laudel 2010: 12). Der Begriff Experte beschreibt nach Gläser/Laudel (ebd.) „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode dieses Wissen zu erschließen.“ Menschen, die aufgrund ihres Berufsfeldes direkt oder indirekt mit der luxemburgischen Sprachensituation in Berührung kommen und auf ihrem Gebiet den Status des ‚Experten’ verdienen, gewährten mir Einblicke in ihren Arbeitsalltag und halfen somit der Beantwortung der Forschungsfrage näherzukommen. Zum Teil arbeiten sie in herausgehobenen Positionen und haben im Land einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, letztlich war es für ihre Auswahl aber nur wichtig, dass sie über ein fundiertes Wissen auf ihrem Gebiet verfügen und mich daher in die Sprachverhaltensstrategien auf ihren Feldern einweihen konnten (vgl. ebd.: 13). Insgesamt habe ich 22 Experteninterviews in Form von Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Leitfäden wurden von mir für das jeweilige thematische Feld erarbeitet (Bildung, Immigration, Sprach(en)politik, Medien, Literatur, Öffentlichkeitsarbeit …) und auf den Interviewpartner individuell zugeschnitten. Um das Interview so nah wie möglich an einem natürlichen Gespräch zu halten, wurden die Fragen als Richtschnur betrachtet und in der Reihenfolge gestellt, wie es der Verlauf des Gesprächs ergab (vgl. ebd.: 42). Manche kamen auch erst im Gespräch auf. Sämtliche Gespräche, bis auf drei, die auf Deutsch geführt wurden, fanden auf Luxemburgisch statt, weil davon ausgegangen wurde, dass Befragte in der Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen, am offensten sind.
Die Interviewpartner wurden bei der ersten Kontaktaufnahme über die Ziele der Untersuchung und ihre mögliche Rolle als Experten für ihre berufliche Domäne aufgeklärt. Während des Interviews, das in der Regel an ihrem Arbeitsplatz stattfand, habe ich sie noch einmal über das wissenschaftliche Themenspektrum meines Forschungsprojekts in Kenntnis gesetzt. Erläuterungen zum Ablauf des Interviews wurden zu Beginn gegeben. Die Gespräche wurden unter Einwilligung der Beteiligten aufgezeichnet.2 Da sie als domain experts fungierten, wollte ich ihre Namen nicht anonymisieren. Nur im Bereich des Bildungsdiskurses wurde vereinzelt auf die namentliche Nennung der Lehrkräfte verzichtet.3 Daneben wurden Personen, von denen nur wenige Informationen benötigt wurden, aus Zeitgründen telefonisch oder per Mail befragt. Eine zusätzliche und umfangreiche Befragung erfolgte mithilfe eines Fragebogens zum Themenkomplex ‚Politische Kommunikation auf der kommunalen Ebene’. Er wurde von mir an eine Auswahl der, zu diesem Zeitpunkt, 106 Gemeinden Luxemburgs verschickt. Die Antworten aus 13 Gemeinden flossen schlussendlich in die Analyse mit ein. Die Teildiskurse, die ich anhand des Medienkorpus provisorisch festgelegt hatte, zeigten zu welchen Themenkomplexen Experten befragt werden mussten.
| Themenkomplexe/Teildiskurse | Expertengespräche mit |
| Deutschunterricht im Sekundarunterricht | Romain Dockendorf. Deutschlehrer am Lycée classique de Diekirch (LCD)Marie-Rose Wirtz. Deutschlehrerin am LCD, langjährige Unterrichtserfahrung in den ALLET-KlassenRobert Gollo Steffen. Deutschlehrer am LCD, Musiker und Inhaber des Literaturverlags Op der LeyFernand Weiler. Deutschlehrer am LCDJeannot Kettel. Geschichtslehrer am LCD |
| Der Deutschunterricht im technischen Sekundarunterricht. Deutsch als Unterrichtssprache. Deutsch als Zweitsprache/Intensivsprachkurse | Martine Hummer. Deutschlehrerin am Lycée technique du Centre (LTC) (DAF- und DAZ-Unterricht)Wilfried Jansen. Chargé de cours am LTC (Fach: Deutsch/DAF/DAZ)Antoinette Maas. Stellvertretende Direktorin am LTC, verantwortlich für die classes d’insertion, classes à régime linguistique spécifique, bac internationalDamjana Sulina Zorko. Chargée de cours am LTC (Fach: Deutsch/DAF/DAZ)Nadine Vandivinit. Deutschlehrerin und Koordinatorin für das Fach Deutsch am deutsch-luxemburgischen Schengen-LyzeumMailaustausch mit zwei Sekundarschullehrerinnen (anonym)Mailaustausch mit Colette Kutten über die Entstehung des Deutschbuches ‘Das Eselsohr’ |
| Deutsch als Alphabetisierungssprache in Luxemburg. Deutsch als Unterrichtssprache für Migrantenkinder | Astrid Neumann. Cours d’accueils in Wiltz. Mitverantwortlich für die Ausarbeitung des landesweiten Lehrplans der cours d’accueils beim BildungsministeriumAline Soisson-Schumacher. Cours d’accueils in Esch/AlzetteGruppeninterview mit drei Grundschullehrerinnen (anonym)Mailaustausch mit einer Grundschullehrerin (anonym)Telefon- und Mailaustausch mit Robi Brachmond (Ministère de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse, Service de l’enseignement fondamental, Programmes et matériel didactique, législation (organisation), pédagogie) |
| Sprachcurriculare Bedeutung der Vorschule | Austausch mit einer Vorschullehrerin (anonym) |
| Sprache und Kultur | Diane Krüger. Stellvertretende Direktorin beim Institut Pierre Werner |
| Literatursprachen – Sprache und Literatur | Rob Kieffer. Chefredakteur Éditions Binsfeld (Binsfeld als Verlagshaus, Werbeagentur, Eventagentur sowie Agentur für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement)Telefonaustausch mit Valérie Schreiner. Von 2010 bis 2014 Lektorin bei Éditions Binsfeld, 2015–2016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die EU-Präsidentschaft Luxemburgs beim Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, freie LektorinRobert Gollo Steffen. Verlag op der Ley |
| Sprache und Integration | Laura Zuccoli. Präsidentin der ASTI4 |
| Sprache und Politik; Sprache und Gesellschaft | Fragebögen an die GemeindenTelefonaustausch mit Claudine Muller, stellvertretende Direktorin am Centre de Logopédie Luxembourg.Austausch mit Laurence Mousel, Anwältin bei der Kanzlei Bauler & LutgenHubertus von Morr. Ehemaliger deutscher Botschafter in LuxemburgLex Roth. Gründungspräsident, heute Vizepräsident der Actioun Lëtzebuergesch, hat sich auf vielfältige Weise für die Entwicklung und Anerkennung der luxemburgischen Sprache eingesetzt und wurde dafür mehrfach vom Luxemburger Staat ausgezeichnet |
| Printmedien | Claude Karger. Chefredakteur Lëtzebuerger JournalRoger Infalt. Chef der Lokalredaktion Tageblatt, Präsident des Presserates, Präsident der Association luxembourgeoise des journalistes |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | Olivier Mores. Kommunikationsbeauftragter bei Post LuxembourgRob Kieffer. Chefredakteur Éditions Binsfeld |
Tabelle 1:
Übersicht über die durchgeführten Experteninterviews5