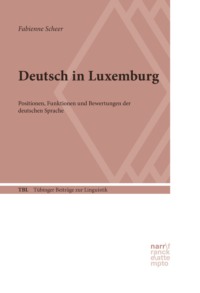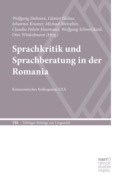Kitabı oku: «Deutsch in Luxemburg», sayfa 4
1.2.2 Wissensgewinnung und Wissensvermittlung über die Sprache
Der Zusatz von Peter Dinzelbacher (1993: XXIV) – „Mentalität manifestiert sich in Handlungen“ – ist hier für die Verbindung von Theorie und Methode von zentraler Bedeutung: Die Handlungen, an denen sich das Mentalitätenwissen einer Zeit abzeichnet, können über die Sprache, mit der sie vollzogen wurden, wiederhergestellt werden und lassen sich folglich auf diese Weise untersuchen. Es ist die Sprache, über die Wissen wieder- und weitergegeben wird, sich Wissen manifestiert und konstituiert, in Texten oder Gesprächen materialisiert und damit greifbar und analysierbar wird.
Empirische Sozialwissenschaft muss sich für Texte interessieren, weil ihr Gegenstand ihr in Texten gegenüber tritt und weil sie die Aussagen über ihren Gegenstand an nichts anderem als an Texten überprüfen kann (Wernet 2009: 11).
So wird in Anlehnung an Viehöver/Keller/Schneider (2013: 9), Felder/Müller (2009: 5) und Felder (2009: 21–77) die Sprachlichkeit der Wissenskonstituierung betont: Wissen entsteht über Kommunikation, Wissen wird verwahrt über Kommunikation und Wissen verändert sich über Kommunikation. Mit den genannten Autoren wird auch die Gesellschaftlichkeit der Sprache unterstrichen: Sprache kann nicht unabhängig von gesellschaftlichen Erfahrungen existieren. Sie wird im sozialen Kontext praktiziert und verändert sich in diesem Kontext. Deshalb eignet sich die zunächst abstrakt erscheinende Einheit ‚Diskurs’, um „das Netz aller in einer Gesellschaft möglichen Aussagen zu einem bestimmten Thema […] einschließlich der gesellschaftlichen Perspektiven, Normen, Interessen und Machtverhältnisse“ auf einer vierten Ebene1 zu erfassen (vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 2004: 290). Die Rekonstruktion eines Diskurses erlaubt es, eine Vielzahl an sprachlichen Handlungen – die den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit mit dem entsprechenden Titel ‚Deutsch in Luxemburg’ bilden – zu erfassen und dabei kollektives Sprachwissen und Sprachhandeln zu untersuchen. Warnke/Spitzmüller (2008: 42) führten aus, dass es
[d]as Ziel vieler diskursanalytischer Arbeiten ist […], Ideologien oder Mentalitäten freizulegen. Ob eher das eine oder das andere im Mittelpunkt steht, hängt unter anderem auch von der fachgeschichtlichen Tradition ab, in der die jeweiligen Analysen stehen. Im Umkreis der germanistischen Diskursgeschichte bzw. Diskurssemantik ist eher das aus der französischen (Annales-)Historiographie stammende Konzept der Mentalität wichtig geworden, in der angelsächsischen Diskurslinguistik sowie in der Kritischen Diskursanalyse eher das Konzept der Ideologie, das dort stark von der linguistischen Anthropologie geprägt wurde.
Öffentliche sprachliche Manifestierungen sind zugleich Praxis (Produzent/Produktion) und Arrangement (Abbildung und Ordnung) dieses Wissensbestandes.2 Die Sprache informiert über das Wissen (im vorliegenden Fall über Sprachwissen) und sie ist zugleich am Erschaffen neuen Wissens beteiligt bzw. motiviert zu einem bestimmten Verhalten (hier zu einem bestimmten Sprachhandeln). So werden über sprachliche Manifestierungen (Gesprächsauszüge, Texte, etc.) die Bedeutungen und Bewertungen, die in der luxemburgischen Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit einer oder mehreren Sprachen beigemessen werden, zugänglich.
2 „Archäologie des Wissens“ – Linguistische Diskursanalyse und die empirische Analyse und Rekonstruktion von Wissensbeständen
„Ich will nicht unterhalb des Diskurses das Denken der Menschen erforschen, sondern ich versuche, den Diskurs in seiner manifesten Existenz zu erfassen, als eine Praxis, die Regeln gehorcht. Regeln der Formation, der Existenz, der Koexistenz, Systemen des Funktionierens usw. Diese Praxis in ihrer Koexistenz und nahezu in ihrer Materialität, ist es, die ich
beschreibe.“ (Foucault 1969: 982).
2.1 Erschließung des Foucaultschen Diskursbegriffs
Der Begriff ‚Diskurs’ wird in der deutschen Wissenschaftssprache nicht einheitlich verwendet. Das gilt auch für die Diskursanalyse als wissenschaftliche Untersuchungsmethode. Die Methoden der Diskursanalyse und die Diskurskonzepte unterscheiden sich von Disziplin zu Disziplin und auch innerhalb der Fachgrenzen von Forschungsgegenstand zu Forschungsgegenstand. Die Diskurslinguistik ist gegenwärtig ein Sammelbegriff unter den Sprachanalysen gefasst werden, die sich (vor allem) mit dem beschäftigen, was über die Wort-, Satz-, und Textebene hinausgeht und die sich mit der gesellschafts- und wissenskonstituierenden Funktion von Sprache befassen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 10). Ein Forschungsprojekt, das einen der vielen Diskursbegriffe, eine der vielen Diskurstheorien und eine der zahlreich vorhandenen Diskursmethoden appliziert, kommt nicht umhin zunächst das eigene Diskursverständnis darzulegen.
Das deutsche Lexem ‚Diskurs’ findet Anfang des 16. Jahrhunderts durch französische Vermittlung Eingang in den deutschen Sprachgebrauch (vgl. Pfeifer 2005: 230). Etymologisch leitet sich das Wort von mittelfranzösisch/französisch discours, aus spätlateinisch discursus ab (= ‚Verkehr, Umgang, Gespräch’ ; lat. discurrere ‚auseinanderlaufen’, ‚sich ausbreiten’; spätlat. ‚etwas mitteilen’) (vgl. ebd.). Der deutsche Diskursbegriff wird, wie auch sein französisches Pendant, bis ins 20. Jahrhundert hinein gleichbedeutend mit ‚wissenschaftliches Gespräch’‚ ‚wissenschaftliche Abhandlung’ oder auch ‚gelehrte Disputation’ gebraucht (vgl. Warnke 2007: 3; Heinemann 2011: 33). Neben dieser Bedeutung wird Diskurs ab dem 17. Jahrhundert auch als Quasisynonym zu ‚Konversation’ verwendet (vgl. ebd.).
Seit den 1970er Jahren wird der Diskursbegriff in der Mediensprache gebraucht. Er taucht dort zunächst im Feuilleton auf, später dann in sämtlichen Ressorts als Quasisynonym für ‚Debatte’ ‚Dialog’, ‚Gespräch’ oder ‚öffentlicher Meinungsaustausch’ (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 6, 9). Über die Medien erfährt der Diskursbegriff eine massive Bedeutungserweiterung, etabliert sich im Bildungswortschatz, um dann Eingang in die Umgangssprache zu finden (vgl. ebd.: 6). Dadurch verliert er erheblich an Prägnanz:
Wie so oft ist aus einem neuen oder neu definierten Begriff, aus einem Codewort, das nur von wenigen und sehr gezielt verwendet wurde, nach einer Periode der Abwehr ein Allerweltsbegriff geworden, den man fast schon wie eine abgenutzte Münze in die Hand nimmt, ohne ihn näher zu betrachten (Schöttler 1997: 134).
Von einem Diskurs wird heute gesprochen, wenn das (Haupt)-Thema einer öffentlichen Debatte bezeichnet wird (Krisendiskurs, Stammzellendiskurs etc.) und/oder die unterschiedlichen Träger solcher Debatten benannt werden (Mediendiskurs, politischer Diskurs, juristischer Diskurs, Laiendiskurs etc.) (vgl. auch Heinemann 2011: 32). Der Begriff erlaubt die Eingrenzung des Bereichs, in dem diskutiert wird (Bildungsdiskurs, Literaturdiskurs, Werbediskurs u.a.) (vgl. ebd.).
Alle Diskursverständnisse haben als gemeinsame Grundbedeutung die öffentliche „Praxis des Denkens, des Schreibens, Sprechens und Handelns“ (Parr 2008: 234). Insofern ist der Diskursbegriff genuin linguistisch. Er bezieht sich auf Kommuniziertes (vgl. Jung 1996: 453). Hinter dem wissenschaftlichen Diskursverständnis stehen umfangreiche Konzepte einzelner Denker, die wiederum sehr heterogen rezipiert und weitergedacht wurden. Das Diskursverständnis von Michel Foucault und die an seine Schriften angelehnte linguistische Lesart eines Diskurses, prägen die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit. Sie ermöglichen die Erfassung von Wissenssegmenten über die Analyse von Äußerungen. Foucault selbst regte dazu an, aus seinen Ausführungen die theoretischen Begrifflichkeiten zu entnehmen und Methoden zu entwickeln, die sinnvoll erscheinen, um „[…] das handlungsleitende und sozial stratifizierende kollektive Wissen bestimmter Kulturen und Kollektive zu erschließen“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 8). Die Diskurslinguistik im Anschluss an Foucault hat bis heute keine einheitlichen Definitionen und Verfahrensweisen. Es gibt mehrere Theorieverständnisse (und damit einhergehend unterschiedliche Methoden), verschiedene Schulen1, die sich im Verlauf der letzten Jahre entwickelt haben und die Schriften Foucaults unterschiedlich stark gewichten. Der Sammelband Diskurslinguistik nach Foucault (Warnke 2007) war bedeutsam für die Etablierung einer Diskurslinguistik im deutschsprachigen Raum. Andreas Gardt (2007: 30) fasste dort das linguistische Diskursverständnis wie folgt zusammen:
Ein Diskurs ist die Auseinandersetzung mit einem Thema, – die sich in Äußerungen und Texten der unterschiedlichsten Art niederschlägt, – von mehr oder weniger großen gesellschaftlichen Gruppen getragen wird, – das Wissen und die Einstellungen dieser Gruppen zu dem betreffenden Thema sowohl spiegelt – als auch aktiv prägt und dadurch handlungsleitend für die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirkt.
Da die Diskurslinguistik gesellschaftliche Kommunikation analysiert und die damit verbundene gesellschafts- und wissenskonstituierende Funktion von Sprache zumindest in ihren Ansätzen erschließen will, hat sie ihren legitimen Platz als Theorie und/oder als Methode innerhalb der Linguistik (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 10). Das Diskursverständnis der folgenden Arbeit soll nun in diesem und im darauffolgenden Kapitel IV. dargelegt werden. Begonnen wird mit Foucault und mit den theoretischen Begriffen, die aus seinem ‚Werkzeugkasten’ für die Zielsetzungen der Arbeit entnommen wurden.
2.2 Diskurs und Wissen bei Foucault
„Alle meine Bücher … sind kleine Werkzeugkisten. Wenn die Leute sie aufmachen wollen und diesen oder jenen Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als Schraubenzieher verwenden [wollen], […] nun gut, umso besser“ (Foucault 1976: 53).
Foucault hat sein Diskurskonzept mit dem Ziel formuliert, eine Kategorie zu schaffen, die es ihm erlaubt das Wissen und Denken der Gesellschaft zu erforschen (vgl. Busse 2013: 147). Seine Methoden, die er in Schriften wie Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft (1961/dt. 1969) oder Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (1975/1976) applizierte, versuchen in unvoreingenommener Weise Wissen zu re-konstituieren und offenzulegen. Aus diesen Schriften lassen sich Methoden und Theorien ableiten, die Anreize für die Weiterentwicklung seines Denkens zu einer linguistisch geprägten Diskursanalyse bieten (vgl. Jäger 2012: 8). Verschiedene seiner Überlegungen werden für die vorliegende Arbeit ausgewählt und die Gedankengänge der Arbeit konturieren. Sie werden zu einer Methode führen, die es erlaubt die Bedeutung der deutschen Sprache in Luxemburg zu erschließen (s. a. Kapitel IV.).
Foucaults Sicht auf die „stumm[e] Ordnung“ (Foucault 1974/2012: 23) des Denkens und die Bedeutungsebenen seiner Terminologie verändern sich mit den einzelnen Stadien seines Schaffens (vgl. Sarasin 2005: 71). Die Terminologie entwickelt sich in den Werken weiter und ist geprägt von der Zeit, in der er seine Ausführungen niederschreibt (vgl. Jung 1996: 454). Dementsprechend hätte Foucault seinerzeit sicher nicht als erstes die Sprachwissenschaftler gebeten, ihm bei der Analyse eines Diskurses behilflich zu sein, „da mein [sein] Problem ja kein sprachliches ist [war]“ (Foucault 1977: 396). Er erklärt, man solle Diskurse nicht:
[…] als Gesamtheiten von Zeichen (von bedeutungstragenden Elementen, die auf Inhalte oder Repräsentationen verweisen), sondern als Praktiken […] behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muss man ans Licht bringen und beschreiben (Foucault 1968/2001: 74).
Diskurse sind Foucault zufolge mehr als Sprache und zwar mehr als Sprache im Sinne von Zeichen:
[…] Sprache und Aussage stehen nicht auf der gleichen Existenzstufe […] (ebd.: 124).
Sprache wird von ihm strukturalistisch gedacht, als organon didaskaleion mit dem ‚einer dem anderen etwas mitteilt über die Dinge’.1 Foucault interessiert nur das Wissen, das via Sprache transportiert wird, nicht das Medium Sprache an sich. Ihm ist aber bewusst, dass dieses nur über die Analyse von Kommuniziertem zugänglich wird:
Unser geschichtliches Schicksal ist die Historie, die geduldige Konstruktion von Diskursen über Diskurse, ein Einvernehmen dessen was schon gesagt worden ist (Foucault 1973: 14, eigene Hervorh.).
Die Archäologie des Wissens2 wird zumeist als stringente und in sich schlüssige Gebrauchsanweisung für eine Diskursanalyse nach Foucault gehandelt. Bei genauerem Hinsehen ist das Werk aber eher die diffuse Werkzeugkiste eines Autors, die den Vermerk ‚travail en cours’ tragen müsste.3 Foucault erklärt dort, wie sich seine Vorstellung von Diskurs/-en veränderte:
Schließlich glaube ich, dass ich, statt allmählich die so schwimmende Bedeutung des Wortes ‚Diskurs’ verengt zu haben, seine Bedeutung vervielfacht habe: einmal allgemeines Gebiet aller Aussagen, dann individualisierbare Gruppe von Aussagen, schließlich regulierte Praxis, die von einer bestimmten Zahl von Aussagen berichtet; und habe ich nicht das gleiche Wort Diskurs, das als Grenze und als Hülle für den Terminus Aussage hätte dienen sollen, variieren lassen, je nachdem ich meine Analyse oder ihren Anwendungspunkt verlagerte und die Aussage selbst aus dem Blick verlor? (Foucault 1981/2013: 116, eigene Hervorh.)
Er benennt drei Bestimmungsversuche, die für die Arbeit von Bedeutung sind. So definiert er erstens den Diskurs als „allgemeines Gebiet aller Aussagen“. Am Anfang der ‚Archäologie des Wissens’ spricht er vom „immensen Gebiet […] aller effektiven Aussagen (énoncés) (ob sie gesprochen oder geschrieben worden sind, spielt dabei keine Rolle)“ (ebd.: 41). Sämtliche Aussagen, also „eine Fülle von Ereignisse[n]“, bilden einen Diskurs (ebd.; vgl. Reisigl 2006: 86). Das wäre, sogar wenn man ihn auf Luxemburg eingrenzen würde, „ein unermesslicher großer Bereich“, der die unterschiedlichsten Themen umfassen würde und ohne Zeit- und Themeneingrenzung, realistisch betrachtet, nicht analysierbar wäre (Foucault 2001 [1968]: 898; vgl. Reisigl 2006: 86).
Das Ziel seiner Untersuchungen bringt er demgegenüber sehr genau auf den Punkt als er sein Analysemodell als Archäologie bezeichnet:
[…] rückblickend erschien es mir dann, dass der Zufall mich gar nicht allzu schlecht gelenkt hatte: schließlich kann dieses Wort ‚Archäologie’, etwas ungenau übersetzt, was ich mir nachzusehen bitte, bedeuten: Beschreibung des Archivs (Foucault 1969/2001: 981).
Und er fügt hinzu:
Unter Archiv verstehe ich die Gesamtheit der tatsächlich geäußerten Diskurse; und diese Gesamtheit von Diskursen wird nicht lediglich als eine Gesamtheit von Ereignissen betrachtet, die sich ein für alle Mal ereignet hätten […], sondern auch als eine Gesamtheit, die weiterhin funktioniert, sich im Laufe der Geschichte transformiert, anderen Diskursen die Möglichkeit des Auftretens gibt (ebd.).
Bereits die Werktitel deuten darauf hin, dass sein Hauptinteresse in der Erforschung dessen liegt, was er épistémè (Episteme, das gesellschaftliche Wissen) nennt. Foucault will die Entwicklung und die Geltungsbestimmungen kollektiven Wissens beschreiben und das in diversen Bereichen der Gesellschaft (vgl. Busse 2013: 147). Entsprechend ist es sein übergeordnetes Ziel, eine „Geschichte des Wissens” (Busse 1987: 223) zu schreiben, das Wissen einer bestimmten Epoche, in bestimmten Bereichen und für bestimmte Kollektive zu re-konstituieren und mit den Wissenskonfigurationen in anderen Epochen zu vergleichen (vgl. Sarasin 2005: 71). Hierzu passt auch seine zweite Definition von Diskurs/-en als „individualisierbare Gruppe von Aussagen.“ Diskurse werden als zusammengehörige Ketten von Aussagen ermittelt, die den gleichen spezifizierbaren Formationsregeln gehorchen (vgl. Jäger 2012: 50). Er verengt seinen Diskursbegriff also und verweist darauf, dass sich Aussagen gruppieren lassen, es Formationssysteme gibt, die sich mit distinktiven Merkmalen beschreiben lassen:
Diskurs wird man eine Menge von Aussagen nennen, insoweit sie zur selben diskursiven Formation gehören (Foucault 1981/2013: 170).
Unter Formationssystem muss man also ein komplexes Bündel von Beziehungen verstehen, die als Regel funktionieren: Es schreibt das vor, was in einer diskursiven Praxis in Beziehung gesetzt werden musste, damit diese sich auf dieses oder jenes Objekt bezieht, damit sie diese oder jene Äußerung zum Zuge bringt, damit sie diesen oder jenen Begriff benutzt, damit sie diese oder jene Strategie organisiert. Ein Formationssystem in seiner besonderen Individualität zu definieren, heißt also einen Diskurs oder eine Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu charakterisieren (ebd.: 108).
Hiervon ausgehend, kann man sich Diskursformationen mit der Metaphorik von Jäger/Jäger (2007) und Jäger (2012: 38) als „Fluss von Wissen durch die Zeit” vorstellen. Den Begriff des Formationssystems kann man mit Jäger (ebd.: 51) durch den des Themas ersetzen. Ein Diskurs ist damit, vereinfacht gesagt, eine Ansammlung von Aussagen zu einem Thema, eine Ansammlung von Wissen zu einem bestimmten Thema.4
Es ziehen sich die Elemente des Diskurses als Themen durch die Texte (Foucault 1967: 795).
Indem man Diskurse in Themen5 unterteilt, schafft man eine gewisse Ordnung. So lässt sich etwa vom Einwanderungsdiskurs, vom Diskurs über Sprache und dem Diskurs über Bildung sprechen. Der Einwanderungsdiskurs kann sich bei näherer Betrachtung auch zugleich als Bestandteil des Diskurses über Sprache erweisen, der Diskurs über Bildung zugleich Teil des Diskurses über Sprache oder über Einwanderung sein. Die Benennung von Diskursen ist also, auch wenn sie dem allgemeinen Konsens entsprechen, nie frei von Willkür.6 Die „Landschaften der Diskurse […]“, die semantischen Beziehungen zwischen Aussagen, kann man sich wie ein in sich verwobenes Netz vorstellen (Jäger/Zimmermann 2010: 61). Diskurse „überschneiden [sich] und manchmal berühren [sie sich]“, es gibt aber auch welche, „die einander […] ignorieren oder ausschließen“, sagt Foucault (1974/1993: 34). Jung (1996) veranschaulicht den Versuch, Ordnung in diese wirre Unordnung der Diskurse zu bringen, anhand des nachstehenden Würfelmodells und einer sich diachron und beständig synchron weiterentwickelnden Text-Netz-Struktur.
 Abbildung 1:
Abbildung 1:
Diskurs als Textkorpus (Quelle: Wengeler/Jung 1999: 147)
 Abbildung 2:
Abbildung 2:
Diskurs als Korpus themengebundener Aussagen A1 – An (Quelle: ebd.: 148)
Verschiedene Diskursschulen haben, in Anlehnung an Foucaults Aussage vom „endlosen Weiterwuchern der Diskurse“, terminologische Vorschläge gemacht, um die prinzipielle Struktur und die Verflechtung von Diskursthemen zu entwirren und analysierbar zu machen (vgl. Foucault 1974/2007: 10). Die vorliegende Arbeit orientiert sich bei der Einteilung des Diskurses über die deutsche Sprache in Luxemburg an den Terminologien von Matthias Jung und Siegfried Jäger. Ersterer ist der sogenannten Düsseldorfer Schule für Diskurslinguistik zuzuordnen, letzterer der Duisburger Schule zur Kritischen Diskursanalyse. Matthias Jung unterscheidet zwischen einzelnen vom Forscher jeweils zu definierenden thematischen Diskursen (D1, D2, … Dn). Er nennt beispielsweise den frauenpolitischen Diskurs, den wirtschaftspolitischen Diskurs und den umweltpolitischen Diskurs (vgl. Jung 1996: 457). Dieser Gesamtdiskurs kann durch ein übergreifendes Thema und verschiedene Parameter (Zeit, Raum, etc.) von anderen Diskursen abgegrenzt werden. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Diskurs noch einmal vertikal in mehrere, inhaltlich voneinander unterscheidbare, Teildiskurse zu unterteilen. Als Beispiel nennt Jung die weitere Unterteilung des frauenpolitischen Diskurses in die Teildiskurse Abtreibungsdiskurs, Gleichberechtigungsdiskurs etc. (vgl. ebd.).
Um Ähnliches zu benennen, benutzt Jäger eine andere Terminologie. Er bezeichnet „thematisch einheitliche Diskursverläufe […] mit einer Vielzahl von Unterthemen bzw. bestehend aus unterschiedlichen Diskursfragmenten […]” als Diskursstränge (vgl. Jäger/Zimmermann 2010: 16). In einem Teildiskurs/Diskursstrang kommt es immer wieder zu neuen Aussagen. Damit verändert sich auch das Wissen im Diskurs. Einstellungen verschieben sich. Es werden andere Bezüge zu thematisch entfernten Teildiskursen/Diskurssträngen hergestellt (vgl. hierzu Foucault 1974/2007: 14f). So steht das ganze Diskursgeflecht in einer komplexen Interdependenz, die mit Jäger als Diskurs(strang)verschränkung bezeichnet werden kann.
Matthias Jung und Siegfried Jäger weisen darauf hin, dass Diskurse bzw. Teildiskurse auf verschiedenen Ebenen produziert, selektiert und organisiert werden. Jung (1996) spricht dabei von unterschiedlichen Kommunikationsbereichen, die den Diskurs noch einmal auf horizontaler Ebene gliedern; Jäger (2012) von unterschiedlichen Diskursebenen, auf denen die Diskursthemen verhandelt werden. Nicht alle Kommunikationsbereiche, in denen ein Diskurs geführt wird (Massenmedien, Politik, Fachwissenschaft, …) sind „in gleicher Weise offen und zugänglich“, so Foucault (1974/1993: 26). Nur wer „gewissen Erfordernissen genüg[e]“, könne in die Ordnung dieser Spezialdiskurse eintreten (vgl. ebd.). Sie unterscheiden sich sowohl in der Art wie sie den Gegenstand konstituieren, als auch mit Blick auf die jeweiligen Formationsregeln (vgl. Keller 2011: 231). Die Grenzen zwischen den Diskursebenen sind dabei aber fließend. Themen der Politik werden von den Medien aufgegriffen und in der Politik werden Themen verhandelt, die zuerst in den Medien debattiert wurden (vgl. Jäger/Zimmermann 2010: 38).
Jäger und Zimmermann definieren als Diskursgemeinschaft die Gruppe von Menschen, die „in der Anerkennung und Befolgung relativ homogener Aussagensysteme […] übereinstimmt“ (ebd.: 40). In der Regel gehört man mehreren Diskursgemeinschaften an.7
Jung (1996: 457) erweitert seine Untersuchungsterminologie um eine dritte Ebene, den Parameter Redekonstellation bzw. Textsorte. Die Aussagen des Diskurses können über diverse Textsorten und Redebeiträge erschlossen werden. Es müssen nicht einmal zwingend gesprochene oder geschriebene Aussagen sein.8 In diesem Sinne setzt sich auch das Untersuchungskorpus der vorliegenden Arbeit aus unterschiedlichen Textsorten zusammen (Pressetexte, Fragebögen, Interviews, Statistiken, wissenschaftliche Fachliteratur, Werbeanzeigen etc.), woraus sich zugleich Einblicke in unterschiedliche Diskursebenen ergeben.9
Bei der Wiederherstellung von Wissensausschnitten ist Foucault „nicht auf der Suche nach“
dem feierlichen ersten Augenblick, von dem ab beispielsweise die gesamte abendländische Mathematik möglich gewesen ist […]. Ich suche nicht nach geheimen, verborgenen Beziehungen, die schweigsamer oder grundlegender wären als das menschliche Bewusstsein (Foucault 1968/2001: 981).
Im Gegenteil ich versuche die Beziehungen zu definieren, die an der Oberfläche der Diskurse liegen (ebd.: 982).
Es geht bei der Beobachtung von Diskursen um die Art und Weise wie das Wissen zu einem bestimmten Thema im Diskurs praktiziert wird, sich durch den Diskurs konstituiert, wie es geformt und in Bezug zueinander gesetzt wird. Es geht darum, zu analysieren, worüber in einem Kollektiv gesprochen wird, was in einer Gesellschaft sagbar ist, d.h. welche Diskurspositionen akzeptiert sind und wie diese sich verändern (vgl. Wengeler 2013: 148). Foucault führt aus, was er unter wissen versteht:
Ein Wissen ist das, wovon man in einer diskursiven Praxis sprechen kann, die dadurch spezifiziert wird: der durch die verschiedenen Gegenstände […] konstituierte Bereich […]; ein Wissen ist auch der Raum, in dem das Subjekt die Stellung einnehmen kann, um von Gegenständen zu sprechen, mit denen es im Diskurs zu tun hat […]; ein Wissen ist auch ein Feld von Koordination und Subordination der Aussagen, wo die Begriffe erscheinen, bestimmt, angewandt und verändert werden […]; schließlich definiert sich ein Wissen durch die Möglichkeiten der Benutzung und der Aneignung, die vom Diskurs geboten werden […]. […] es gibt kein Wissen, ohne definierte diskursive Praxis; und jede diskursive Praxis kann durch das Wissen bestimmt werden, das sie formiert (Foucault 1981/2013: 259f).
Der Diskurs zeigt also das Regelwissen in einer bestimmten Diskursgemeinschaft auf, das tradiert wird und sich laufend verändert. Aussagen stehen in Bezug zu vergangenen Aussagen, bauen auf vorhandenem Wissen auf und verändern vorhandenes Wissen. Die thematische Diskursprogression kann untersucht werden und zeigen, wie der Diskurs voranschreitet, wie sich die Kenntnis der Regeln des Diskurses zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Situationen auswirkt und wann sich das Wissen im Diskurs verändert (vgl. Busch 2007: 143):
Es gibt gesellschaftliche Anlässe, in denen bestimmte Worte besser nicht ausgesprochen und bestimmte Themen besser nicht angeschnitten werden sollten, es gibt gewisse Meinungen, die zu äußern man besser unterlässt, möchte man sich von den Umstehenden keine verwunderten Seitenblicke einfangen, und es gibt immer wieder Gelegenheiten, in denen man die Sprache wechseln muss […], weil man mit einem Arzt anders spricht als mit dem Kind aus der Nachbarschaft oder mit einem Fahrkartenkontrolleur. Mit anderen Worten: Es gibt Regeln, die darüber befinden, was in einem bestimmten Zusammenhang als sprachlich passend angesehen wird und was nicht. […] (Landwehr 2006: 107).
Foucault geht es nicht um den Wahrheitswert einer Aussage, nicht darum, ob es sich dabei um eine besondere Erkenntnis handelt (vgl. Foucault 1968/2001: 921). Vielmehr geht es ihm darum „den Diskurs […] in sich selbst nach seinen Formationsregeln [zu] befrag[en]“ (Foucault 1981/2013: 115). Es geht ihm um die Bedeutung, die die Äußerungen einst einnahmen, die Bedingungen, unter denen sie zustande kommen, wie sie mit anderen Wissensabschnitten korrelieren und welche Äußerungen sie ausschließen (vgl. ebd.: 43). Es geht ihm um die Diskursregeln (vgl. Keller 2011: 228). Dies führt zur dritten Diskursdefinition von Foucault, bei der er Diskurse „schließlich als [eine] regulierte Praxis“ definiert (ebd.: 116). Je nach Epoche, nach Kulturkreis und sozialem Feld unterliegen Aussagen „einer völlig anderen Distribution, Aufteilung und Charakterisierung“ (vgl. ebd.: 35). Wissen hat also ein System und dieses System zu entschlüsseln, wäre die Aufgabe einer Diskursanalyse:
Was aber, wenn empirisches Wissen zu einer gegebenen Zeit und innerhalb einer gegebenen Kultur wirklich eine wohldefinierte Regelmäßigkeit besäße? […] Wenn Irrtümer (und Wahrheiten), die Anwendung alter Überzeugungen, einschließlich nicht nur wirklicher Enthüllungen, sondern auch der simpelsten Begriffe in einem gegebenen Augenblick den Gesetzen eines bestimmten Wissenscode gehorchten? Kurz, wenn die Geschichte des nichtformalen Wissens selbst ein System hätte? (Foucault 1974/2012: 9f.).
So kann eine Aussage je nach Kontext (Zeit, Raum, Wissensstand, etc.) eine andere Bedeutung erhalten:
Diese Gesamtheit von Aussagen ist weit davon entfernt, sich auf ein einziges Objekt zu beziehen, das ein für allemal gebildet ist […] (Foucault 1981/2013: 49).
Um das Wissen zu einem bestimmten Thema zu erschließen, muss nicht unbedingt nur die Sprache untersucht werden. Es geht auch um die regulierte Praxis des Handelns, darum diese Regeln sichtbar zu machen. Dennoch ist die Analyse von sprachlichen Äußerungen dabei aber der einfachste und offensichtlichste Weg. Die Methode, um dieses Wissen, um Denkmuster in Diskursgemeinschaften, auf verschiedenen Diskursebenen, zu erschließen, ist die archäologische „Wiederherstellung [des] historischen Diskurses“ (ebd.: 15). Man muss das „Feld historischer Bestimmungen durchlaufen“, sagt Foucault (1968/2001: 923), d.h. sich die Aussagen in einer Epoche ansehen und analysieren, welche Wissenssegmente bei gewissen Themen wirksam werden. Man muss die „diskursiven Regelmäßigkeiten“ wiederherstellen, das „Spiel der Regeln“ erschließen, „die in einer Kultur das Auftreten und das Verschwinden von Aussagen, ihr kurzes Überdauern und ihre Auslöschung, ihre paradoxe Existenz als Ereignisse und als Dinge bestimmen“ (ebd.: 902).