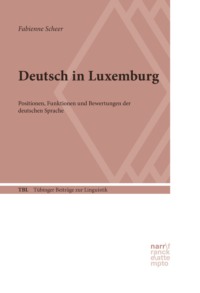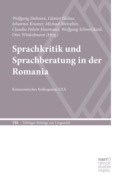Kitabı oku: «Deutsch in Luxemburg», sayfa 8
Die Mehrsprachigkeit Luxemburgs ist zu einem bedeutenden Teil der Ertrag des Bildungssystems. Bedeutung und Handlungsspielräume der Schulsprachen sind in den Lehrplänen der einzelnen Klassenstufen genauestens festgeschrieben.15 Die Entscheidung, welche Sprache wie eine16 Muttersprache und welche wie eine Fremdsprache unterrichtet werden soll, welche aus dem Lehrplan gestrichen wird oder mehr Unterrichtsstunden erhält, bleibt nicht ohne Folgen für den Status der Sprachen in der Gesellschaft insgesamt (vgl. Redinger 2010: 96). Die nachstehenden Korpusauszüge belegen, dass die luxemburgische Sprachensituation als Ressource angesehen wird, deren Fortbestand von der Schule gewährleistet wird und werden muss:
Die luxemburgische Primärschule besitzt vor allem zwei Trümpfe, um die man uns international beneidet: einerseits unsere Zweisprachigkeit und unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Fremdsprachenunterrichts: andererseits eine außergewöhnliche Integrationsfähigkeit. Unsere Primärschule bringt es fertig, rund 35 % Ausländerkinder in ein zweisprachiges Schulsystem zu integrieren (LW18: 18.01.1992).
[…] im Parlament wurde im November 2000 eine 24 Punkte enthaltende Motion verabschiedet. Deren Hauptakzente liegen in der Beibehaltung der einheitlichen Schule als Vorbedingung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daneben soll aus Kommunikations-, Wirtschafts-, sprich Überlebensgründen weiterhin auf die Dreisprachigkeit gesetzt werden (Tagebl: 08.06.2002).
On peut également affirmer que l’enseignement des matières non linguistiques en langue seconde ou langue étrangère est une des clés du plurilinguisme que l’on nous envie tant sur la scène internationale (MENFP 2010: 1).
Lehrergewerkschaften und Fachverbände werden auch künftig reagieren, wenn von Regierungsseite angedacht wird, die Stundenanzahl in einer Schulsprache zu reduzieren oder die Inhalte des Sprachunterrichts zu verändern. Die APFL hat von allen Fachverbänden die stärkste Lobby. Der ‚Lëtzebuerger Germanistenverband’ (LGV) geht bis heute vorsichtig mit öffentlichen Stellungnahmen um, die den Deutschunterricht in Luxemburg und Kritik an sprachpolitischen Entscheidungen betreffen. Der Verein agiert in dem Bewusstsein, dass die Forderung nach einer Ausweitung des Deutschunterrichts schnell missverstanden werden kann als Forderung nach einer Ausweitung der deutschen Kultur in Luxemburg insgesamt.
Im Juni 2005 untersuchte eine Expertengruppe des Europarates auf Wunsch des luxemburgischen Bildungsministeriums das Schulsystem und gelangte zu der Schlussfolgerung, dass die Schule den Wert der Familiensprachen ignoriere, die die Schüler mit in die Schule brächten. Vorhandene Sprachrepertoires würden weder aufgewertet noch in Sprachwissen umgewandelt (vgl. Goullier et al. 2006: v, vi, 18–20). Unmittelbar nach diesem Bericht wurde von politischer Seite in Luxemburg verstärkt versucht, Einfluss auf die mediale Diskursebene zu nehmen und die Sichtweise auf Mehrsprachigkeit dahingehend zu verändern, dass jede Sprache als Mehrwert anzusehen sei. Im Untersuchungskorpus zeigt sich auf der medialen Diskursebene ab 2006 eine Diskursprogression, die von der zuvor bewährten Denkweise „Dreisprachigkeit bleibt oberstes Prinzip“ (LW15: 03.04.1998) abrückt.
BEISPIELE AUS DEM UNTERSUCHUNGSKORPUS VOR 2006
Als bedeutenden Pfeiler des nationalen Schulsystems bezeichnete A. Brasseur die Dreisprachigkeit, die nicht in Frage gestellt werden dürfe. Sei eine elementare Sprachbeherrschung nicht gegeben, so dürfe ein Schüler sich nicht durch die Schule „mogeln“ können, betonte die Ministerin (LW: 30.11.2000).
Die Dreisprachigkeit des luxemburgischen Schulsystems will Unterrichtsministerin Anne Brasseur nicht in Frage stellen. Sie will aber die Sprachkenntnisse, besonders im technischen Sekundarunterricht, mehr als bisher auf die Berufsausbildung abstimmen (Telecr.: 09.12.2000).
Die Dreisprachigkeit sei ein zentraler Aspekt des nationalen Schulsystems, wenngleich die Rolle des Luxemburgischen als Integrationsinstrument und Kommunikationssprache immer wichtiger werde (Wort4: 30.01.2003).
DISKURSPROGRESSION AB 2006
Mehrsprachigkeit anstatt Dreisprachigkeit […] Es werde nicht nur Deutsch, Französisch und Luxemburgisch in den Schulhöfen gesprochen, sondern u.a. auch Portugiesisch und Italienisch, stellte Frau Caldagnetto fest. Die Muttersprache der nicht-luxemburgischen Schüler solle nicht als Problem, sondern als Erbgut und Chance betrachtet werden. Geteilt wurde diese Einstellung übrigens auch von der Hauptreferentin, der Unterrichtsministerin Mady Delvaux-Stehres (Wort34/35: 20.03.2006).
Bei der Vorstellung der Forschungsergebnisse spricht sich der Berichterstatter der Expertengruppe, Francis Goullier, für die Überprüfung einiger, für selbstverständlich geltender Errungenschaften aus. „Ist es notwendig, dass alle Schüler alle Sprachen in einem gleichen Ausmaß beherrschen müssen“, warf Goullier auf (LW3: 21.03.2006).
Die Mehrsprachigkeit muss auf jeden Fall erhalten bleiben, aber sie darf für niemanden eine unüberwindbare Hürde in der Schule sein, so Delvaux (Telecr: 24.03.2007).
Der Begriff der Mehrsprachigkeit wird umgedeutet. Es wird versucht, die Sichtweise durchzusetzen, dass jede Sprache als Surplus anzusehen ist und Mehrsprachigkeit an sich schon wertgeschätzt werden muss. Der Bericht kann als diskursives Ereignis im Sinne von Foucault gewertet werden.
Im Diskurs besteht ein Konsens darüber, dass es die Aufgabe der Schule ist, sozusagen ‚von unten’, die Integration der Zuwanderer zu erreichen:
[…] le ministère a fait élaborer le papier Pour une école d'intégration, prônant haut et fort le principe de l'école publique unique et une intégration humaine des enfants de nombreuses cultures qui constituent désormais le Luxembourg (LL: 10.06.1996).
Ich kann mir die Integration in unserem Land nicht anders ideal vorstellen als über die Schule (LW3: 26.09.1997).
Hat nicht die Unterrichtsministerin selbst bereits allenthalben das Leitmotiv vorbereitet: „L’intégration passe par l’intégration scolaire“? (LW: 26.02.2000)
Deren Hauptakzente liegen in der Beibehaltung der einheitlichen Schule als Vorbedingung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt (Tagebl: 08.06.2002).
Damit verbunden ist die Überzeugung, dass ein Schulsystem, das die Schulpopulation von Anfang an, also bereits in der Grundschule, nach ihren Sprachkenntnissen aufteilen würde, langfristig zur Entstehung von Parallelgesellschaften führen würde. Dieses Argumentationsmuster wird als TOPOS DER EINHEIT definiert, das nach dem folgenden Schema funktioniert:
Weil eine Spaltung der Schule eine Spaltung der Gesellschaft nach sich ziehen würde, muss die Schule eine Einheit bleiben.
Im Diskurs taucht dieser Topos vor allem dann auf, wenn über die Einführung eines französischen Alphabetisierungszweiges als Begleitangebot zur deutschsprachigen Alphabetisierung in der luxemburgischen Grundschule nachgedacht wird:
Wenn auch auf den ersten Blick dieses System einige Vorteile für die ausländischen Kinder böte, so würde eine zweite Schule gegründet, welche die Integration der Ausländer fast unmöglich mache (LW3: 23.03.1983).
Wir schaffen auf diese Weise [Einführung eines französischsprachigen Schulzweiges neben dem bestehenden] zwei Sprachgruppen innerhalb eines Landes mit den daraus resultierenden möglichen Konfliktsituationen (LW: 21.08.1999).
Da die Integration in der Schule geschehe, sprach sich die Direktorin gegen französischsprachige Klassen aus, die zu einer Isolierung dieser Schüler führen würden (LW: 16.05.2002).
2.2 Die Gemeinschaft der Diskursteilnehmer
Migranten treten selten als Teilnehmer der Diskursgemeinschaft hervor, die in Luxemburg über das Bildungssystem diskutiert. Um mitdiskutieren zu können, müssen Zuwanderer den linguistischen Habitus des Ziellandes erlernen. Eine mangelhafte Beherrschung führt zu Informationsdefiziten und/oder zur Exklusion von Entscheidungsprozessen. Analysen des Medienkorpus haben gezeigt, dass die französischsprachige Wochenzeitung Le jeudi verstärkt gesellschaftspolitische Themen für ein zugewandertes Leserpublikum auf Französisch aufbereitet. Gleiches galt auch für die Voix du Luxembourg (Verlagshaus Saint Paul), die 2011 eingestellt wurde. Das Verstummen der französischen Zeitung deutet nicht nur auf eine generelle Präferenz der Luxemburger für die deutsche Sprache als Mediensprache hin, sondern auch auf ein nur bedingtes Interesse der Zuwanderer bestimmter Milieus an inländischen Nachrichten (s. a. Kapitel IX). Unzureichende Sprachkenntnisse sind demnach nicht die alleinige Ursache, weshalb Bürger mit Migrationshintergrund seltener ihre Stimme erheben, um am Diskurs zu partizipieren. Es gibt Medienangebote, die nicht in den Landessprachen, sondern auf Portugiesisch, Englisch und in anderen Sprachen verfasst sind. Seit 1970 besteht beispielsweise für die größte Zuwanderergruppe, die Portugiesen, ein umfassendes Informationsangebot, das zu seiner Zielgruppe allerdings nie vollends durchdringen konnte. (s. a. ebd.).
EXKURS: Das Bildungssystem in Portugal
Das Ende der Diktatur in Portugal ist noch jung. Erst 1974 wurde sie durch eine friedliche Revolution beendet, wirkt jedoch bis heute nach. Vor der Nelkenrevolution war der Analphabetismus im Land weit verbreitet, rund ein Drittel der portugiesischen Bevölkerung konnte weder richtig lesen noch schreiben (vgl. srf et al. 2014). Portugiesen, die damals nach Luxemburg auswanderten, hatten selten eine abgeschlossene Grundschulausbildung. Bis heute geht ein Großteil von ihnen in Portugal früh von der Schule ab (vgl. Santiago et al. 2012: 9). 2009 konnten nur 30 % der 25- bis 64-jährigen Portugiesen, die dem Arbeitermilieu entstammen, einen oberen Sekundarschulabschluss vorweisen. Das ist die niedrigste Rate in der OECD. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 73 % (vgl. ebd.). Auch wenn die Zuwanderer, die heute aus Portugal kommen, deutlich freier und offener erzogen sind als ihre Eltern, sind es größtenteils Arbeitsmigranten, deren Verdienst sich im Niedriglohnbereich ansiedelt. Charakteristisch für diese Zuwanderergruppe ist, dass sie ein wenig elaboriertes Portugiesisch oder kapverdisches Kreol und nur ein elementares Französisch (A1- bis A2-Niveau) beherrscht. Ende 2000 fand in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer eine Orientierungsdebatte zum Thema „Une école d’intégration“ statt. Die Verantwortlichen der ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) gaben darin zu bedenken, dass ein Großteil der Eltern mit Migrationshintergrund nicht in der Lage sei, die schulischen Fortschritte seiner Kinder zu verfolgen (vgl. CHD 2000: 26). Grund sei der Bildungsstand der Eltern und nicht oder nur unzureichend vorhandene Kenntnisse in den luxemburgischen Landessprachen (vgl. ebd.). 2005 wurde das portugiesische Bildungssystem erneut reformiert. Seither ist nicht mehr Französisch, sondern Englisch die erste Fremdsprache, die in der dritten Klasse erlernt wird (vgl. Leclerc 2014).1 Auswanderer, die aus Portugal nach Luxemburg kommen, können daher nicht mehr zwingend Französischkenntnisse vorweisen:
„Das Profil dieser Menschen ist sehr variabel. Verschiedene sind wenig qualifiziert, andere dagegen sehr gut. Man sprach mir von Personen, die Universitätsdiplome haben, jetzt aber Teller waschen oder in einem Umzugsunternehmen arbeiten. Da gibt es oft ein Sprachenproblem, weil diese Menschen keine Fremdsprache oder nur Englisch sprechen. Französisch ist nicht mehr die Fremdsprache, die es einmal in Portugal war.“ (LW4: 07.03.2012)
Luxemburgs Grundschulen bieten so genannte cours d’accueils an. Diese Intensivkurse sind darauf ausgerichtet, Zuwandererkinder, die während eines laufenden Schuljahres in Luxemburg ankommen und weder Deutsch- noch Französischkenntnisse mitbringen, möglichst schnell mit einer Kommunikationssprache auszustatten.2 Bei der ersten Begegnung soll das Lehrpersonal der cours d’accueils den Eltern das luxemburgische Bildungssystem und die Sprachensituation erklären. Es soll ihnen verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Landessprachen anzunehmen und damit ein Vorbild und eine Motivation für die eigenen Kinder zu sein. Das Bildungsministerium stellt den Schulen seit 1999 außerdem Dolmetscher und kulturelle Mediatoren zur Seite, um bei Bedarf die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften zu erleichtern (vgl. LW5: 22.01.2004). Zu Dolmetschern und kulturellen Mediatoren werden gelegentlich auch die Lehrkräfte der sogenannten Cours intégrés en langue maternelle in den Grundschulen. Diese Kurse wurden 1983 vom luxemburgischen Bildungsministerium eingeführt. Zu Beginn wurde der integrierte Muttersprachunterricht in Schulen, die einen hohen Migrationsanteil aufwiesen, in den Sprachen ‚Italienisch’, ‚Spanisch’ und/oder ‚Portugiesisch’ angeboten. Anfangs sollten die Kurse Kindern aus Zuwandererfamilien, die planten in absehbarer Zeit wieder in ihr Herkunftsland zurückzukehren, ausreichende Muttersprachkenntnisse vermitteln (vgl. Tagebl25: 10.10.2014). Die meisten Familien blieben jedoch in Luxemburg. Seit 2005 existieren landesweit nur noch die ‚Cours intégrés en langue portugaise’ (COIP). Der Anteil der übrigen Nationalitäten ist in den Grundschulen mittlerweile zu gering, um die Beibehaltung der Kurse zu rechtfertigen.3 Der Muttersprachunterricht wird damit begründet, dass „Studien gezeigt [hätten], dass Kinder, die den Kontakt zu ihrer Muttersprache behalten, sich leichter gegenüber Neuem öffnen [würden] und schneller neue Sprachen lernen könn[t]en” (vgl. ebd.). Eine Studie von Tonnar-Meyer/Unsen/Vallado (vgl. 2005: 24) konnte jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Besuch der COIP-Kurse und dem schulischen Erfolg der Kinder in Luxemburg ausmachen. Im Schuljahr 2013/2014 besuchte ein Viertel aller portugiesischen Grundschüler die COIP-Kurse (vgl. Tagebl25: 10.10.2014).4 Die Einschreibungszahlen sind rückläufig. Viele Eltern sind mittlerweile der Meinung, dass es ihren Kindern mehr hilft, wenn sie den regulären Unterricht besuchen, der auf Deutsch abläuft (vgl. ebd.). Während im COIP-Kurs der Lernstoff in den Fächern Geografie, Naturwissenschaften und Geschichte auf Portugiesisch unterrichtet wird, wird in der regulären Klasse dasselbe Wissen auf Deutsch vermittelt (vgl. ebd.).
Gegenwärtig leben viele Portugiesen in der zweiten oder dritten Generation in Luxemburg und verfügen über eine vollkommen andere Lern- und Sprachbiografie als ihre Eltern, Großeltern und Neuzuwanderer. Sie haben das luxemburgische Bildungssystem teilweise oder ganz durchlaufen und die Landessprachen erworben. Wer den Gesprächen junger Migranten heute zuhört, bemerkt wie sie, gerade im Austausch mit Gleichaltrigen, wo die Erwartungen an die Ausdruckswahl geringer sind, die Sprachen, die sich in ihren Repertoires befinden, vermischen. Sie haben eine multilinguale Identität ausgebildet. Mitten im Gespräch wird zwischen verschiedenen Sprachsystemen hin und her gewechselt (code-switching) – wenn es schnell gehen soll, werden die Sprachen sogar gemixt (code-mixing). Die Schule hat hier eine Grundlage geschaffen, die außerhalb der schulischen Wertmaßstäbe unbefangen als Mehrsprachigkeit genutzt wird.
3 Der Stellenwert des Deutschen in der Grundschule
3.1 Die Entwicklung des linguistischen Startkapitals im Grundschulzyklus 1
Im Volksmund wird der Cycle 1 bis heute ‚Spillschoul’ (Spielschule) genannt. Die Aufgaben, die die luxemburgische Vorschule zu erfüllen hat, reichen aber weit über Malen, Basteln und Spielen hinaus. Zu ihren Hauptaufgaben gehört es, bei allen Kindern die Erst- und Zweitsprache Luxemburgisch zu festigen und damit eine Grundlage zu schaffen, die den weiteren schulischen Erfolg maßgeblich mitbestimmt. Lëtzebuergeschkenntnisse werden zum Fundament für den Aufbau weiterer Sprachen. Außerdem sollen die Kinder, die verschiedenste Familiensprachen mitbringen, durch das Erlernen einer gemeinsamen Ausgangssprache zu einer Sprach- und Schulgemeinschaft zusammenwachsen. Lëtzebuergesch hat im Land den Status der Integrationssprache (s. a. Kapitel VI.). Das Wissen um den hohen Stellenwert der luxemburgischen Sprache und das spezifisch luxemburgische Sprachhandlungswissen werden also von Anfang an kommuniziert. Kühn (2008: 16) konstatiert, dass „[…] die Éducation préscolaire [innerhalb des luxemburgischen Schulsystems] eine besondere sprachenpolitische Verantwortung und sprachencurriculare Bedeutung [einnehme].“ Aussagen aus den späten 1990er Jahren zeigen, dass die Früherziehung 1998/1999 eingeführt wurde, um eine sprachlich heterogene Schulgemeinschaft möglichst frühzeitig zusammenzuführen und mit der integrativen Sprache ‚Luxemburgisch’ auszustatten:
Redet man von Integration, kommt man nicht umhin, auch von Früherziehung (éducation précoce) zu reden. Denn es ist längst erwiesen, dass gerade die ersten Lebensjahre ganz entscheidend sind, was die Möglichkeiten zur Integration anbelangt, sei es Sozialisation im allgemeinen, sei es die Integration von Kindern mit speziellen Schwierigkeiten im Besonderen, aber auch die kulturelle Integration und ganz generell das Erlernen von Sprachen (LW3: 02.02.1998).
Der Prozess der Integration soll sich vollziehen durch das Erlernen des Luxemburgischen – das ist die aktuelle Zielsetzung von Vorschule und Früherziehung – das allein als Umgangssprache dazu berufen ist, die verschiedenen Nationalitäten zusammenzuschweißen. Außerdem soll das Lëtzebuergesch später als Sprungbrett dienen beim Erlernen des Deutschen (LW28: 21.08.1999).
Die meisten Pädagogen sind sich darüber einig, dass die Früherziehung (éducation précoce) in Zukunft deshalb von großer Wichtigkeit sein wird – sie hilft soziale Barrieren abzubauen und fördert die Integration durch eine gemeinsame Sprache (Telecr: 09.12.2000).
Im Schuljahr 2012/2013 nutzten 4141 Kinder das Früherziehungsangebot (vgl. Mahon 2014: 12). 62,8 % davon sprach zuhause kein Luxemburgisch (vgl. ebd.: 102). Im September 2014 kündigte Bildungsminister Claude Meisch an, die Kindertagesstätten in Luxemburg reformieren zu wollen. Die Aufgaben der Kitas sollen deutlich erweitert werden:
“All crèches must be bilingual in the future“, Minister Meisch said, adding they will be essential in preparing young learners for school. Furthermore, he said crèches should not be considered simply as a babysitting service but as a step towards helping children to become bilingual, increasing personal experiences (Wortonline: 09.07.2014).
Die geplante Reform sieht vor, in öffentlichen Kindertagesstätten künftig zwei Sprachen, Luxemburgisch und Französisch, zu benutzen. Damit deutet sich eine Verschiebung der sprachpolitischen Akzente an: Das Gewicht wird nicht mehr allein auf dem Erwerb der luxemburgischen Sprache liegen, sondern ergänzt. Auf diese Weise sollen bereits im frühen Kindesalter positive Erfahrungen im Umgang mit beiden Sprachen gemacht werden, die sich prägend auf ein mehrsprachiges Bewusstsein auswirken. Dahinter steht auch der Gedanke den negativen Einstellungen, die Schüler mit Familiensprache Luxemburgisch zurzeit gegenüber der französischen Sprache ausbilden, entgegenzuwirken. Wird ‚Französisch’ bereits früh mit positiven Erfahrungen verknüpft, verringert sich theoretisch das Risiko stabile negative Einstellungen gegenüber der Sprache zu entwickeln.
Ein als exemplarisch zu betrachtender Einblick in eine luxemburgische Vorschulklasse konnte im Gespräch mit einer Vorschullehrerin aus dem Norden des Landes gewonnen werden. Pro Schuljahr betreut sie in etwa 18–20 Vorschulkinder. Die Klassenzusammensetzung zum Schulanfang im Winter 2014/2015 sah folgendermaßen aus:
Vorschullehrerin: „Zum Schulanfang sind 18 Kinder gemeldet. Normalerweise sind es immer so um die 14–15 Kinder für die Vorschule und 4–5 Précoce-Kinder. In diesem Jahr weist die Liste auf den ersten Blick mehr Kinder mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit auf als gewöhnlich, was aber nicht bedeutet, dass diese Kinder zuhause Luxemburgisch sprechen. Oft besitzen die Eltern die luxemburgische Staatsangehörigkeit, ihre Kinder wachsen aber mit einer anderen Muttersprache als Luxemburgisch auf.“
Nicht jedes Klassenzimmer in Luxemburg weist die hier beschriebene sprachliche Heterogenität auf. Sie ist allerdings eher die Regel und nicht die Ausnahme. Die Migration ist regional unterschiedlich verteilt. So liegen die Gemeinden Larochette, Esch-Alzette und Differdingen mit Migrationsanteilen von 69,4 %, 69,1 % und 66,9 % in den Grundschulen derzeit an der Spitze (vgl. Mahon 2014: 20). Gemeinden wie Leudelange oder Harlange weisen demgegenüber mit 33,3 % und 25,1 % einen bedeutend geringeren Anteil an Schülern mit nicht-luxemburgischer Staatsangehörigkeit auf (vgl. ebd.: 20f.). In solchen Gemeinden ist weitaus weniger Spracharbeit erforderlich als auf den folgenden Seiten dargelegt wird. Die Gruppe der Schüler mit Migrationshintergrund ist darüberhinaus in sich sehr heterogen. Die portugiesischen Einwanderer stellen die zahlenmäßig größte Migrationsgruppe mit 25,9 %, gefolgt von den Zuwanderern aus Ex-Jugoslawien (5,1 %), den Franzosen (4,8 %) und Belgiern (2,3 %) (vgl. ebd.: 8). Es ist schwierig schulcurriculare Vorgaben für das ganze Land zu machen. Oft kommen Kinder aus Familien, in denen kein Luxemburgisch gesprochen wird, erst mit drei Jahren zum ersten Mal mit der luxemburgischen Sprache in Kontakt, wenn sie die fakultative Früherziehung besuchen.
Vorschullehrerin: „Es hängt davon ab, ob das Kind schon eine Kita besucht hat [in der Luxemburgisch gesprochen wurde] und wie die Situation zuhause ist. Wenn ältere Geschwister im Haus sind, hat es oft schon einige luxemburgische Wörter bei diesen aufgeschnappt. Sehr wichtig ist auch die Einstellung der Eltern, ob diese der Sprachensituation des Landes und der luxemburgischen Sprache offen gegenüberstehen.“1
Bei den Drei- bis Vierjährigen, die im Winter 2014/2015 eine neue Schulgemeinschaft bildeten, war aller Anfang wieder schwer. Der Anteil jener Kinder, die in den Zyklus 1.1 (erstes Jahr Kindergarten) kommen und bereits Luxemburgisch beherrschen, liegt zurzeit bei unter 40 % (vgl. Wortonline: 16.02.2014). Auf die Frage hin, wie sie in den ersten Wochen vorgehe, um mit den Kindern zu kommunizieren, die nahezu kein Lëtzebuergesch verstünden, antwortete die Vorschullehrerin:
Am Anfang reden wir wirklich mit Händen und Füßen. Das erste, womit wir anfangen ist das Schulvokabular, d.h. wir lernen alle Bezeichnungen für Dinge, die mit der schulischen Umgebung, in der sich die Kinder ab sofort aufhalten, zu tun haben. Die zentralen Wörter und Sätze werden immer wieder aufs Neue wiederholt, denn es ist die Wiederholung, die es macht und zu einer Verinnerlichung der Sprache führt. Ich verbessere die Kinder auch, tue dies allerdings in einer spielerischen Art und Weise. Fragt zum Beispiel ein Kind: *’Joffer, kannen ech an d’Toilett?’ Dann entgegne ich amüsiert: ‚Igitt, an d’Toilett? Wëlls du net léiwer op d’Toilett?’ Ich greife also die fehlerhaften Aussagen auf und formuliere sie noch einmal korrekt um.
Die Lehrkräfte, die in den staatlichen Kitas, in Früherziehung und Vorschulen unterrichten, sind, unabhängig von der Klassenzusammensetzung, angehalten, ab dem ersten Schultag Luxemburgisch mit den Kindern zu sprechen. Sie sollen sich um eine korrekte und deutliche Aussprache bemühen und luxemburgische Bezeichnungen deutschen Entlehnungen vorziehen.2 Ein gefestigter Wortschatz im Luxemburgischen „facilitera non seulement leur intégration dans la société, mais d’un autre coté, il devra leur permettre d’aborder avec moins de difficultés l’allemand, langue d’alphabétisation en première année d’études primaires“, heißt es u.a. bei Berg und Weis (2005: 51). Auf diese Weise soll das Kind später deutlich zwischen der luxemburgischen und der deutschen Sprache unterscheiden können. Die Kompetenzen im Luxemburgischen sollen gegen Ende des Zyklus 1 so weit ausgebildet sein, dass sie die Brücke (literacy bridge)3 zum daran anschließenden Erwerb der deutschen Sprache bilden können.4
Obschon sie in der Vorschule relativ schnell Basiskenntnisse in der luxemburgischen Sprache erwerben, reagieren Kinder, denen die luxemburgische Sprache fremd ist, in den ersten Wochen oft verstört auf das neue sprachliche Umfeld. Die frühe Mehrsprachigkeit wird fortan die gesamte Persönlichkeit des Kindes beeinflussen, zur Entwicklung neuer sprachlicher Registerebenen führen und die Bedeutung der Muttersprache verändern (vgl. Huneke/Steinig 2010: 13).
Vorschullehrerin: „In einer ersten Phase haben die Kinder Heimweh. Sie müssen sich erst an die neue Situation gewöhnen. Manchmal vergebe ich auch an eines der älteren Vorschulkinder die Rolle des Dolmetschers. Es darf dann dem jüngeren Kind in dessen Muttersprache erklären, was es machen soll.5 Ich selbst kann auch die wichtigsten Wörter auf Portugiesisch, aber Bosnisch oder Serbokroatisch kann ich zum Beispiel nicht. Und wir haben auch Kinder die Kreol sprechen oder eine andere Sprache. Notfalls benutzen wir Hände und Füße. Wir kommen zurecht. Von den Kindern erwarte ich, dass sie in der Klasse Luxemburgisch reden. Wenn das Pausenspiel auf Portugiesisch abläuft, störe ich sie nur, wenn ich sehe, dass durch die Sprache andere Kinder ausgegrenzt werden.“
Kinder, die aus einem sprachbewussten Elternhaus stammen und mittleren bis höheren Sozialmilieus angehören, finden sich in der Regel zügig in der neuen Sprachumgebung zurecht (vgl. ebd.: 17). Wachsen sie allerdings in einer spracharmen und bildungsfernen Umgebung auf, kommen sie mit schwach ausgeprägten Sprachkompetenzen in die Schule. Bei der portugiesischen Migrationsgruppe ist dies leider oft der Fall. Hierunter fallen auch viele kapverdischen Einwanderer mit portugiesischem Pass. So ist die Erstsprache Portugiesisch oder das kapverdische Kreol vielfach nicht altersentsprechend entwickelt, wenn im Alter von drei bis vier Jahren Lëtzebuergesch als Zweitsprache hinzukommt. Auf diesem ‚unstabilen Gerüst’ weitere Sprachen aufzubauen, fällt schwer.6 Hat das Kind kein altersgerechtes Bewusstsein dafür, ob die Ampel nun ‚verde’, ‚vermelho’ oder ‚laranja’7 anzeigt, hat es zugleich Schwierigkeiten seine Kapazitäten im Luxemburgischen weiter auszubauen. Um herauszufinden, wo das Kind in der Sprachentwicklung steht, testen Experten im Auftrag des Bildungsministeriums die portugiesischen Vorschulkinder auf ihren Sprachstand hin. Die Sprachentwicklung in einer anderen Erstsprache kann ebenfalls auf Anfrage der Lehrkraft hin überprüft werden.