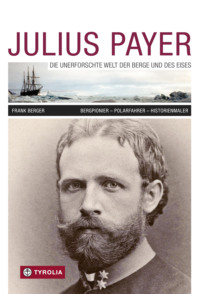Kitabı oku: «Julius Payer. Die unerforschte Welt der Berge und des Eises», sayfa 4
SÜDLICHE ORTLER-ALPEN (1867)
Anfang August 1867 reiste Julius Payer von seiner Garnison Jägerndorf über Wien, Venedig, Trient, Cles und Fucine nach Pejo. Sein Standquartier schlug er in der Cannonica des Curaten von Pejo, Guiseppe Baggia, auf. Aus Sulden kam weisungsgemäß Johann Pinggera hinzu, bestückt mit Regenschirm, Steigeisen, Bergstöcken, Axt und Strick. Als örtlichen Bergführer engagierte Payer Antonio Chiesa, einen ehemaligen Kapuziner, mittelgroß, 60 Jahre alt, „zur Mumie vertrocknet“, ein Schwätzer und Zecher, aber auch, wie sich herausstellen sollte, schlau, treu und ausdauernd.
Am 27. August bestiegen Payer und Pinggera mit Chiesa den Corno Vioz (2498 m). Von 8 bis 12 Uhr arbeitete Payer auf dem Gipfel am Messtisch. Weil es nachmittags in Strömen regnete, übernachteten sie in der Malga Saline und kamen am nächsten Morgen völlig durchnässt in Pejo an. Am 30. August bestieg Payer allein mit Pinggera die Cima Garneda (2893 m) und am folgenden Tag noch einmal den Corno Vioz, um die Triangulierung fortzusetzen. Am 31. August bestiegen Payer, Pinggera und Chiesa die Cima Ganani (2887 m) und übernachteten abends in der Malga Vedrignana.
Am Morgen des 1. September („meinem Geburtstage“) brachen sie zur Rotspitze (3324 m) auf. Auf der Spitze arbeitete Payer zwei Stunden am Messtisch. Die Herstellung des trigonometrischen Netzes erforderte die Besteigung einer zweiten Spitze, und so stand die Gruppe um 14.15Uhr auf der Cima Lago Lungo (3125 m). Sie verließen den Gipfel erst um 18 Uhr und übernachteten in der Alphütte von La Mare. Der 2. September diente der Genesung des erkrankten Pinggera, den Payer am 3. September wieder für marschfähig erklärte. Zusammen mit Chiesa gingen sie das Val Vioz hinauf und lagerten unter einem Felsen. Dann bestiegen sie den höchsten Punkt des Monte Vioz (3628 m). Knapp zwei Stunden verweilten sie auf dem Gipfel in extremer Kälte, was nur wenige Messungen zuließ. Belebt durch viel Wein, aber dann auch völlig erschöpft, stiegen sie durch das Val Vioz herab nach Pejo.

Der Monte Saline vom Monte Viòz aus, aquarellierte Zeichnung von Moritz Menzinger nach einer Vorlage von Julius Payer, 1867 (PGM Ergänzungsheft 27, 1869)
Nach einigen Tagen diverser kleinerer Exkursionen brachen Payer, Pinggera und Chiesa am 10. September zum Palon della Mare (3669 m) auf, den sie um 13 Uhr erreichten. Anschließend stiegen sie nach Santa Caterina ab, einem Ort, der sich des Besuchs vieler englischer Alpinisten erfreute. Am 12. September bestiegen sie die Punta Cadini (3482 m) und im Anschluss daran den Pizzo Taviela, die heutige Rocca S. Caterina (3497 m). Von Pejo aus bestiegen Payer, Pinggera und Chiesa am 14. September den Monte Saline (3588 m). Die nächsten Tage waren Rasttage in La Mare, weil es in Strömen regnete.
Am 21. September bestiegen Payer und Pinggera, diesmal ohne Chiesa, den Monte Giumella (3551 m) und auch das prächtige Gletscherhorn der Punta San Matteo (3633 m). Um 11 Uhr verweilten sie für eine Viertelstunde am Gipfel, den sie über eine überstehende Eiswechte verließen. Pinggera, die Gefahr dieses Weges erkennend, rief ihm zu: „Sie sind ja dümmer als die Nacht!“, setzte aber den Weg mit Payer fort. Ein Stück der Wechte mit Pinggera darauf brach ab, doch der eiserfahrene Begleiter konnte sich wieder auf die Schneide hinaufschwingen. Selbst dies reichte nicht aus als Warnung. Wenige Minuten später brach die Wechte noch einmal und Payer und Pinggera stürzten samt abgelöstem Schneeüberhang kopfüber in die Tiefe. In freiem Fall erwartete Payer den tödlichen Aufschlag auf einen Felsen. Doch nach einem letzten Sturz von einem Überhang von 60 Fuß blieb Payer in einer Schneegrube stecken, aus Mund und Nase blutend, aber ansonsten unverletzt. Er fürchtete um das Leben Pinggeras. Dessen Namen rufend, mit einem Augenglas bewehrt – Payer war stark kurzsichtig – suchte er die Gegend ab und entdeckte ihn schließlich ebenso unverletzt bis auf eine durch das Steigeisen verursachte Wunde am linken Oberschenkel. Die gesamte Sturzhöhe schätzte Payer auf etwa 800 Fuß.
Alle Ausrüstung war verloren. Dennoch beschlossen Payer und Pinggera, ohne Axt, Steigeisen und Bergstock noch auf den Monte Tresero (3547 m) zu steigen. Um 14.45 Uhr standen sie in großer Kälte auf der Hauptspitze. Sie stiegen nach Süden auf die Vedretta Gavia ab. Beim weiteren Abstieg verirrten sie sich vollständig, wurden aber in einer Hütte des Val Bormina gastfreundlich ausgenommen. Am 22. September kamen die beiden in das Dorf Pezzo, wobei Pinggera schon stark hinkte und krank an den Augen war. Ihre letzten 2 Franken reichten gerade noch für das Frühstück. Soweit gestärkt gingen sie nach Pejo.
Da eine Lücke in der Karte zu schließen war, musste die Cima Venezia noch einmal erstiegen werden. Es war der 24. September. In La Mare verabschiedete Payer den Führer Antonio Chiesa, der vor Zuneigung weinte. Ohne Bergstöcke, aber mit zwei Maßflaschen Wein, Pinggera beladen wie ein Saumtier, stiegen sie über tiefen Schnee zur Vedretta Marmotta und zum oberen Hochfernerjoch hinauf. Um 13 Uhr standen sie auf der Cima Venezia (3345 m). Nach langen Verzögerungen in tiefem Schnee schritten sie das Martelltal hinab und gerieten in die Nacht und in einen Orkan mit starkem Regen. Um 20 Uhr erreichten sie ihr Ziel, das Bauernbad Salt. Payer litt schon länger unter einer Bindehautentzündung, wogegen die Wirtin ein Mittel wusste. Sie legte ihm auf beide Augen einen in Leinen gewickelten toten Frosch. „Das Mittel war gewiss sehr gut. Hatte nur den Einen Fehler, dass es Nichts half.“, meinte Payer.
Am 25. September verabschiedete sich Payer von Pinggera. Sie kamen überein, im nächsten Jahr im Martell- und Laafertal gemeinsam zu arbeiten. Payer fuhr mit einem Fuhrwerk nach Bozen und von dort aus mit der Bahn über Innsbruck, Wien und Troppau nach Jägerndorf. Er versäumte es nicht, den lebensgefährlichen Sturz journalistisch auszuwerten. Die Volks- und Schützenzeitung vom 30. September druckte Payers eigenen Bericht von dem Absturz ab. Guten Kontakt zur Presse zu halten, darin war Payer zeitlebens ein Meister. Die Aufnahme der südlichen Ortler-Alpen erschien als Ergänzungsheft 27 der „Geographischen Mittheilungen“, Gotha 1869, im Umfang von 30 Seiten mit einer Karte 1:56.000, einer Ansicht im Farbdruck und drei Profilen.
GEBIETE MARTELL, LAAS UND SAENT, 1868
Im Januar 1868 war es soweit. Feldmarschall-Leutnant Baron Kuhn wurde zum k. u. k. Kriegsminister ernannt. Und tatsächlich erinnerte er sich an sein altes Versprechen gegenüber Julius Payer. Der Oberleutnant wurde jetzt dem Militärgeographischen Institut beim Infanterieregiment Nr. 36 zugeteilt. Unter Belassung dieser Verwendung wurde er am 1. Februar 1872 zum Tiroler Jägerregiment Kaiser Franz Joseph versetzt. Kuhn beauftragte Payer im Sommer 1868 mit der Fertigstellung der schon weit fortgeschrittenen kartographischen Arbeiten im Ortler- und Adamellogebiet. Diesmal dienten die Arbeiten Payers nicht seinem persönlichen Vergnügen, sondern einem offiziellen und dienstlichen Zweck, nämlich als Vorarbeiten für die österreichische Generalstabskarte.
Der Kriegsminister stellte ihm 1000 Gulden, einen Theodolit und drei Mann als Gehilfen zur Verfügung. In Bozen durfte Payer am 27. Juni aus dem Kaiserjägerregiment die erfahrenen Bergsteiger Haller, Coronna und Späth als Begleiter auswählen. Letzterer wurde bald wieder als unzuverlässig zurückgeschickt und durch Griesmayer ersetzt. Am 28. Juni kaufte Payer Wein in Meran ein und ging am folgenden Tag über Latsch nach Salt. Als nunmehr in staatlichem Auftrag tätiger Vermesser bekam er eine Wohnung im Haus des Messners Schropp neben der Kirche von Thal im Martelltal zugewiesen. Die Armee seiner Gehilfen vergrößerte sich am 1. Juli noch um den Träger Kobald sowie um den treuen Johann Pinggera. Mit großem Gepäck stieg Payers Mannschaft am 2. Juli zur unteren Marteller Alpe auf.

Kartografische Aufnahme des Martell-Gebietes im Maßstab 1: 50.000 (PGM Ergänzungsheft 29, 1872)
Die Arbeiten begannen am 3. Juli mit Vermessungen auf dem Ebenen Jöchl (2786 m). Den nächsten Tag verbrachten sie bei Regen in der Hütte. Pinggera bekam sechs Tage Urlaub. Es folgte der Aufstieg zur Peder-Ochsenhütte. Am 6. Juli erfolgte ohne den Jäger Späth um 3 Uhr in der Früh der Marsch das Pedertal hinauf über die Schildhütte auf die Äußere Pederspitze (3402 m). Es hatte Schneetreiben eingesetzt, als die Mannschaft zur Peder-Ochsenalpe abstieg, wo sie um 17 Uhr ankam. Ganz alleine beging Payer am nächsten Tag den Grat „Auf den Vertainen“. Es folgte die Besteigung der Inneren Pederspitze (3282 m) mit Abstieg über den Pederknott zur Peder-Ochsenalpe. Am 9. Juli bestieg Payer mit Haller das Pederköpfl, während die anderen die Ausrüstung in die Zufallhütte brachten. Hier ereignete sich am folgenden Tag ein, wie sich später zeigen sollte, folgenschweres Missgeschick. Durch den Genuss von verdorbener Milch und ranzigem Speck holte sich Payer einen Magenkatarrh, unter dem er nicht weniger als 10 Wochen zu leiden hatte. Zur Fortsetzung der Tätigkeit überschritt Payer das Langenfernerjoch und marschierte über die Vedretta di Cedeh zur Alpe Forno. Am 11. Juli ging Payer über das Forno-Joch nach Santa Caterina und Bormio, sodann hinauf über das Stilfser Joch nach Trafoi. Im Wirtshaus der Barbara Ortler schlief Payer erstmals seit 10 Tagen wieder in einem Bett.
Am 12. Juli traf Payer Pinggera daheim im Oberthurnhof im Suldental. Er nächtigte abends im Widum bei seinem alten Bekannten, dem Curaten Eller, und dessen Schwestern. Wieder wurde das Wetter schlecht. Am 13. und 14. Juli blieb er mit Pinggera in St. Gertraud. Seine Leute schickte er über das Madritschjoch ins Zufalltal. Am 15. Juli stand Payer mit Pinggera und dem zufällig anwesenden Touristen Wallner im strömenden Regen und Schneetreiben am Eisseepass, von dem er zur Zufall-Alpe hinabstieg. Hier beschloss Payer, seine Arbeiten für einige Tage zu unterbrechen. Sein Magenleiden plagte ihn sehr, überdies war das Wetter alles andere als gut. Er schickte am 16. Juli die Jäger zurück zu ihrem Regiment. Wallner und Pinggera gingen zurück nach Sulden. Payer selbst versuchte, in Bozen das Magenleiden auszukurieren. Sechs Tage lang, vom 17. bis 22. Juli, notierte Payer Regen. Als Ersatzmann für einen ungeeigneten Jäger brachte er den gebirgserfahrenen Griesmayer mit ins Zufalltal.
Am 24. und 25. Juli vermaß er die Umgebung der Mutspitze (2294 m). Von der Zufallhütte aus bestieg Payer mit dem tüchtigen Jäger Griesmayer am 26. Juli nochmals den Mittleren Zufall-Gipfel (3762 m). Bei der Rückkehr traf er den zurückgekehrten Pinggera in der Hütte wieder an. Mit Pinggera, Haller, Griesmayer, Coronna und seinem Diener Kobald bestieg er am 27. Juli die Vordere Rotspitze (3029 m), wo er auf dem Gipfelplateau neun Stunden lang arbeitete. Nach einem Regentag, an dem Kobald für fünf Tage Urlaub bekam, bestiegen sie am 29. Juli die Gramsenspitze (3152 m). Wieder regnete es. Payer hatte starke Schmerzen im Knie und ging mit Pinggera hinab ins Val Rabbi zur Osteria von Pizzola zur kurzzeitigen Erholung. Einen Tag und einen halben blieb er mit Fußleiden im Bett. Nachmittags wanderte er dann hinauf über die Malga Stablasol zur Malga Saent. Von dort, wo Coronna und Griesmayer zurückgeblieben waren, stiegen sie am 1. August über Val und Gletscher Sternai auf die Eggenspitze (3435 m). Noch am Nachmittag begab sich die Gruppe auf die Lorkenspitze (3351 m) und die Sällentspitze (3219 m). Unter Knieschmerzen stieg Payer hinab zur Zufallhütte am unteren Steg über die Plima nahe der Madritschmündung. Dort traf er neben Kobald auch seinen alten Freund Padilla an.
Am 2. August erfolgte ein Stützpunktwechsel mit allem Gepäck zur Unteren Alpe im Unteren Martelltal. Am 3. August arbeitete Payer 11½ Stunden auf dem Rotstallkopf (2610 m) und kartierte am folgenden Tag das Tal. Am 5. August bestieg er ohne den erkrankten Haller die Altplittschneide (3243 m). Wieder folgte ein Regentag, an dem Payers Freund Padilla sich Richtung Schweiz verabschiedete. Am 7. August ging er, noch ohne Kobald, ab 4 Uhr früh das Rothstall-Tal hinauf, stand um 11 Uhr auf der Lysispitze (3347 m). Nach Übernachtung auf der Peder-Ochsenalpe bestieg er am 8. August die Mittlere Pederspitze (3459 m), die Schildspitze (3456 m), ging über den Rosimpass zur Angelusscharte, von wo aus er den Hohen Angelus (3523 m) erklomm. Der Abstieg über die Angelusscharte durch das Lysital zur Unteren Martellerhütte wurde erneut von großen Schmerzen in Payers linker Kniescheibe beeinträchtigt.
Am 9. August erfolgte die letzte von Payers insgesamt 60 Bergbesteigungen der Ortleralpen. Nach Aufbruch um 4.30 Uhr war er ab 8.30 Uhr für einige Stunden auf der Zutrittspitze (3430 m) und konnte die Bearbeitung des Martelltales abschließen. Sein Gesundheitszustand war derart schlecht, dass Ohnmachtsanfälle drohten. Selbst der Wein, sein gängiges Allheilmittel, bekam ihm schlecht. Langsamen Schrittes kamen sie um 17.45 Uhr zur Unteren Alpe. Der 10. August war der Tag des Abschieds. Payer entließ Pinggera, „welcher weinte“. Haller und Coronna sollten sich vorweg nach Pinzolo begeben, der Diener Kobald und der Jäger Griesmayer nach Bozen. Payer ging ihnen nach Laatsch voraus. Zwar erholte er sich fünf Tage in Bozen, konnte sein Magenübel aber nicht vollständig auskurieren. Anschließend begab sich Payer mit Haller, Coronna und Grießmayer für einige Wochen in das Adamello- und Presanellagebiet, um seine topografischen Aufnahmen des Jahres 1864 zu ergänzen.
ALPINER ABSCHIED
Damit gingen im Sommer 1868 vier Jahre der intensiven Erforschung des Ortlergebietes zu Ende. Payers Bilanz war eindrucksvoll. Mehr als 70 Gipfel der Ortlergruppe hatte er bestiegen, davon 56-mal in Begleitung von Johann Pinggera. Payer, der leidenschaftliche Kletterer im Fels, und Pinggera, der versierte Bergsteiger in Eis und Schnee, stellten ein aufeinander abgestimmtes Bergsteigerpaar dar, wie es wohl selten vorkommt. Wenn das Bild vom blinden Verständnis zweier Berggefährten auch viel strapaziert wird, auf Payer und Pinggera traf es zu. 38 ihrer Gipfelerfolge waren zugleich Erstbesteigungen.
Die Universität Halle ernannte Payer in diesem Jahr für seine Verdienste um die Erforschung der Alpen zum Dr. phil. h.c. Damit fand für ihn, ohne dass er es zu diesem Zeitpunkt ahnen konnte, ein Lebensabschnitt sein Ende. Die zweite Karriere des Julius Payer, die seine Bekanntheit ins schier Unermessliche steigern sollte, nahm ihren Anfang. Sein Kindheitstraum, auf den Spuren John Franklins in unbekannte arktische Gefilde vorzustoßen, sollte Realität werden. Dorthin lenkte ihn die einflussreiche Hand seines „Civil-Protektors“.
Auf Initiative von August Petermann war im Frühjahr 1868 die Erste Deutsche Nordpolarexpedition unter Kapitän Koldewey in arktischen Gewässern unterwegs. Am 9. Oktober kam das Expeditionsschiff „Grönland“ wieder nach Bremerhaven zurück. Die Nachricht der Rückkehr war binnen weniger Tage dank der elektrischen Telegrafie in allen Zeitungen zu lesen. Payer bekam ein solches Blatt in die Hand und las seinen Helfern daraus begeistert vor. Bald sollte er selbst in der Arktis weilen: „Über Innsbruck reiste ich nach Wien, woselbst mich ein Brief Dr. Petermanns zu meiner höchsten und freudigsten Überraschung zur Teilnahme an der Nordpolar-Expedition einlud.“ (Payer 1872, S. 36). Der Einladung Petermanns konnte er als Oberleutnant nur folgen, wenn der Staat und sein Dienstherr, der Kriegsminister, einverstanden waren. Die Zusage kam, genoss er doch die Gunst des Generals von Kuhn, „…eines Mannes, vor dem sich alles beugte“. (Rauchensteiner 2001, S. 44)
Mit der Initiative zu den Polarfahrten suchte August Petermann die Bestätigung einer gewagten Theorie zu erreichen. Er war der Ansicht, dass dank des Golfstroms das Meer zwischen Spitzbergen und Nowaja Semlja auch im Winter nicht ganz zufrieren würde. Nach Durchdringen eines Gürtels von Treibeis könne ein Dampfer bis zum Nordpol vordringen. Diese These wurde in Österreich und Deutschland mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Auf ihr beruht auch die große, von Carl Weyprecht und Julius Payer von 1872 bis 1874 durchgeführte Österreichisch-Ungarische Nordpolarexpedition, die zur Entdeckung des Kaiser-Franz-Josef-Landes führen sollte.

Richtfest beim Bau der Payerhütte auf dem Tabarettakamm, 1875 (Katalog 2012)
Payers Name lebt in den Ostalpen vielfach fort. Auf dem Tabarettakamm am Ortler auf 3020 m wurde 1875 auf Initiative von Johann Stüdl (1839–1925) die Payerhütte eingeweiht. Johann Stüdl, ein Kaufmann aus Prag und bedeutender Alpinist, war selbst im Umfeld der Glocknergruppe tätig gewesen. Er war Gründungsmitglied des Deutschen Alpenvereins und 50 Jahre lang Obmann der Sektion Prag des Alpenvereins. Heute gehört die Payerhütte der Sektion Mailand des Italienischen Alpenvereins. Zwar konnte Payer bei der Eröffnungszeremonie der Payerhütte nicht anwesend sein, doch die Namengebung nahm er mit Dank und Stolz wahr.
Die Verdienste Payers um die Erschließung des Ortlergebietes führten 1892 zur Errichtung einer Payer-Gedenktafel in Sulden durch den Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Sie trägt den Kopf Payers in Seitenansicht und erwähnt auch den Namen Pinggeras. Die Festrede hielt Johann Stüdl am 7. September des Jahres. (KA A/204:4 Bl. 160) Payer zu Ehren gibt es das Payer-joch (3434 m) zwischen Zebru- und Königspitze, die Payerspitze (3396 m), eine Gratanhebung 15 Minuten von der Geisterspitze entfernt, die Cima di Payer (3050 m) nordöstlich der Mandronhütte, den Passo Payer (2985 m) an einem Übergang von der Mandronhütte über den Adamellokamm und die Vedretta Payer, einen kleinen Gletscher am Passo Payer. Am oberen Ende des Val di Genova, südlich des Corno di Lago Scuro, gibt es seit 1994 auf 2430 m Höhe an der Stelle der alten Mandron-Hütte das „Centro di Studi Glaciologi Julius Payer“. In Sulden betreibt die Familie Elmar und Christine Reinstadler das Drei-Sterne Hotel „Julius Payer“. Ebenfalls in Sulden, im Messner Mountain Museum Ortles, sind zahlreiche Gemälde von Payers Hand zu sehen. Ein Schlepplift und eine Piste auf dem Stilfser Joch tragen den Namen „Payer“.

Tafel an der Payer-Hütte, 2010 (F. Berger)
KAPITEL 5
DIE ZWEITE DEUTSCHE POLARFAHRT (1869–1870)
DIE VORBEREITUNGEN ZUR EXPEDITION
Eine erste reale Vorstellung von polaren Welten bekam Payer 1864 beim Anblick der ausgedehnten Gletscher der Adamello- und Presanellagruppe. Vier Jahre später las er jene Zeitungsmeldung, welche die Erste Deutsche Nordpolarexpedition beschrieb und erzählte seinen Kaiserjägern und Bergführern davon (Müller 1956, S. 65). Die in diesem Artikel beschriebene Unternehmung des Jahres 1868 hatte die Küste Grönlands nicht erreichen können. Die Expedition wurde weithin als Fehlschlag bewertet. Für eine zweite Expedition würde man stärkere Schiffe benötigen. Erreichte man Grönland, dann könnte das Schiff als Stützpunkt und Ausgangspunkt für Reisen in das Innere des Landes und entlang der Küste der großen Insel dienen.
Zu diesem Zweck fand in Bremen am Abend des 24. Oktober 1868 die Festversammlung für eine Zweite Deutsche Nordpolarfahrt statt (Krause 1992, S. 151 f.). August Petermann stellte in einer längeren Rede die Grundzüge und Ziele dieser zweiten Expedition vor. Beabsichtigt war eine Fahrt mit zwei Dampfern nach Ostgrönland, um von dort aus mit einer Landexpedition in das zentrale Polargebiet vorzustoßen, wo eine Überwinterung unternommen werden sollte. Der Bremer Großkaufmann H. H. Meier stellte dafür 100.000 Taler Zuschuss in Aussicht. Zur Durchführung der Landexkursionen benötigte man einen erfahrenen „Gletscherfahrer“. Unter dem Eindruck dieser Überlegungen hatte Petermann bereits bei Julius Payer angefragt, ob er dazu bereit wäre, als Topograph und Führer bei den Schlittenreisen an dieser zweiten Deutschen Nordpolarexpedition teilzunehmen. Durch seine Publikationen und seine Karten galt Payer als bestens ausgewiesen und die Empfehlung Petermanns wog schwer. Julius Payer wurde unter dem Eindruck seiner alpinistischen Qualitäten als Expeditionsteilnehmer ausdrücklich akzeptiert. Payer sah bei sich selbst noch einige Defizite auf dem Gebiet der Geologie. Daher besuchte er im Winter 1868/1869 die universitären Vorlesungen des renommierten Geologen Ferdinand von Hochstetter, der im Übrigen auch Privatlehrer des Kronprinzen Rudolf war.
Julius Payer bekam im Januar 1869 Urlaub von seinen Dienstpflichten und konnte sich den Vorbereitungen zur Polarfahrt widmen. Bei seinen geologischen Studien in Wien traf Payer den Universitätsassistenten Dr. Gustav Laube (1839–1923) wieder, mit dem er schon seit seiner Jugend in Teplitz bekannt war. Nach Studium in Prag, München und Tübingen wurde Gustav Laube 1865 promoviert und 1866 im Fach Paläontologie habilitiert. Durch den Ankauf eines zweiten Schiffes, der „Hansa“, wurde Laubes Expeditionsteilnahme möglich. Später wurde Laube Professor für Mineralogie und Geologie am Polytechnischen Institut in Prag und an der Deutschen Universität Prag. Er verfasste zahlreiche Werke, insbesondere zur Geologie Böhmens.
August Petermann veröffentlichte im März 1869 einen Überblick zu den aktuellen Expeditionsplänen. Ziel war die Erforschung Ostgrönlands nördlich von 75 Grad nördlicher Breite. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 80.600 Talern beschaffte das „Bremer Comité für die Deutsche Nordpolarfahrt“. Mit diesem Betrag konnten die zwei Schiffe ausgerüstet werden. Im besten Einvernehmen aller Beteiligten schritten die Vorbereitungen zur Abfahrt voran. Die k. k. geographische Gesellschaft in Wien sah wegen der Teilnahme Julius Payers und Gustav Laubes das Unternehmen als ein partiell österreichisches an. Sie brachte die Angelegenheit im Abgeordnetenhaus zur Sprache. Ihr Präsident Ferdinand von Hochstetter verlas einen Aufruf zu Geldbeiträgen, welcher „den geehrten P. T. Mitgliedern des hohen Reichsrats zur Kenntnis“ gegeben wurde. Die Expedition sei der besonderen Unterstützung wert durch „die persönliche Theilnahme eines Österreichers, des k. k. Oberlieutenants Julius Payer.“
Der finanzielle Beitrag Österreich-Ungarns an den Kosten der Zweiten Deutschen Nordpolar-Expedition war durchaus ansehnlich. Der Kaiser selbst gab 1000 Gulden und Erzherzog Karl Ludwig spendete 57 Taler. Vereine, Gesellschaften und Privatpersonen aus Wien sammelten zusammen ca. 880 Taler. Darüber hinaus zahlte die k. k. Akademie der Wissenschaften eine Reisesubvention von 400 Gulden, ausdrücklich gedacht für die Teilnahme von Dr. Gustav C. Laube und Oberleutnant Julius Payer (PGM 1869, S. 239). Aus Prag, dem Wohnsitz Gustav Laubes, kamen durch Sammlungen ca. 350 Taler zusammen. Bemerkenswert ist die Höhe der Spendengelder aus Teplitz. An die 150 namentlich bekannte Bürgerinnen und Bürger des kleinen Kurortes spendeten Beträge zwischen 20 Gulden und 30 Kreuzern, die Stadtgemeinde selbst 100 Gulden. Insgesamt überwies Bürgermeister Stöhr Ende Juli die Summe von 293 Talern aus Teplitz nach Bremen. Diese Sammlung ist ein Beleg dafür, wie populär Julius Payer bereits in seiner Geburtsstadt war (PGM 1869, S. 240). Die freiwilligen Beiträge aus Deutschland und Österreich für die Expedition beliefen sich Anfang Dezember 1869 auf 46.582 Taler und einen Groschen.
Am 28. Mai 1869 besuchte Payer in Begleitung von Dr. Gustav Laube August Petermann in Gotha. Die Reise ging weiter nach Hamburg zu Wilhelm von Freeden, dem Leiter der Deutschen Seewarte. Von hier aus besuchten sie auf Empfehlung Petermanns den Polarforscher Adolf Erik Nordenskiöld in Stockholm, um mit ihm die Möglichkeiten und Bedingungen der Expedition zu erörtern. Schon in Hamburg machte der künftige Expeditionsleiter Carl Koldewey die Bekanntschaft Payers und Laubes; er beschrieb sie als „prächtige Leute“. Der Kapitän ließ zu Ehren der beiden Böhmen abends im Zoologischen Garten ein feierliches Diner veranstalten, belustigte sich aber auch ein wenig über Laubes und Payers befremdliche Vorstellungen von der Seefahrt und dem Leben an Bord (Krause 1992, S. 174). Zur Ergänzung der Ausrüstung ließ Payer aus Wien eine größere Sendung von Gewehren und Munition nach Bremen schicken (Krause 1992, S. 185). Teil seiner Ausrüstung war auch jener Theodolit, den ihm der Kriegsminister geschenkt hatte und der ihm bei der Aufnahme der Ostalpen so gute Dienste geleistet hatte. Das Instrument sollte auch noch die Expedition nach Franz-Josef-Land mitmachen, musste aber 1874 dort zurückgelassen werden (Müller 1956, S. 43).
August Petermann verfasste für die Zweite Deutsche Nordpolarexpedition eine Instruktion in 31 Paragrafen und druckte sie in seiner Zeitschrift ab. Der Paragraf 24 ist ausdrücklich Julius Payer gewidmet:
„In richtiger Würdigung und Verwendung einer so erprobten Kraft wie Oberlieutenant Julius Payer sind so häufig als nur immer möglich, besonders im Frühjahr 1870, Gletscherfahrten und Exkursionen ins Innere von Grönland zu arrangieren, die unter dessen Kommando zu stellen sind. Eigentliche Gletscherfahrten von Belang in den Polargegenden gab es bis jetzt nicht; der Versuch des berühmten Matterhornbesteigers Whymper in West-Grönland mit Schlitten und Hunden misslang vollständig, da er nur ½ Deutsche Meile vordringen konnte. Die Exkursion des Dr. Hayes von Fort Foulke aus entbehrt aller sicheren Bestimmungen und Anhaltspunkte, und hat daher für die Wissenschaft keinen Werth. Im Übrigen sind noch nie ordentliche Versuche gemacht worden, nicht einmal in den wenigausgedehnten Gebieten Spitzbergens. Es wäre daher von hohem Interesse, wenn es Herrn Payer gelänge, das vergletscherte Innere von Grönland bis zu einer beträchtlichen Entfernung von der Küste zu erforschen.“
Von großer Bedeutung für die Expedition sollte die Frage der Namengebung neu entdeckter Gebiete sein. Hierzu gab es in den Instruktionen Petermanns ebenfalls einen Paragrafen: „§ 27 Was die Namen für die zu entdeckenden Länder und alle ihre einzelnen Punkte anlangt, so bleibt die Bestimmung der großen Mehrzahl für die gemeinschaftliche Anfertigung der Karte daheim überlassen, wobei den hauptsächlichsten Freunden und Unterstützern der Expedition die erste Berücksichtigung zu Theil werden wird.“ (Müller 1956, S. 73; Krause 1992, S. A40f.)