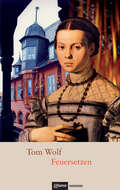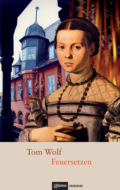Kitabı oku: «Lüneburger Totentanz», sayfa 3
Auch Reyner Stolzfuß hatte ein Geschäft. Der Gesandte eines Revaler Kaufmanns wünschte ihn zu sprechen und ihm im Auftrag seines Herrn ein Angebot zu unterbreiten, von dem ein Schreiben aus Reval sinngemäß behauptete, nur ein Narr könne es abschlagen. Guten Angeboten war Stolzfuß immer aufgeschlossen, und so hatte er die Einladung des Gesandten zum Essen angenommen. Der Mann, der Albrecht Gregorius hieß, logierte in der feinen Herberge Bei der Ratsmühle, er musste also wirklich Geld im Rücken haben.
Da Maria, Piet und Geseke Peters sich nicht mehr vor der Saline aufgehalten hatten, waren die Frauen in Sorge und wünschten, so schnell wie möglich nach Hause zurückzukehren. Tidemann Stolzfuß erbot sich, sie zu begleiten, schließlich schickte es sich für eine bürgerliche Frau nicht, unbegleitet durch die Stadt zu gehen, nur manchmal auf den Markt, aber da war dann immerhin eine Magd dabei. So blieben denn am Ende nur Martin Grüneberg und Sebastian Vrocklage als mögliche Zechkumpane des Ritters übrig. Da sie Heinrich so betrübt sahen, willigten sie aus Mitleid ein, ihm für ein paar Stunden Gesellschaft zu leisten; außerdem waren sie froh, dass ihnen das Trauerhaus noch einige Zeit erspart bleiben würde.
Wein nahm nur der Ritter, Martin und Sebastian hielten sich ans Dünnbier. Alle drei hingen Erinnerungen an Ereignisse nach, die sie vor zwei Jahren schon einmal zusammengeführt hatten: Balthazar Vrocklage, Sebastians Vater, war ermordet worden, der Ritter und der Weddeherr hatten einen großen Anteil an der Aufklärung des Verbrechens gehabt, wobei Grüneberg von seinem Verstand, der Ritzerow mehr von seiner Intuition geleitet worden war. Sie schien nicht einmal bei größter Trunkenheit zu versagen.
Für die Untersuchung eines Mordes innerhalb der Mauern der Stadt war der Lüneburger Rat zuständig und hier vor allem die Richteherren und der Gerichtsvogt. Jedermann durfte davon ausgehen, dass sie ihr Handwerk verstanden, und wenn sie einmal gar nicht vorankamen, konnten sie immer noch den Scharfrichter rufen. Um jemanden zu foltern, brauchte man allerdings nicht nur einen Verdächtigen, man musste seiner auch habhaft sein. Längst hatte Martin Grüneberg beschlossen, sich in die Untersuchung auf seine Weise einzumischen. Über Umwege war Lüdeke Peters immerhin seit Magaretes so blutig beendeter Hochzeit mit ihm verwandt.
Grüneberg zog den Ritter und Vrocklage ins Vertrauen. Er berichtete ihnen von der Entdeckung des Spittlers im Josephus Flavius, den Heinrich von Ritzerow zu seinem Erstaunen sogar kannte.
»Bücher über Kriege gehören zu den Leidenschaften aller Ritzerows«, meinte der Ritter und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Becher. Dem Weddeherrn, der schon gegen das Dünnbier nicht ankam, drehte sich der Magen um. »Meinen Vorfahren ist es nie gelungen, an den Kreuzzügen teilzunehmen, denn sie sind spätestens in den französischen Schenken oder am Hals französischer Weiber versumpft. Das hatte natürlich auch eine positive Seite: Während andere Edelleute reihenweise verblutet sind, haben meine Vorfahren überlebt. Sie sind auf dem Gut der Ritzerows steinalt geworden und haben sich von den Verwaltern abends Kriegsbücher vorlesen lassen. Ich kann mich natürlich nur noch an meinen Großvater Heinrich den vierten und meinen Vater Heinrich den fünften Ritzerow erinnern. Den Judäischen Krieg haben sie gehasst. Es fehlte ihnen die Ritterlichkeit. Zu viel Verrat, zu viele andauernd wechselnde Bündnisse. Ein Ritter hat ein treuer Vasall zu sein, wie man an meinen Vorfahren sieht. Sie haben ihren Lehnsherren Treue geschworen, sind dann aber doch abgesprungen. Wären sie nicht feige gewesen, ich lebte vielleicht nicht.«
»Mir scheint der Einfall des Spittlers weit hergeholt«, unterbrach Sebastian die Familienbeichte des Ritters. »Die jungen Männer, die sich scheinbar um unseren … um Lüdeke gekümmert haben, trugen Kittel. Ich hielt sie für Bauern. Auch Bauern, die des Lesens kundig sind, interessieren sich nicht für alte Kriege. Im Gegensatz zu Rittern«, fügte er rasch hinzu.
»Es wird ein Auftraggeber hinter ihnen stecken«, mutmaßte Ritzerow.
»Das denke ich auch«, stimmte Grüneberg zu.
»Wir müssen also den Knaben suchen und diese beiden Männer«, sagte Heinrich.
»Das ist vermutlich einfacher gesagt als getan«, fürchtete Sebastian Vrocklage.
»Der Junge hatte Bierfässer geladen?« wollte der Ritter wissen.
»Ja.«
»Dann muss er sie einem Brauer gestohlen haben und das Gespann womöglich noch dazu.«
»Oder er ist Lehrbursche bei einem Brauer«, gab Grüneberg zu bedenken. »Der vielleicht seine Finger in der Verschwörung hat.«
»Warum sollte ein Brauer einen Salzherrn töten lassen?«, fragte Sebastian skeptisch.
»Das weiß ich nicht. Außerdem müssen wir mit dem Brauer noch nicht den Auftraggeber haben.«
»Ich finde sie!«, rief der Ritter und sprang plötzlich auf. Die zwei an einem Nebentisch sitzenden Männer, die dem Gespräch gelauscht hatten, wandten ihm nun ihre volle Aufmerksamkeit zu. Was Ritter, Weddeherr und Kaufmann nicht wussten: Sie gehörten zum Gefolge des Herrn von Baerck. Dieser hatte vom Herzog den Befehl erhalten, die Ermittlungen in der Stadt zu beobachten und sich unauffällig an ihnen zu beteiligen. Grund für das herzogliche Engagement war ein Schreiben aus Lübeck; der dortige Rat hatte angefragt, ob sich Lübecker Bürger in Lüneburg noch sicher fühlen könnten. Mit der Reichsstadt verdarb es sich nicht einmal ein Herzog gern, zumal ihm sein Nachbar, Erich V. von Sachsen-Lauenburg, vorführte, wie einträglich es war, mit Lübeck Geschäfte zu machen.
»Was habt Ihr vor?«, fragte Grüneberg, der Schlimmes ahnte.
»Ich werde allen Lüneburger Brauern auf den Zahn fühlen.«
»Dabei werden einigen sicher alle Zähne ausgehen«, meinte Martin.
»Wenn es notwendig ist.« Der Ritter ließ sich nicht mehr bremsen. Bevor Grüneberg und Vrocklage irgendetwas unternehmen konnten, hatte Heinrich den Gastraum verlassen und war aus der Herberge gestürmt. Zurück ließ er eine Zeche von drei Pfennigen, die Grüneberg entrichtete. Auch die Männer vom Nebentisch bezahlten.
4. KAPITEL
Eine Keilerei
Nachdem Heinrich von Ritzerow blindwütig die Heiliggeiststraße bis zum Sande hinabgelaufen war, beruhigte er sich etwas, und sein Verstand begann wieder zu arbeiten. Wie alle männlichen Mitglieder seiner Familie litt auch er unter der Krankheit der Ritzerow: einem unbändigen Drang nach Gerechtigkeit. Neben der Trunksucht und seinem übermäßigen Interesse an Frauen war dies die Eigenschaft, die ihm am meisten schadete. Gerechtigkeit herzustellen, wie der Ritter sie verstand, kostete immer Geld und manchmal auch einen Knochenbruch.
Vorübergehend zur Besinnung gekommen, setzte sich Heinrich auf eine Bank mit zwei sorgfältig gemeißelten Beischlagwangen, deren eine den heiligen Georg, deren andere den heiligen Martin abbildete. Für diese Werke hatte der Ritter keinen Sinn. Er fragte sich, wie es ihm gelingen sollte, alle Lüneburger Brauer ausfindig zu machen und, da der Knabe ja die Stadt durchs Altenbrücker Tor verlassen hatte, auch die der weiteren Umgebung, denn in der Nähe der Stadt war es jedem verboten, ein Gewerbe auszuüben. Heinrich beschloss, dem Ältermann der Braumeister seine Aufwartung zu machen, in dessen Amtsrolle sicher die Namen aller Brauberechtigten eingetragen waren.
Willekin Bodeker war seit zwei Dutzend Jahren Vorsteher des Braueramtes und ein gemütlicher Mann. Nach dem Besuch, den ihm ein wild gewordener Edelmann abgestattet hatte, war Bodeker so erschöpft, dass er seiner täglichen Gewohnheit nicht nachkam: Immer, wenn die Kirchenglocken die zweite Nachmittagsstunde verkündeten, pflegte er das Bier zu prüfen, das er braute. An diesem Tag tat er es nicht. Er legte sich zu so ungewöhnlicher Stunde zu Bett, dass seine Frau schon fragte, ob sie nach dem Medicus schicken solle. Bodeker lehnte ab. Er brauchte keinen Arzt, er brauchte Ruhe.
Ritter von Ritzerow hingegen fühlte sich beschwingt. Der Ältermann hatte ihm die Namen der Brauer in eine Wachstafel ritzen und dann etwa dreißigmal vorlesen müssen, bis sich Heinrich auch alle Namen der Häuser eingeprägt hatte, auf denen die Braugerechtigkeit lag. Zur Not trug er die Wachstafel bei sich und war bereit, jeden beliebigen Mann auf der Straße anzuhalten, der ihm gebildet auszusehen schien.
Das erste Haus, das Heinrich aufsuchte, hieß Goldene Kugel. Eine solche Kugel zierte den Dachfirst, und vor dem Haus roch es betörend nach Gerstenmalz und Hopfen. Mit seinen kräftigen Händen schlug der Ritter an das Tor. Ein Mann, der eine Lederschürze vorgebunden hatte, öffnete ihm. Bevor er ein Wort sagen konnte, war Heinrich von Ritzerow in die Diele geschlüpft.
Der auf diese Weise überrumpelte Mann war keineswegs der Inhaber des Hauses, sondern der angestellte Braumeister. Dieser rief nach seinen Gesellen und Lehrjungen, die sofort angelaufen kamen. Schließlich erschien auch der Besitzer der Gebäude, der Sülfmeister Jacob Dume. Der Ritter hatte den Dolch gezückt, hielt ihn dem Braumeister unter die Nase und verlangte Auskunft, ob man ihm vielleicht ein Fuhrwerk mit leeren Fässern gestohlen habe. Der Sülfmeister war erstarrt und schaute sprachlos zu, auch die Gesellen und Lehrlinge wussten nicht, was sie tun sollten; jedes Eingreifen hätte Lebensgefahr für den Meister bedeuten können. Der versicherte, kein Fuhrwerk verloren zu haben. Natürlich verstand jeder, worauf der Ritter anspielte. Um ihn loszuwerden, verwies der Braumeister schließlich auf Johannes Vormaker, einen Brauer, dem man alles zutraue. Dorthin solle sich der Ritter wenden und er werde gut bedient.
Dem Ritzerow schien dies ein guter Rat. Dass ein Mann von schlechtem Ruf leicht in ein Verbrechen zu verstricken war, verstand sich von selbst. Heinrich steckte den Dolch wieder ein und verließ das Haus.
Draußen wurde er erwartet. Der Herr von Baerck und seine Männer hatten einen kleinen Kreis gebildet, aus dem es kein Entrinnen gab.
Nach dem Abendessen, bei dem alle sehr schweigsam gewesen waren und immer wieder verstohlene Blicke auf die totenblasse Maria Peters geworfen hatten, waren Martin Grüneberg und Sebastian Vrocklage noch einmal aus dem Haus gegangen. Ihr Ziel war der Gerupfte Schwan, jenes Quartier, in dem die »Sikarier« eine Nacht verbracht hatten.
Da sie sich in das Nachtjackenviertel begeben mussten, trugen sie Waffen. Es dämmerte bereits, also hatten sie auch Fackeln dabei. So ausgerüstet, nahmen sie den Weg zur nördlichen Stadtmauer unter die Sohlen.
Je weiter sie vorankamen, desto enger und kotiger wurden die Straßen. Üble Gerüche stiegen ihnen in die Nase, Gebäude mit hohen Giebeln gab es längst nicht mehr. Stattdessen hatten die Häuser der Gasse ihre Traufseite zugewandt. Sie waren viel niedriger als die der Wohlhabenden, hatten manchmal nur ein Geschoss. Hier lebten die einfachen Salinenarbeiter, aber auch die Stadtarmen, denen um ihr Seelenheil besorgte Patrizier unentgeltlich eine Bude zur Verfügung stellten.
Bürger ließen sich nur selten oder überhaupt nicht sehen, die Stadtwächter patrouillierten niemals allein.
Die Fensterläden des Gerupften Schwans waren geschlossen, aber durch breite Ritzen in dem schlechten Holz drang noch ein Lichtschein. Außerdem konnte man hören, dass es im Inneren hoch herging. Eine Frau sang mit krächzender Stimme das Lied vom Störtebeker, Männer grölten und klatschten, und ein rhythmisches Stampfen verriet, dass sie tanzten. Sowohl Martin Grüneberg als auch Sebastian Vrocklage fühlten sich unbehaglich, andererseits wollten sie noch möglichst viel in Erfahrung bringen. Lange nämlich würden sie in Lüneburg nicht mehr bleiben können. Ihre Geschäfte riefen sie nach Rostock. Ein Schiff, an dem ihre Mascopei Anteile besaß und das nach Bergen auslaufen sollte, musste befrachtet werden, außerdem rechneten sie mit dem baldigen Einlaufen eines Konvois von der Baie, wenn die Koggen und Holke diesmal durchkamen: Der seit 1419 anhaltende Kaperkrieg zwischen Aragonien und der Hanse hatte schon öfter dazu geführt, dass einzelne Schiffe oder gar ganze Salzflotten verloren gingen.
Martin Grüneberg ermannte sich und stieß die Tür zu der Kaschemme auf. Es gab keine Diele, sofort betrat man den Schankraum. Alle Blicke richteten sich auf die bürgerlich gekleideten Männer, der Gesang verstummte, die Männer und Frauen verhielten im Tanz. Bürger, das wurde sofort klar, waren nicht willkommen. Keiner der Anwesenden, davon war Martin Grüneburg überzeugt, war in der Lage, das Bürgerrecht zu erwerben und den Bürgereid abzulegen. Man hatte es mit Beisassen zu tun, mit rechtlosen Einwohnern.
»Wo ist der Wirt?«, fragte Grüneberg laut. Aus der Menge der Gäste löste sich ein kleiner, stiernackiger Mann, dem man zutraute, einen Bären zu Boden zu ringen.
»Das bin ich, Herr! Was kann ich für Euch tun?«
»Gib den Musikern den Befehl, wieder aufzuspielen«, verlangte Grüneberg. »Man soll uns gar nicht weiter beachten. Und dann zeige uns das Zimmer, in dem jüngst zwei Männer nächtigten.«
»Nach denen der Gerichtsvogt und seine Büttel sich schon erkundigt haben, Herr?« Der Wirt gab den Musikanten einen Wink. Nachdem die Musik wieder eingesetzt hatte, wurde auch erneut gesungen und getanzt. Allerdings wurden auch immer noch feindselige oder begehrliche Blicke auf die beiden seltsamen Gäste gerichtet, und mancher Spitzbube überlegte vermutlich, ob sich ein Überfall auf sie lohnen würde. Wahrscheinlich ja, allerdings riskierte man damit das Rad.
Der Wirt hatte nichts dagegen, dass Grüneberg und Vrocklage das Zimmer einer Inspektion unterzogen. Er stellte ihnen sogar ein Talglicht zur Verfügung und wartete in der Tür auf Anweisungen. Die beiden Männer, die so unverhofft hereingeschneit waren, mussten etwas mit der Obrigkeit zu tun haben, und mit der Obrigkeit, die Schanklizenzen vergab, verdarb es sich nur ein Dummkopf.
Obgleich kein Insekt sich blicken ließ, wusste Martin Grüneberg sofort, dass der kleine und stickige Raum von oben bis unten verlaust und verwanzt war. Vier Betten hatten Platz gefunden. Sie waren mit einfachen Strohsäcken ausgestattet, die sowohl als Kissen für den Kopf als auch als Bettdecke dienten. Bezüge, die man wechseln konnte, existierten nicht.
»Ist dir an den Männern etwas aufgefallen?«, erkundigte sich Vrocklage.
»Sie waren stumm«, sagte der Wirt und verbeugte sich.
»Stumm? Wie konnten sie dann ein Zimmer mieten?«
»Sie haben mit den Fingern gezeigt«, erklärte der Wirt. »Zuerst auf ihre Brust. Da wusste ich: Sie wollen ein Nachtlager. Dann hielten sie einen Finger in die Höhe. Daraus entnahm ich: für eine Nacht. Ich wiederum zeigte ihnen, was es kosten würde. Wir nehmen für jede Übernachtung einen Scherf.«
»Zwei zungenlose Mörder?« Martin Grüneberg schüttelte den Kopf. »Daran glaube ich nicht.«
»Es waren Ausländer, Herr! Einmal, als sie sich unbelauscht glaubten, haben sie ein paar Worte gewechselt.«
»Ausländer, Wirt?«
»Ganz sicher, Herr! Ich denke, es waren Dänen.«
Nicht dass er Prügel bezogen hatte, schmerzte den Ritzerow, sondern die Verletzung seiner Ehre. Der Herr von Baerck war immerhin ein gleichrangiger Partner, der sich vorgestellt hatte, bevor er zuschlug. Seine Begleiter hätten Heinrich nie anrühren dürfen. Diese Schmach gehörte mit Blut abgewaschen.
Das Dienstmädchen vom Gasthaus Zu den vier trunkenen Sonnen behandelte Heinrichs Stirn mit essigsaurer Tonerde, was ihm unendlich wohl tat. Er war so weit wiederhergestellt, dass er ihr an die Brust griff, was anfangs mit einem Kichern, dann aber mit Zurückweisung beantwortet wurde. Der Ritter handelte nur aus Gewohnheit, eigentlich war er an dem Mädchen nicht interessiert. Ihn beschäftigte nur ein Gedanke: wie er sich an Baerck und seinem Gefolge rächen konnte.
Wut und Hass kochten in ihm, denn er war ein Ritzerow. Ein Ritzerow ließ sich nicht von jedermann anfassen. Ritzerows waren nie in den Krieg gezogen, aber Fehden und Händeln waren sie nicht ausgewichen. Bis Lüneburg hatte sich das offenbar nicht herumgesprochen. Heinrich würde den Baerck Mores lehren.
»Verschwinde!«, zischte er die Magd an. Die war sich keiner Schuld bewusst, aber übellaunigen Herren gehorchte man besser, also trollte sie sich. »Dummes Weib!« Der Ritter erhob sich von seinem Lager. »Auch ein herzoglicher Beamter hat keine Knochen aus Gold im Leib«, redete er sich gut zu. »Es wäre doch gelacht … Ja, das wäre es wohl!«
Bei den Wirtsleuten erkundigte sich Heinrich nach der Lüneburger Herberge mit dem schlechtesten Ruf. Das Ehepaar, das glücklich über einen Gast von Adel war, gab sich entsetzt. Ob der Herr die Unterkunft wechseln wolle, erkundigten sie sich verwirrt, doch Ritzerow konnte sie beruhigen. Er brauche nur ein paar Männer für eine heikle Aufgabe, erklärte er. Daraufhin nannte ihm der Wirt den Gerupften Schwan. Heinrich ließ sich den Weg beschreiben, der durch das ganze vermaledeite Lüneburg zu führen schien, dann ging er los. Auch der Wirt verließ das Haus. Bei dem Bürgermeister Stolzfuß zeigte er an, dass ein Ritter von Ritzerow aus Mecklenburg im Gerupften Schwan offenbar Mörder dingen wolle.
Noch ein weiterer Lüneburger Wirt hatte sich an diesem Abend viel zu wundern. Kaum hatten die beiden Bürger sein Haus verlassen, kreuzte ein Edelmann auf. Der Unterschied war nur: Der Inhaber des Gerupften Schwans würde nie jemanden anzeigen. Wenn sich das bei seinen zwielichtigen Kunden herumsprach, war er verloren.
Auch dem Ritter begegnete man erst einmal mit Misstrauen, doch da Heinrich viel mit Bauern zu tun hatte, beherrschte er die Sprache der einfachen Leute. Und was noch viel wichtiger war: Er konnte saufen. In der Schänke hatte er bald eine Gruppe von Anhängern um sich geschart, die das Hauen und Stechen liebten. Der Gerupfte Schwan machte seinem Ruf alle Ehre, und der Ritter war sicher, dass der Herr von Baerck und seine Männer noch in der kommenden Nacht gerupft werden würden.
Der herzogliche Beamte weilte immer, wenn er von Celle nach Lüneburg kam, in dem Stadthaus an der Großen Bäckerstraße, das schon sein Urgroßvater errichtet hatte, der ebenfalls ein Ministerialer des Herzogs gewesen war; seinerzeit hatte der Landesherr allerdings noch auf dem Kalkberg residiert, bevor ihn die Lüneburger 1371 aus der Burg warfen. Der Herr von Baerck genoss nicht das Bürgerrecht, war aber ein stets willkommener und höchst achtbarer Edelmann, dessen Vater als geschickter Diplomat gegolten hatte: Im Lüneburger Erbfolgekrieg hatten sich die Herzöge so hoch verschuldet, dass sie 1397 quasi kein Geld mehr hatten und ihre Stadt Harburg an Lüneburg, Hamburg, Lübeck und Hannover verpfänden mussten. Der Vater des Herrn von Baerck hatte den Pfandvertrag mit ausgehandelt, und weil es immer wieder Kräche und Fehden mit den Unterpfandnehmern gegeben hatte, hatte er dafür gesorgt, dass seit dem Jahre 1417 nur noch Lüneburger Ratsherren die Herrschaft auf der Harburg ausübten, was die kriegerischen Auseinandersetzungen ein für alle Mal beendete. Seitdem war der Lüneburger Rat allen von Baercks wohlgesinnt.
Der derzeitige Herr von Baerck war obendrein ein Schöngeist. Er drechselte Gesänge, die er seiner Familie allabendlich vortrug. Nach seiner Konfrontation mit dem Ritzerow hatte er ein Lied verfasst, das sich mit dem Schmuddelritter aus dem wilden Mecklenburg befasste. Kaum hatte er seine Frau und seine Kinder in der Stube versammelt, um ihnen das Werk zu Gehör zu bringen, als ihn eine ganz andere Musik aus dem Konzept brachte: Irgendwelche Raubeine hatten nämlich damit begonnen, die teuren Glasfenster einzuwerfen.
Der Herr von Baerck brauchte nicht viel Fantasie, um zu ahnen, wer hinter dem Anschlag steckte. Seine Gehilfen, die in einem Seitenflügel sowie in ein paar Buden auf dem Hof ihre Nächte verbrachten, waren sofort auf den Beinen. Jeder war bewaffnet, selbst die Dienstboten: Sie hatten Knüppel, Forken und sogar eine Armbrust bei sich, über die sich Herr von Baerck sehr verwunderte.
Das Tor öffnete er selbst, unterstützt von seinem Kammerdiener. Die Flügel standen noch in einem spitzen Winkel, da stürmten bereits die Ganoven und ihr Ganovenfürst, der Herr von Ritzerow, in die Diele. Herr von Baerck griff nach seinem Schwert, das ihn als Mann von Adel kennzeichnete. Heinrich besaß auch eins, und sofort begannen die beiden zu fechten. Klinge kreuzte Klinge, Funken sprühten. Die Anhänger beider Parteien übten sich währenddessen im Kampf mit den übrigen Instrumenten. Fäuste flogen, Knüppel trafen auf Oberarme, Brüste und, im schlimmsten Fall, auf Unterkiefer, einem der Dienstleute gelang es, die Armbrust zu spannen, aber der Pfeil rauschte durch das Tor in die Nacht. Die Frau des Hauses schrie, die Kinder jammerten. Obwohl schon angetrunken, focht Heinrich von Ritzerow mit Bravour. Er verwirrte den Herrn von Baerck durch Finten so sehr, dass es ihm in einem Überraschungsangriff gelang, dem herzoglichen Beamten eine Ohrfeige wie ein Peitschenhieb zu erteilen.
Für einen Augenblick erstarrten alle Kämpfenden und schauten ungläubig auf den Herrn von Baerck. Die Schmach, die der Ritzerow ihm angetan hatte, war unvorstellbar. Das Gesicht des Herrn von Baerck lief tiefrot an. Dann hob er sein Schwert mit beiden Händen, entschlossen, dem Mecklenburger Hinterwäldler den Schädel zu spalten. Dazu kam er nicht.
Das Schwert schwebte noch bedrohlich in der Luft, als die vier Lüneburger Bürgermeister, die Richteherren, der Gerichtsvogt, der Stadthauptmann und fünf Stadtsoldaten erschienen und dem Treiben energisch ein Ende bereiteten. Sie entwaffneten die Herren von Ritzerow und von Baerck, aber nur den Ritter nahmen sie in Haft. Auf Betreiben von Reyner Stolzfuß wurde er sogar in Ketten gelegt. Doch kaum waren Hogeherte, Gronehagen und Schelleper sowie die Richteherren und der Gerichtsvogt verschwunden, brachte einer der Soldaten dem Ritter eine große Kruke voll mit Wein. Der Wein duftete verführerisch; es schien ein edler Franzose zu sein. Heinrich von Ritzerow leckte sich die Lippen. Mit seinen Fesseln hatte er jedoch keine Chance, die Kruke zu erreichen, Tantalosqualen für einen Mann wie ihn.
Nachdem der Ritter den Weinkrug eine Viertelstunde mit wachsender Verzweiflung angestarrt hatte, erschien Bürgermeister Stolzfuß. Ein Stadtsoldat stellte dem Ratsherrn einen Stuhl bereit, auf ihm nahm Stolzfuß Platz. Ein paar Minuten betrachtete er den Ritter, der gespannt auf das war, was irgendwann einmal folgen musste: eine Ansprache, heftige Vorwürfe oder das Lösen der Ketten, denn der Wein durfte schließlich nicht verderben.
»Ihr seid ein Mann, der sich nicht beherrschen kann, Herr Ritter«, sagte Stolzfuß; es waren also die Vorwürfe an der Reihe. »Das ist ebenso unmännlich wie unritterlich, finde ich. Wenn Ihr mit dem Herrn von Baerck einen Strauß auszufechten habt, dann außerhalb der Stadt. Veranstaltet ein Turnier, das könnt ihr Ritter doch.«
»Nun ja«, druckste der Ritzerow. Er hatte noch nie an einem Turnier teilgenommen, weil er ja eigentlich Landwirt und dann erst Ritter war, was er natürlich immer anders darstellte.
»Ich weiß von Martin Grüneberg, dass Ihr es wohl gut gemeint habt«, sagte Stolzfuß. »Ihr sollt ein Gerechtigkeitsapostel sein. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, nur: Für die Gerechtigkeit in Lüneburg sorgt bei Mordfällen das Lüneburger Halsgericht. Die Richteherren haben sich schon über Euch, aber auch über den Herrn von Baerck beschwert. Traut Ihr ihnen nicht zu, für Recht und Ordnung zu sorgen?«
»Doch, doch«, murmelte der Ritter und starrte den Weinkrug an.
»Da Ihr nicht der städtischen Gerichtsbarkeit untersteht, Herr Ritter, werdet Ihr eine Nacht in diesem Verlies verbringen und dann die Stadt verlassen. Ihr seid verbannt und dürft in den nächsten zwanzig Jahren nicht zurückkehren. Das ist eine Gnade, wie Ihr wißt, denn für Eure Vergehen könnten wir Euch der herzoglichen oder gar der kaiserlichen Gerechtigkeit ausliefern.«
»Es war ein Kampf zwischen Herren, Bürgermeister«, protestierte Heinrich.
»Es war schlicht und einfach Schwachsinn«, entgegnete Stolzfuß. »Wenn Ihr wirklich helfen wollt, dann sucht die Verbrecher außerhalb der Stadt. Sie kommen nicht aus Lüneburg, da bin ich sicher. Stadthauptmann!«
»Ja, Herr?«, rief jemand, der sich hinter der massiven Holztür befand und dessen Stimme daher etwas dumpf klang. Reyner Stolzfuß erhob sich.
»Löst dem Ritter die Ketten und gebt ihm auch etwas zu essen«, befahl der Bürgermeister. »Wein hat er ja schon.«
»Danke«, sagte Heinrich, dem es zeit seines bewussten Lebens immer schwergefallen war, sich zu bedanken.
»Wir Bürgerlichen können auch sehr ritterlich sein«, sagte Stolzfuß und verließ den Turm.
Der Mann, der sich Albrecht Gregorius nannte, war zurückgewiesen worden, und das konnte er nicht leiden. Menschen, die ihn ablehnten, pflegte er mit dem Tod zu bestrafen. Im Falle von Reyner Stolzfuß war das nicht möglich. Der Lüneburger Sülfmeister wurde noch gebraucht. Gregorius hätte ihn gern verbluten sehen, so wie Lüdeke Peters, den dummen Hund.
In seinem Quartier Bei der Ratsmühle ging Gregorius auf und ab und überlegte seine nächsten Schritte. Er war enttäuscht von Stolzfuß. Den Sülfmeister hatte er für einen kaltschnäuzigen Geschäftsmann gehalten, aber dann hatte sich herausgestellt, dass er vom Tod seines Schwagers so beeindruckt war, man konnte mit ihm nicht vernünftig verhandeln.
Der Mann, der sich Albrecht Gregorius nannte, hatte sehr viel Geld investiert in ein Essen, mit dem er Stolzfuß zu beeindrucken versuchte. Dieses Geld gehörte nicht ihm. Er würde Rechenschaft über die Ausgaben ablegen müssen, und wenn sie nicht zum Erfolg führten, würde Ahlemann ihn ausliefern. Diese Drohung schwebte über dem Mann, der seit seiner Flucht aus Rostock Albrecht Gregorius hieß, in Wahrheit aber Peter Gröschlin war.
Peter Gröschlin kannte nur ein Gefühl: Hass. Er handelte nie um Geld; alles, was er tat, diente ihm dazu, seinen Hass zu befriedigen.
Der Hass war früh entstanden, in seiner Kindheit. Gröschlin stammte aus ärmlichen Verhältnissen, war aber ein begabtes Kind gewesen, das sich an Hand der Texte auf Bildern und Spruchbändern in der Kirche die Anfangsgründe des Lesens selbst beigebracht hatte. Ein Gutsverwalter, der Knaben liebte, hatte den talentierten Bauernsohn gefördert; dafür hatte ihm Gröschlin zu Willen sein müssen. Seitdem lebte er nur noch seinen Hass, seinen Wunsch zu zerstören. Auch seinen Revaler Auftraggeber Ahlemann hasste er.
Aber diesem Hass zum Trotz erfüllte er seine Aufträge immer. Das war eine Frage der Ehre. Niemand dachte im Ernst daran, dass ein Mann wie Gregorius Ehre hatte. Er war eine nichtige Person, ein ungültiger Mensch. Er selbst aber wusste, wer er war und was er konnte. Er ließ töten, und am Ende würde auch sein Auftraggeber dran glauben müssen.
Dass er jedermanns Feind war, auch all jener, die ihn für ihr williges Subjekt hielten, gefiel ihm am besten. Das war seine Form der Ehre: Alle mussten ans Messer, nur er nicht, weil er sich aus allem herauswand wie eine Schlange. Er war ein hervorragender Handwerker. Die meisten anderen waren voller Dünkel und daher todeswürdig.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.