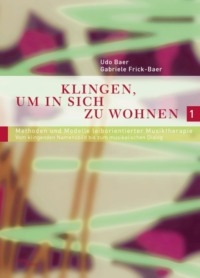Kitabı oku: «Klingen, um in sich zu wohnen 1», sayfa 5
2.3 Instrumenten-Parcours
Ein weiterer Vorschlag, sich mit Hilfe der Panoramatechnik der musikalischen Biografie anzunähern, ist der Instrumenten-Parcours. Wir benutzen hier das Verraumen (s. Kap. 6 und ausführlich Baer/Frick-Baer 2001a).
Wir stellen eine Anleitung zur musiktherapeutischen Arbeit in einer Gruppe vor, zuerst einmal ohne Instrumente, als biografische Verraumungsarbeit. Die Therapeutin, der Therapeut gibt einem Großteil des Seminarraumes, möglichst in Form eines lang gezogenen Rechtecks, die Bedeutung eines biografischen Raumes. Einen anderen schmaleren Teil des Raumes erklärt er oder sie zu einem neutralen oder sicheren Raum, in den sich die TeilnehmerInnen während der folgenden Erlebnis öffnenden Einheit zurückziehen, in dem sie sich ausruhen oder sich selbst (nicht die anderen) beobachten können.
„Irgendwo hier an der einen Seite dieses Raumes ist der Beginn eurer musikalischen Lebensgeschichte, der Beginn eures musikalischen Erlebens – wann immer ihr diesen Beginn ansetzt. Nehmt diesen Raum ein Stück zur Mitte hin als euren kindlichen Raum, als Raum dessen, was ihr an musikalischen Traditionen eurer Vorfahren mitbekommen habt, vielleicht im Mutterleib, von euren Eltern, Geschwistern, Großeltern, NachbarInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen usw. … Irgendwo dort auf der anderen Seite dieses Raums der musikalischen Lebensgeschichte ist der Ort des Hier und Jetzt, der Ort eures heutigen musikalischen Lebens und Erlebens. Der Raum dazwischen – ihr merkt, die Teilräume innerhalb des biografischen Raums sind nicht genau aufgeteilt, sondern gehen ineinander über – ist der Raum eurer musikalischen Entwicklung, aber auch der Raum der Brüche und Rückschläge, der Raum zwischen dem kindlichen und dem gegenwärtigen Erleben … Durchwandert die Räume auf eure Art und Weise, auf euren Wegen – chronologisch in der biografisch-zeitlichen Abfolge oder kreuz und quer und hin und her, in geraden Linien oder Schlängellinien, konsequent oder mit Pausen. Lasst die Erinnerungen, Gefühle, Empfindungen zu, die auftreten, während ihr euch durch die Räume bewegt.“
Nach etwa 15 – 20 Minuten:
„Sucht und findet bitte den Platz, an dem ihr für einige Momente euer Erleben nachklingen lassen könnt … Sinniert noch einmal darüber nach, welche Stationen, welche Erfahrungen euch während eurer Reise wichtig geworden sind. Vielleicht hat euch etwas überrascht, vielleicht war etwas neu oder vertraut oder vergessen oder fremd … Und drückt diese Erfahrung, dieses Erleben in einem Ton oder Klang aus.“
Hier sollte sich wie üblich ein Austausch in der Gruppe oder mit Therapeutin oder Therapeut anschließen, in dem auch die zuletzt gefundenen Töne bzw. Klänge vorgespielt werden. Wichtig sind Fragen wie: „Was hast du während des ganzen Prozesses erlebt? Was hast du über dich und dein Leben, insbesondere deine musikalische Biografie erfahren?“ Und: „Was hat sich während dieses Prozesses verändert?“
Den Weg durch die Räume kann man musikalisch gestalten. Dies geht in Gruppen nur nacheinander, da bei einer gleichzeitigen Aktion der Einfluss der anderen so groß wäre, dass das Eigene, Besondere, auf das es uns besonders ankommt, zu kurz käme. Sehr geeignet ist diese Variante in der Einzelarbeit. Die Räume werden wie beschrieben gestaltet und beschritten. Dann wird die Klientin, der Klient aufgefordert:
„Suche dir bitte Instrumente oder andere Gegenstände, die Klänge erzeugen, und gib ihnen einen Platz in diesem Raum, der zu deiner musikalischen Biografie passt … Und dann spiele dich durch deinen Instrumentenparcours, auf deine eigene Art und Weise, auf deinem eigenen Weg. Spiele und höre dir selbst zu …“
Hier gilt es, im verbalen Austausch anschließend vor allem der Frage nachzugehen, was sich während des Prozesses wodurch verändert hat. Eine weitere Variante kann darin bestehen, dass die KlientInnen vorher aufgefordert werden, Objekte ihrer musikalischen Biografie mitzubringen. Das können wie vorhin Instrumente sein oder alte Schallplatten, Noten, der uralte Kassettenrecorder, dies und jenes, was mit der musikalischen Biografie zusammenhängt. In jedem Fall ist es wichtig, die KlientInnen aufzufordern, in der aktuellen therapeutischen Situation den Parcours durch Instrumente zu ergänzen, die aktuell dazu passen. Auch dieser Parcours sollte, wenn möglich, musikalisch „durchgespielt“ und räumlich erlebt werden.
2.4 Filmmusik
Der therapeutische Weg zur „Komposition“ einer biografischen Filmmusik beginnt mit einer Variante der eben vorgestellten Panorama-Methode. Wie beschrieben, werden ein Beobachtungs- bzw. „neutraler“ Raum sowie ein großer Raum der musikalischen Biografie geschaffen.
„Geht durch den Raum und findet dabei den Platz, den ihr als Ausgangspunkt eurer musikalischen Lebensgeschichte bezeichnen möchtet … Wenn ihr ihn gefunden habt, haltet einen Moment an diesem Platz inne …
Sucht von diesem Platz aus die Stelle im Raum, wo das Hier und Jetzt, euer gegenwärtiges Leben und Erleben seinen Ort haben könnte. Wählt diesen Ort noch ganz unabhängig davon, wie der Weg dazwischen aussehen könnte.
Nachdem ihr diese beiden Entscheidungen getroffen habt, erzähle ich euch, wozu ich euch im weiteren anleiten möchte. Ich werde euch bitten, eure musikalische Lebensgeschichte durchzugehen, diesmal als Weg durch den Raum. Ich werde euch begleiten, indem ich immer wieder Lebensabschnitte nennen werde, um euch Anhaltspunkte zu geben. Wenn euch das gerade zu schnell oder zu langsam geht, wenn euch andere Zeiteinteilungen sinnvoller erscheinen, dann nehmt euch ernster als meine Anregungen. Für euren Weg durch die musikalische Lebensgeschichte bitte ich euch, immer wieder euren Einfällen, Empfindungen, Gefühlen und Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken.
Bevor ihr vom Ausgangspunkt losgeht, sucht euch einen Platz, der zeitlich und örtlich davor liegt … Was war vor dem Beginn deiner musikalischen Lebensgeschichte? Was haben deine Vorfahren mitgebracht? … Welche musikalischen Traditionen gab es in deiner Familie? … Was wurde dir in die Wiege gelegt?
Geht nun in eurer Art und in eurem Tempo in eure Kindheit hinein, in die ersten Abschnitte eurer musikalischen Lebensgeschichte. Folgt euren Einfällen, der Weg wird sich von allein entwickeln …Was fällt euch ein zu euren ersten Lebensjahren? Oder was habt ihr von anderen über euch gehört? Habt ihr viel geschrieen oder eher wenig? Wart ihr laut oder eher still, unruhig oder ruhig, temperamentvoll oder eher zurückhaltend? … Was fällt euch ein zum Kindergartenalter? … zur Schule … zur Pubertät … zum Erwachsenwerden … zum Erwachsensein … zum Singen … zum Musikhören … zum Musikspielen … zu heute … ?
Wenn ihr am Ort des Hier und Jetzt eurer musikalischen Lebensgeschichte angekommen seid, haltet dort inne. Überprüft, ob dieser Platz jetzt stimmt. Wenn ja, dann bleibt dort, wenn nicht, sucht euch einen anderen Ort, der jetzt angemessen ist.
Sucht und findet an diesem Platz eine Haltung im Stehen, Sitzen oder Liegen, in der ihr gut in euch hineinhören könnt.
Schließt, wenn ihr mögt, die Augen, atmet gut und lasst das, was ihr vorhin erlebt habt, noch einmal wie in einem Musikfilm in euch ablaufen. Hört der Musik, die den Film eurer musikalischen Lebensgeschichte begleitet, gut zu.“ 10 Minuten Zeit lassen!
„Welche Szene, welche Musik steht jetzt im Vordergrund eures Hörens und Erlebens? Was bewegt euch am meisten? Schenkt dieser Szene und dieser Musik eure ganze Aufmerksamkeit …
Wie geht es euch jetzt? Was erlebt ihr nun? Musiziert es so, dass sich das Bewegendste aus der Filmmusik zu eurer Lebensgeschichte in einer Ouvertüre, einem musikalischen Schlüsselthema oder einer musikalischen Schlüsselszene verdichtet.“
2.5 Zurückhören
Ein Mann kommt in die Therapie, „irgendwie ärgerlich“, den Zorn aber kaum spürend, nur „mit angezogener Handbremse“. „Es grummelt in mir. Aber ich weiß nicht, worüber. Seit zwei Tagen komme ich mir wie in einem Käfig vor, wie ein Tier im Zoo, das hin und her läuft. Und ich weiß nicht, warum.“ Der Therapeut fragt, aus welchen Zeiten er sich so kenne, wann er sich so schon einmal erlebt habe.
„Das passiert mir öfters, aber meistens nur kurz, es kommt und geht wieder. So stark wie jetzt kenne ich das nur aus meiner Jugendzeit. Da bin ich auch in meinem Zimmer immer hin und her gelaufen, war ärgerlich und fühlte mich gefangen.“
„Welche Musikstücke haben Sie damals gehört? Oder haben Sie selbst Musik gespielt?“
„Gespielt habe ich leider nicht, aber gehört habe ich viel, zumeist Rock und Blues und auch ein bisschen Jazz. Meistens im Radio beim britischen Soldatensender BFBS. Davon habe ich mir die besten Sachen auf einem Tonbandgerät aufgenommen. Einen Schallplattenspieler hatten wir nicht.“
„Welche Musik haben Sie gehört, wenn Sie so hin und her tigerten und mit angezogener Handbremse ärgerlich waren?“
„Alles Mögliche. Aber am besten hat mir ‚Paint it black’ von den Stones gefallen“, sagt er und dabei beginnt sein Gesicht freudig zu strahlen, „das hat mir richtig gut getan. Ich habe den Text damals nicht verstanden, aber mir immer vorgestellt, dass ‚Paint it black’ bedeutet, alles um mich herum schwarz zu malen, den ganzen Kitsch schwarz anzustreichen, die spießige Unehrlichkeit schwarz anzustreichen, das Duckmäusertum. Die Stones haben für mich ihren Ärger und ihren Zorn herausgeschrieen.“
„Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie sich daran erinnern und davon erzählen?“
„Oh, jetzt merke ich wieder meinen Zorn. Ich höre die Nummer der Stones innerlich. Sie finden die Worte und die Musik für meinen Zorn. Und ich weiß jetzt auch, was mich zur Zeit zornig macht: Ich hasse diese feigen Hunde an meinem Arbeitsplatz. Immer, wenn ich mal den Mund aufmache, lassen die mich im Regen stehen …“ Er erzählt und erzählt, ärgerlich, aufgeregt, zornig, klar und deutlich – nichts mehr ist von dem Diffusen, von der angezogenen Handbremse zu sehen und zu hören, mit der er in die Therapie gekommen war. Er gestikuliert und seine Beine zucken. Der Therapeut bittet den Klienten aufzustehen, während er erzählt. Er tut es gerne und läuft hin und her. Auch sein körperlicher Ausdruck wird freier.
Was war passiert? In einer konkreten Situation kam der Klient nicht weiter. Er steckte in seinem Erleben fest. Durch den Rückgriff auf die musikalische Biografie gelang es ihm, aus der Sackgasse herauszukommen und seine Lebendigkeit wieder zu entdecken. In der musikalischen Biografie sind nicht nur Probleme enthalten, sondern auch Lösungen. In der musikalischen Biografie stecken zahlreiche Ressourcen, die aktiviert und genutzt werden können, indem KlientInnen zurückhören.
2.6 Die alte Szene in der neuen
In einer musiktherapeutischen Ausbildungsgruppe hatten die TeilnehmerInnen zu einem bestimmten Thema ein kleines Musikstück erarbeitet. Eine Teilnehmerin steht anschließend vor der Gruppe und will das, was sie entwickelt hat, vorspielen. Sie zögert, setzt an, wird blass, bricht ab.
„Ich kann nicht.“
„Was erlebst du gerade?“, fragt der Seminarleiter.
„Ich werde ganz starr, wie gelähmt. Ich schwitze.“
„Wovor hast du Angst?“
„Ich weiß nicht genau … Das hängt irgendwie mit dem Vorspielen zusammen. Und dass die anderen zuhören und mir zuschauen.“
„Kennst du das irgendwo her – du spielst vor und wirst starr?“
„Ja, vom Musikstudium. Wenn ich da vorspielen musste, war das furchtbar. Ja, das ist es. Das hier ist jetzt genauso wie damals.“
„Erzähl doch mal, wie das damals war.“
„An eine Situation erinnere ich mich besonders. Ich sollte vorspielen und die Herrschaften saßen da in Reih und Glied vor mir. Und während ich spielte, unterhielten die sich. Machten Bemerkungen, schrieben sich was auf. Ich kam mir total blöd vor, als würde sich keiner für mich und meine Musik interessieren.“
Was war geschehen? Die Situation, vor einer Gruppe etwas vorzuspielen, mobilisierte das Leibgedächtnis (s. Kap. 21.2.4). Eine Szene aus der musikalischen Biografie entstand in der Gegenwart neu. Das Erleben der alten Szene überlagerte das mögliche Erleben in der neuen Situation.
Wenn wir in der Therapie vermuten, dass eine vergangene Situation die gegenwärtige beeinflusst, bitten wir, die vergangene Situation so konkret wie möglich als Szene zu beschreiben. Zu einer Szene können verschiedene Aspekte gehören, die wir bei Bedarf erfragen.
Zum Beispiel:
„Wer war anwesend?“ bzw.: „Wer war nicht da?“
„Wie sah der Raum aus?“
„Wie spät war es?“
„Wo hast du gestanden? Gesessen? Wie genau?“
„Was hast du gehört? Gesehen? Gerochen?“
„Wie war die Atmosphäre?“
usw.
Wenn die alte Szene sowieso schon das aktuelle Erleben beeinflusst, dann sollte sie auch ganz lebendig werden und konkret und prägnant im Hier und Jetzt erscheinen dürfen. Ist dies geschehen, dann kann sich die Klientin oder der Klient konkreter und handfester mit der alten Szene bzw. mit dem Erleben in der Gegenwart auseinandersetzen. Dazu gehört zu überprüfen, was die neue Situation von der alten unterscheidet. Deshalb fragt in unserem Beispiel der Seminarleiter:
„Was ist denn jetzt genauso wie damals? Und was ist anders?“
„Genauso ist, dass ich hier vorne stehe und etwas vorspielen will, dass die anderen zuhören und mich anschauen. Aber die gucken anders. Nicht so prüfend oder gelangweilt oder abwertend.“
„Sondern eher wie?“
„Ich glaube, interessiert und mir zugewandt, warmherzig.“
Manchmal reicht der sorgfältig und bewusst vorgenommene Vergleich schon aus, damit das Erleben der alten Szene in den Hintergrund treten und sich das aktuelle Erleben und Handeln verändern kann. Oft aber bedarf es noch des einen oder anderen Schrittes zusätzlich, bedarf es einer Veränderung der Szene. Wie diese Veränderung erfolgen kann, ist sehr unterschiedlich. Drei weitere Hauptwege der Veränderung einer Szene möchten wir am Beispiel der beschriebenen Seminarsituation skizzieren. Sie könnten so oder so ähnlich abgelaufen sein.
In der ersten Variante könnte diese Szene folgendermaßen weitergehen: Der Seminarleiter fragt: „Was brauchst du, damit du sicher sein kannst, dass es jetzt anders ist als damals? Was brauchst du, damit du spielen kannst?“
Der Teilnehmerin fällt ein, dass sie einige der anderen fragen kann, ob sie Interesse an ihr haben. Sie fragt und erhält positive Antworten.
„Jetzt geht es mir schon besser.“ Sie lächelt – und sie zögert.
„Fehlt noch etwas?“
„Ja, ich komme mir noch so allein vor.“
„Wie kannst du das ändern?“
„Ich traue mich kaum – aber könnte sich jemand neben mich stellen?“
Sie fragt eine andere Teilnehmerin. Diese kommt nach vorne und stellt sich neben sie. Nun ist die Szene so verändert, dass die erste Teilnehmerin ihr Musikstück spielen kann.
Die zweite Variante würde mit einer anderen Frage des Seminarleiters beginnen: „Was hättest du damals gebraucht oder was wäre gut gewesen zu tun, um damals nicht zu erstarren und anders aus der Situation herauszukommen?“
Die Teilnehmerin überlegt, dann stößt sie hervor:
„Ich hätte etwas sagen müssen! So etwas wie: ‚Hören Sie mir überhaupt zu?!’“
„Sagen Sie es.“
Die Teilnehmerin spricht es aus. Erst leise, dann immer lauter werdend: „Hört mir zu! Nehmt mich ernst!“
Danach ist die Luft gereinigt, die Starre verflogen. Die Teilnehmerin kann spielen.
In der dritten Variante könnte der Seminarleiter die Teilnehmerin fragen, wie alt sie in der alten Szene war.
„Zweiundzwanzig.“
„Wenn du dir heute die Szene mit der 22-Jährigen anschaust wie in einem Videofilm – was könntest du heute, als Beobachterin und gleichzeitig als Helferin in der Not, für die 22-Jährige tun?“
Die Teilnehmerin überlegt und antwortet dann:
„Ich würde ihr sagen, dass sie diese Leute, die vor ihr sitzen, nicht so ernst nehmen soll. Sie selbst soll entscheiden, wer es wert ist, auf ihre Musik eine Rückmeldung zu geben. Sie braucht keine Rückmeldung von Idioten und Ignoranten, sondern von Leuten, die sie schätzt. Sie braucht Rückmeldungen, die es wert sind von ihr beachtet zu werden. Diese Leute sind es offenkundig nicht. Also, ich würde ihr sagen: ‚Atme gut durch und spiel für dich!’“
Sie atmet durch und spielt …
Sowohl im anfangs vorgenommenen Vergleich der alten mit der neuen Szene als auch in allen drei Varianten erfolgt eine Veränderung der Szene. Um eine solche Veränderung geht es in der Therapie, da sie ein verändertes Erleben und damit ein anderes Verhalten ermöglicht.
2.7 Wie man musizieren gelernt hat
Wenn KlientInnen in der Therapie zu einem Musikinstrument greifen oder zu singen beginnen, ist dies sicher nicht ihre erste Erfahrung mit dem Musizieren. Viele KlientInnen haben zu Hause Lieder gesungen und sind dem Musizieren in der Schule begegnet, manche haben Musikunterricht gehabt und versucht, ein Instrument oder den Gesang zu erlernen. Diese Vorerfahrungen können, wenn in der Therapie ein wie auch immer geartetes Musizieren ansteht, wieder in den Vordergrund treten.
Häufig, leider allzu häufig, hören TherapeutInnen dann Sätze wie: „Mein Musikunterricht war Dressur“, „Wenn ich am Klavier zweimal den gleichen Fehler gemacht habe, bekam ich einen Schlag auf die Hände“, „In der Schule haben sie mir die Freude an der Musik ausgetrieben“, „Immer ging es in der Musikschule nur um Richtig und Falsch – dass Musik Freude machen kann, habe ich erst Jahre später erfahren.“
Es ist sehr bedauernswert, wie autoritär, abwertend und freudlos in vielen Fällen Musik unterrichtet wurde. Für viele wurde das Erlernen von Noten bzw. das Spielen eines Instrumentes so zum Gräuel. Sicher, wenn man ein Instrument lernt, gibt es richtig und falsch, bedarf es der Disziplin und der Übung. Doch das „Wie“ ist entscheidend: Ob die Freude und das Interesse geweckt oder unterdrückt bzw. vernichtet werden. Und es ist eine Schande, dass immer wieder KlientInnen in ihrem Einzelunterricht traumatische Erfahrungen gemacht haben. Da offenbart sich in der Therapie, dass das „richtige Atmen“, die „richtige Haltung“ gepaart war mit – sozusagen beiläufigen – sexuellen Übergriffen, so dass sich Musizieren mit Erstarrung, Angst, Ekel, Scham und anderen Folgen von Missbrauch verbindet.
Manchmal reicht es, wenn in der therapeutischen Situation von diesen Erfahrungen erzählt werden kann, wenn sie „heraus“ dürfen, damit sich die KlientInnen von ihnen frei machen und sich den neuen Erfahrungen des Musizierens in der Therapie öffnen können. Manchmal bedarf es lediglich klärender Worte der TherapeutInnen, dass sich das Musizieren in der therapeutischen Situation fundamental von dem unterscheidet, was diese KlientInnen kennen: „Hier geht es nicht um Richtig oder Falsch. Hier geht es nicht darum, etwas zu können, sondern darum, sich im Musizieren zu erleben.“ Und manchmal, vor allem wenn über negative, ja traumatische Erfahrungen des Musiklernens weitere Traumata lebendig werden, muss (musiktherapeutische) Traumaarbeit geleistet werden.
Es gibt allerdings nicht nur negative Erfahrungen, die KlientInnen damit gemacht haben, ein Instrument zu erlernen. Manche erzählen auch, wie gut ihnen das getan hat. Für viele hat sich mit dem Musizieren eine neue Welt erschlossen, für andere war das Lernen ein Halt, gab das Üben eine Struktur, manche hat es „gerettet“, das psychische Überleben gesichert.
2.8 Die soziale Dimension der musikalischen Biografie
Die bislang angeführten Beispiele für die Wirkungsmöglichkeiten der musikalischen Biografie haben sicherlich schon gezeigt, dass die musikalische Biografie immer auch eine soziale Dimension hat. Unter sozialer Dimension verstehen wir den Bezug zu anderen Menschen, z. B. ihre Anwesenheit und Bedeutung in der Szene des Vorspielens. Auch die Abwesenheit anderer Menschen („Nie hat mir jemand zugehört.“) kann als soziale Dimension wirken. Wie unterschiedlich und zum Teil gravierend die soziale Dimension der musikalischen Biografie deren Bedeutung bestimmen kann, möchten wir an drei kurzen Beispielen illustrieren:
Eine Frau erzählt, dass sie sich selbst das Spielen von Musikinstrumenten beigebracht hat. Um Unterricht nehmen zu können, reichte das Geld nicht, aber es gab einige Instrumente im Haushalt. Also probierte sie und probierte und brachte sich das Spielen selbst bei. Dafür gab es Wertschätzung, die einzige, an die sie sich erinnern kann. Mit dem Musizieren gelang es ihr, eine Oase in der Wüste der Abwertung zu schaffen: „Das war das einzige, worin ich was konnte.“
Für eine andere Frau war nicht so sehr das Spielen, sondern eher das Hören von Musik in der Jugend wichtig gewesen. Sie war in einer großen Familie aufgewachsen. Die Musik, die sie hörte, war anders als die, welche einerseits bei den Geschwistern und andererseits bei den Eltern „in“ war. Ihre Eigenwilligkeit bei der Musikauswahl stärkte ihren Eigensinn und ihr Freiheitsgefühl. Aber sie zahlte einen Preis dafür: Sie blieb mit ihrer Musik allein, bezahlte Freiheit und Eigensinn einige Jahre lang mit Einsamkeit.
Ein Mann erzählt begeistert von seinen Erfahrungen in einer Jugendband. Er konnte ein paar Griffe auf seiner Gitarre, schon tat er sich mit anderen zusammen, übte, probte und trat auf. „Sicher, die Auftritte waren auch toll. Das gab Punkte bei den Mädchen. Klasse war aber vor allem der Zusammenhalt in der Band. Wir waren Freunde. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, haben wir gelernt, das so zu regeln, dass die Gruppe nicht auseinander fiel. Ja, ich habe in der Band Teamgeist gelernt. Du musst auf die anderen hören und trotzdem bei dir bleiben – das bringt’s.“