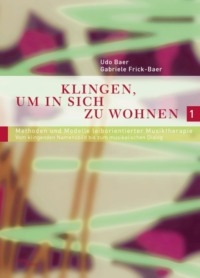Kitabı oku: «Klingen, um in sich zu wohnen 1», sayfa 6
2.9 Coping
Jeder Mensch sieht sich in seiner persönlichen Entwicklung Herausforderungen gegenüber, die er bewältigen muss. Die Ablösung von den Eltern im Jugendalter ist solch eine Herausforderung, ebenso jede Krise, wie eine schwere Krankheit, der Verlust einer nahen Person oder das Erleiden einer Gewalttat.
Menschen entwickeln Strategien, um solche Herausforderungen zu bewältigen. In den Sozialwissenschaften nennt man solche Bewältigungsstrategien „Coping“. In der Therapie spielen vor allem die persönlichen Krisen-Copings eine wichtige Rolle (s. a. Baer/Frick-Baer 2001a. S.363ff). Fast alle Menschen neigen dazu, eine Art und Weise, mit der sie eine Herausforderung wie z. B. eine Krise zumindest halbwegs gemeistert bzw. physisch und psychisch überlebt haben, zu ihrer Strategie zu machen, d.h. zu versuchen, mit ihr auch alle künftigen Herausforderungen zu bewältigen. Das kann gelegentlich gelingen, viele Menschen scheitern aber, wenn sie auf alten Wegen Herausforderungen gegenüber treten, die eigentlich ganz anderer Copings bedürfen.
Was hat das nun mit der musikalischen Biografie zu tun? In der musikalischen Biografie sind häufig Copings enthalten. Das Hören von Musik und das Musizieren können zu zentralen Bestandteilen einer Bewältigungsstrategie werden. Vertraut wird vielen die wichtige Rolle sein, die die Musik in der Pubertät und der darauf folgenden Ablösung vom Elternhaus spielt. Die eigene Musik, die eigene Musikrichtung und -vorliebe, steht als Symbol für das Erwachsenwerden, für die Eigenständigkeit. Sie steht für das Anderssein als die Eltern, die Erwachsenen.
Welch lebensrettende Bedeutung das Musizieren für einen Menschen haben kann, illustriert das Leben von Anton, in der DDR stramm erzogen, stramm groß geworden. Auf die Partei wurde gehört, nicht auf ihn. Also spielte er Violine, allein. Die Violine wurde seine Stimme. Dann, als er Anfang 20 war, zog er weg. Er heiratete in den Westen, ins Schwäbische. Aus Anton wurde Toni. Doch er merkte, auch in dieser Welt wurde er nicht gehört: fremde Welt, fremde Sprache, fremdes Denken. Und Krach mit dem Schwiegervater. Und wieder spielte er Musik. Diesmal Gitarre, klassische Gitarre.
Erste Auftritte folgten. Erst klassisch, dann Folk-Musik, dann eigene Lieder, mit Violine und Gitarre. Doch irgendwie war alles zu leise, also griff er zur E-Gitarre. Lauter. Hörbarer.
Die Ehe und das Schwäbische wurden unaushaltbar. Also floh er nach Berlin und in die Musik. Nun gab es nur noch Musik, Musik, Musik. Vergessen in der Musik, Leben in der Musik, genauer: im Musizieren. Zwei Jahre lang ging er auf Tournee, mit Violine, mit klassischer Gitarre, mit E-Gitarre. Leise und laut. Er lebte im Musizieren. Ruhelos. Einen Abend mit ihm zu verbringen bedeutete, durch zehn Kneipen zu ziehen. Auch sein Gewicht wurde ruhelos, die Kilos gingen rauf und runter, die Beziehungen waren genauso ruhelos, gingen rauf und runter. Keine Bindung. Kein Zuhörenkönnen. Ein Asteroid, der immer schrecklicher um das eigene Verlorensein kreist.
Außer, wenn er musiziert. Dann ist er eins mit dem Instrument, mit der Musik. Dann klingt die Verzweiflung, die Einsamkeit, die Trauer, dann tönt das verlorene Schwäbische, dann füllt die Hoffnung den Raum, dann wird zwischendurch der kleine Junge hörbar, pfeifend, froh und zart. Immer, wenn das geschieht, fordert er die ZuhörerInnen auf mitzupfeifen. Und wenn sie pfeifen, lächelt er.
Nicht lange. Dann legt er wieder los, dann kreischt die Verzweiflung aus der E-Gitarre, verbissen, verloren. In der Musik, im Musizieren kämpft er ums Überleben.
Musik sei sein Leben, sagt er. Und er meint es wörtlich.
Solche Geschichten begegnen uns in der Therapie gar nicht so selten, vor allem, wenn wir TherapeutInnen uns trauen, nach musikalischen Lebensgeschichten zu fragen, die häufig erst einmal nicht so deutlich hörbar werden. Für viele Menschen war das Musikhören und das Musizieren überlebenswichtig. Eine Frau erzählt, dass sie sich immer, wenn die Atmosphäre zu terroristisch wurde, in einen Verschlag zurückgezogen und geflötet hat. Eine andere Frau berichtet, dass sie den Tod der Mutter „am Klavier betrauert“ hat. Wenn der Schmerz und die Trauer sie zu überwältigen drohten, spielte sie stundenlang auf dem Klavier, bis ihr „etwas leichter ums Herz wurde“.
Vielen KlientInnen tut es gut, wenn sie in der Therapie verstehen, welche Bedeutung die Musik für ihre persönliche Entwicklung und die Bewältigung von Krisen hatte. Es hilft ihnen, sich zu verstehen, um das Musizieren und Musikhören auch in Zukunft zu nutzen. Sie können überprüfen, ob das Musizieren reicht oder ob sie andere Bewältigungsstrategien einschlagen müssen.
Um der Coping-Bedeutung des Musizierens bzw. Musikhörens auf die Spur zu kommen, empfiehlt es sich, folgende Fragen zu stellen:
„Wofür war bei Ihnen das Musizieren bzw. Musikhören gut?“
„Welche Bedeutung hatte es für die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Identität?“
„Welche Rolle spielte es, als Sie in einer Krise waren?“
„Wovor hat es Sie bewahrt?“
„Was hat es Ihnen gegeben?“
Viele Menschen kennen die Coping-Kraft der Musik nicht. Sie machen vielleicht die erste Erfahrung mit ihr in der Therapie. Wird die Coping-Funktion des Musizierens oder Musikhörens bewusst, geht damit bei fast allen KlientInnen sehr schnell die Einsicht einher, wie es um den Nutzen dieses Copings in der Gegenwart, in der Bewältigung der aktuell anstehenden Herausforderungen, bestellt ist. Oft kann darüber eine Ressource mobilisiert und aktiviert werden. Und nahezu immer gehört Musik in den persönlichen Notfallkoffer für psychische Krisen.
3
Leibbewegungen in der Musiktherapie
3.1 Leibregungen und Leibbewegungen
Die deutsche Sprache ist wunderbar mehrdeutig. Wenn wir das Wort „eng” benutzen, können wir damit die Eigenschaft eines Raumes bezeichnen, z. B. dass ein Durchlass eng ist oder zwei Menschen eng beieinander stehen. Ein Zimmer kann eng sein oder ein Flur. Wir können mit dem Wort „eng“ ebenfalls ein Erleben beschreiben. Wir können zum Beispiel sagen: „Mir ist eng ums Herz.”, „Ich fühle mich eingeengt.” In dieser Mehrdeutigkeit sehen wir eine ausgezeichnete Möglichkeit, therapeutisch zu arbeiten: mit Leibbewegungen. Leibbewegungen sind in unserer Begrifflichkeit Bewegungen des Erlebens, die zwei Aspekte beinhalten: Sie sind motorische Bewegungen, man kann z. B. die Arme eng anlegen, und sie sind gleichzeitig Bewegungen des Erlebens, man kann sich einengen oder eingeengt fühlen. Wenn wir KlientInnen in der Einzeltherapie oder TeilnehmerInnen therapeutischer Gruppen die Arbeit mit Leibbewegungen anbieten, nutzen wir diese Mehrdeutigkeit. In einer Leibbewegung kann innere Bewegung entstehen und sich äußern. Es können Klänge, Bilder, Gefühle, Stimmungen etc. auftauchen und verändert werden.
Die Grundlage unserer therapeutischen Haltung ist unser Menschenbild, das sich in humanistischer Psychologie und phänomenologischer Leibphilosophie begründet. Wir begegnen dem Menschen in der Therapie vor allem als erlebendem Menschen, als Menschen, der sich und die Welt erlebt, wofür die Leibphilosophie den Begriff „Leib“ geprägt hat. Der Wortstamm „lib“ ist in „Leib“ ebenso enthalten wie in „Leben“ und „Lebendigkeit“. Der Leib des Menschen drängt nach Bewegung, nach innerer wie äußerer, langsamer wie schneller, unruhiger wie ruhiger Bewegung. Aus dem Erleben des Menschen entspringen Leibregungen. Zu diesen können das Körpererleben, das Tönen, das Denken, das Fühlen und anderes mehr zählen. Zu den Regungen des Leibes gehören auch die Leibbewegungen: die Bewegungen des Erlebens (vgl. auch Kap. 20).
Unser Konzept der Leibbewegungen und die Arbeit mit ihnen haben wir ausführlich in dem Buch „Leibbewegungen” (Baer/Frick-Baer 2001a, S.151ff) beschrieben. Dort haben wir das Schwergewicht der praktischen Beispiele und methodischen Hinweise auf die Arbeit mit dem Körper und den körperlichen Bewegungen bzw. dem Tanz gelegt. Wenn sich ein Mensch z. B. mit dem Engen und Weiten beschäftigt, entstehen neben körperlichen Regungen innere Klänge und Töne, die im Musizieren einen Ausdruck finden können. Auch von den Klängen und Tönen der Enge kann ein Weg zum Erleben des Engens und Weitens gefunden werden.
Wir möchten deshalb in diesem Kapitel die Nutzungsmöglichkeiten der Arbeit mit den Leibbewegungen in der Musiktherapie vorstellen. Dabei beziehen wir uns zuerst einmal auf die Raum- und Richtungs-Leibbewegungen sowie die Konstitutiven Leibbewegungen, später dann auch auf die Primären Leibbewegungen (s. Kap. 20.5, Kap. 15.2) . Wir werden jede Leibbewegung bzw. jedes Polaritätspaar der Leibbewegungen kurz skizzieren und dazu jeweils mindestens eine praktische Einheit aus der leiborientierten Musiktherapie beschreiben.
Alle Einheiten sind exemplarisch im doppelten Sinne. Sie bieten nur einen kleinen Auszug aus dem Repertoire, mit dem wir arbeiten. Die Methodik, die wir bei der Einheit zu einer Leibbewegung vorstellen, kann jeweils auch auf die Arbeit mit anderen Leibbewegungen übertragen werden. Wir haben uns bemüht, die Einheiten so auszuwählen, dass darüber die Bandbreite der Arbeitsmöglichkeiten sichtbar wird.
Im Anschluss daran werden wir zehn Hinweise geben, die uns für die Arbeit mit den Leibbewegungen in der musiktherapeutischen Arbeit wichtig sind.
Vorab sei noch darauf hingewiesen, dass die Begriffe, mit denen wir die Leibbewegungen „ordnen“, keine Wertungen beinhalten. Eng kann als einengend, aber auch als kuschelig und geborgen erlebt werden. Mit Weite können der Geschmack von Freiheit und Abenteuer und die Sehnsucht nach Entfaltung und Freiraum assoziiert werden. In der Weite können sich Menschen aber auch verlieren und Angst haben, sich ohne Randbegrenzung aufzulösen.
3.2 Raum- und Richtungs-Leibbewegungen
Unter Raum- und Richtungs-Leibbewegungen verstehen wir die Richtungen hinein und hinaus, rechts und links, vor und zurück, hinauf und hinunter. Dies sind Richtungen motorischer Bewegung, Richtungen der Alltagsbewegungen aller Menschen. In diesen Richtungen vollzieht sich aber nicht nur funktionales, motorisches Bewegen, in ihnen ist auch, wenn es nicht betäubt oder abgespalten ist, Erleben enthalten. Die Bewegung des Aufrichtens kann als ein Sich-Erheben, als aufrechter Gang, als Überheblichkeit gespürt werden. In der Richtung nach unten legen sich die einen nieder und erleben eine „Niederlage“, die anderen finden Boden und spüren die Kraft der Erdung.
Diese Leibbewegungen beschreiben allerdings nicht nur Richtungen, sondern gleichzeitig auch Räume. Wenn ich mich nach rechts bewege, mein Spüren, mein erlebendes Tasten nach rechts hinaus strecke und nach rechts höre, spüre ich die rechte Seite meines Körpers und den Raum rechts von mir. Bewege ich mich in meinem Erleben nach innen, nehme ich spürend meinen Innenraum wahr, vielleicht meine Mitte. In den Raum vor mir kann ich meinen Arm hinein ausstrecken, in ihn kann ich hineinschreiten. Der „Raum, der vor mir liegt“, ist in seiner doppelten Funktion auch ein Erlebensraum, ein Raum, der die Zeit beschreibt, die vor mir liegt, das Geschehen, das mir bevorsteht. Alle Richtungs-Leibbewegungen sind folglich auch räumliche Leibbewegungen und umgekehrt.
Raum- und Richtungs-Leibbewegungen sind:
| hinein (innen) | – | hinaus (außen) |
| rechts | – | links |
| hinauf (oben) | – | hinunter (unten) |
| vor (vorne) | – | zurück (hinten) |
3.2.1 Vor (vorne) – zurück (hinten)
Vor – zurück beschreibt eine Richtung, in der wir uns bewegen und erleben. Vor mir liegt ein Raum und ich kann gleichzeitig erleben, was mir bevorsteht. Und hinter mir befindet sich ebenfalls im buchstäblichen Sinn ein Raum, eine Fläche, aber eben auch ein Erleben dessen, woher ich komme, was hinter mir liegt, was ich im Rücken habe. Dass Raum- und Richtungs-Leibbewegungen die Verknüpfungen von Richtung und Raum, Bewegen und Erleben beschreiben, mag an einer ersten beispielhaften Einheit aus der Gruppenarbeit deutlich werden:
Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn
„Sucht euch einen Platz im Raum, auf dem ihr gut stehen könnt … Schenkt eurem Atem, so wie er jetzt ist, einige Zeit eure Aufmerksamkeit …
Und spürt nun der Rückseite eures Körpers nach: spürt den Hinterkopf, den Nacken, den Rücken, das Gesäß, die Rückseite eurer Oberschenkel, eurer Unterschenkel, die Fersen …
Nehmt nun den Raum hinter euch wahr …
Der Raum hinter euch und eure Rückseite können verschiedene Bedeutungen haben. Gemeint ist buchstäblich ein Raum, eine Fläche, und gemeint ist etwas, das ihr erlebt. Ich sage euch nun einige Worte und Begriffe. Nehmt dazu eure Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, Erinnerungen, Bilder wahr …
Manchmal sagt man, dass etwas hinter einem liegt …
Ich habe etwas zurückgelassen …
Mir ist jemand in den Rücken gefallen …
Ich bekomme Rückendeckung …
Jemand stärkt mein Rückgrat …
Dort komme ich her …
Atmet weiter, lasst den Atem kommen und gehen und ebenfalls eure inneren Klänge, Bilder, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle. Nehmt wahr, was hinter euch ist, im Raum hinter euch. Nehmt ernst, was ihr erlebt …
Wenn ihr mögt, tretet nun einen Schritt zurück in diesen Raum hinter euch. Ihr könnt auch stehen bleiben und nur in der Vorstellung das, was hinter euch ist, wahrnehmen …
Findet nun einen Klang, der das Erleben eurer Rückseite und eures hinteren Raums ausdrückt. Ihr könnt eure Stimme oder ein Instrument benutzen. Probiert aus, bis ihr den Klang, die Klänge findet, die für euch jetzt stimmig sind. Findet euren Weg, euch dem, was hinter euch ist, musikalisch anzunähern …
Wenn ihr noch in dem hinteren Raum steht, tretet wieder einen Schritt nach vorn zu eurem ursprünglichen Standort, stellt euch wieder in den Raum des Hier und Jetzt. Nehmt wahr, was sich nun, nachdem ihr musiziert habt, verändert hat und was nicht … Wenn ihr es braucht, schüttelt ab, was hinter euch ist, tut das, was ihr braucht, um wieder möglichst klar und fest im Hier und Jetzt zu stehen …
Spürt wieder den Kontakt zum Boden …
Hier ist mein Standort …
Hier stehe ich in meinem Leben jetzt …
Nehmt euren Standort wahr, lasst Gedanken, Bilder, Klänge, Gefühle kommen und gehen, sinniert …
Nehmt nun wieder ein Instrument oder nutzt eure Stimme, um das erklingen zu lassen, was ihr erlebt …
Nehmt dann die Vorderseite eures Körpers wahr:
Stirn, Gesicht, Hals, Brust, Bauch, die Vorderseite der Oberschenkel, der Unterschenkel, der Füße …
Spürt den Raum vor euch …
Auch dieser kann mehrere Bedeutungen haben, er kann z. B. für das stehen, was ihr vorhabt …,
vielleicht lächelnd in freudiger Erwartung, vielleicht mit dem Bedenken: Mir steht etwas bevor …
Man sagt auch: Es geht voran, ich will vorwärts gehen, ich muss vorwärts gehen …
Das, was wir vor uns erleben, ist oft der Raum der Sehnsucht, der Raum dessen, wohin es uns zieht …
oder der Raum der Wünsche …
oder der Raum dessen, was wir erreichen wollen …
Und vielleicht mögt ihr diesen Raum jetzt betreten, vielleicht nähert ihr euch vorsichtig an, mit der Fußspitze, mit der Nasenspitze, mit dem kleinen Finger, vielleicht greift und schreitet ihr energisch in diesen Raum hinein …
Vielleicht braucht es erst einen Schritt zur Seite, um nach vorne gehen zu können, oder einen schrägen Schritt. Probiert aus, nähert euch dem Raum vor euch an … und geht dann irgendwann in diesem Raum.
Lasst auch hier Klänge, Bilder, Gefühle, Vorstellungen kommen und gehen, so, wie euer Atem kommt und geht … Nehmt ernst, was ihr erlebt …
Und nun lasst das ertönen, was ihr in dem Erlebnisraum vorne, in der Leibbewegung nach vorne erlebt habt …
Tretet nun wieder zurück in den Hier- und Jetzt-Raum, zu euerm Standort …
Spürt nach, wie euer Standort jetzt ist, nehmt euch ernst, würdigt euch …
Ihr könnt nach vorne gehen, ihr könnt zurückschauen, zurück-erleben und ihr könnt im Hier und Jetzt einen Standort innehaben und einen Standpunkt beziehen, der die Herkunft aus der Vergangenheit und die Orientierung auf die Zukunft in sich birgt …
Würdigt euch, atmet und musiziert und singt …
Nehmt euch nun Zeit, euch mit einer Partnerin oder einem Partner über das, was ihr erlebt habt, auszutauschen.“
So unterschiedlich wie das Erleben sind die Klänge, die den Raum füllen: eine zarte Melodie, das Rauschen der Ozeandrum, tastende Erkundungen auf der Kalimba, ein lautes Trommelcrescendo, das für kurze Zeit alles übertönt, traurig und sehnsuchtsvoll wirkende Flötentöne und viele andere mehr.
Die KlientInnen erleben diese Einheit häufig als eine Bestandsaufnahme ihres gegenwärtigen Lebens und Erlebens. „Als ich mir den Raum hinter mir vorstellte, sah ich dicke schwarze Wolken“, berichtet z. B. eine Klientin hinterher von ihrem Erleben. „Umso überraschter war ich, als ich in diesen Raum hineingegangen bin. Da habe ich die Wolken als sehr angenehm erlebt, auf einmal als hell-dunkel, auch wenn sich das komisch anhört. Ich konnte mich fast so etwas wie anlehnen. Und dann bin ich noch einen Schritt zurückgegangen – und da war Leere, da war zuerst einmal nichts mehr. Und das war Bedrohung und das Gefühl von Freiheit zugleich. Das Nichts war bedrohlich und gleichzeitig hatte ich das ganz wunderbare Gefühl, dass ich offensichtlich vieles hinter mir gelassen habe und im besten Sinne nicht mehr mit mir herumtrage, was ich früher als Belastung und Druck und Eingeengtsein empfunden habe.“ Eine andere schildert ihr Erleben so: „Im hinteren Raum habe ich mich ganz geborgen gefühlt – und dick und rund und breit. Wunderbar. Nach vorne hin ist der Raum schmal geworden – und ich auch. So als ob ich nicht viel Platz und Wahlmöglichkeiten hätte, wohin es in Zukunft geht. Das hat wohl etwas damit zu tun, dass ich im Moment beruflich, an meiner Arbeitsstelle, nicht viel Spielraum habe und ich befürchte, dass mein Spielraum in der nächsten Zeit noch weiter eingeschränkt wird.“ Und noch eine Dritte sei hier zitiert: „Ich habe bei dieser Einheit vor allem eine Botschaft wahrgenommen: dass ich mich mit meinem Tempo arrangieren muss. Ich bin eine langsame Frau. Im Moment trete ich Gott sei Dank in meinem Leben nicht mehr auf der Stelle. Ich fühle mich nicht mehr so unfähig, mich zu bewegen. Ich konnte vorhin einen kleinen Schritt nach vorne machen und dann sogar noch einen zweiten. Zwar mit Aufregung, aber gerne. Und eben langsam.“
Die Fragen: „Woher komme ich – Wo stehe ich – Wohin möchte ich?“ sind in jeder Therapie von Bedeutung. Diese Einheit bringt sie gleichsam „auf den Punkt“ bzw. „auf den Ton“. Bei manchen KlientInnen werden einzelne Aspekte des Vorne und Hinten bzw. des Hier und Jetzt deutlich, die sie beschäftigen, unter denen sie leiden, an denen sie etwas ändern wollen. Eine Klientin traut sich z. B. nicht, nach vorne zu gehen. Eine andere ist einen Schritt zurückgegangen und schafft es kaum noch, in das Hier und Jetzt zurückzukehren, so sehr ist sie im Vergangenen verhaftet. Eine dritte merkt, dass der Standpunkt des Hier und Jetzt brüchig ist, sie erstarrt vor Unsicherheit und bringt nur einen leisen krächzenden Ton heraus. Eine vierte spürt eine große Unzufriedenheit, weil sie einen Vorhang vor sich sieht, hinter dem sie nichts Zukünftiges erkennen kann. All dies sind Hinweise darauf, an diesen kritischen Stellen weiterzuarbeiten. Hier gilt es, genauer nachzufragen und nachzuspüren, worin das Problem besteht. Oft hilft die Nachfrage, welche Klänge oder Rhythmen „gebraucht“ werden, und die Aufforderung, sich diese selbst zu „schenken“, damit die KlientInnen aus ihren Sackgassen, Ängsten, Erstarrungen, Verhaftungen heraustreten und Entwicklungsschritte wagen können. Andere unterstützen wir darin, ihr Tempo, ihren Rhythmus, ihre Lautstärke usw. zu variieren. Oft sind KlientInnen sehr überrascht, wie „stimmig“ die Klänge für sie sind, die in dieser Arbeit entstehen. Gelegentlich sind sie verwundert, können mit dem, was sie musiziert haben, „nichts anfangen“.
Dann hilft es meist, mit diesen Klängen zu improvisieren, und neue Türen des Erlebens und Verstehens öffnen sich.
Manchmal liegt die musiktherapeutische Weiterarbeit bereits unmittelbar in den Worten begründet. Eine Gruppenteilnehmerin erzählt von ihrem Erleben so: „Ich habe große Sicherheit beim Nach-vorne-Gehen gespürt. Das war schön. Beim Austausch mit meiner Partnerin ist mir allerdings aufgefallen, dass ich dabei die Kontrolle behalten will und mir dabei schon mal die Spontaneität flöten geht.“ Was liegt näher, als den Vorschlag zu machen, die Kontrolle zu flöten?
Auch aus den anfangs ertönenden Klängen können Improvisationen oder musikalische Dialoge entstehen, in denen Veränderungen ausprobiert werden.
Für KlientInnen, die musikalisch mutig sind, kann sich an die beschriebene Einheit eine musikalische Gestaltung anschließen:
„Versucht, die drei Klänge oder Klangfolgen oder Melodien, die ihr geschaffen habt, miteinander zu verbinden. Die Reihenfolge ist egal. Es kann etwas hinzugefügt, weggelassen, verändert werden. Gestaltet den Klang des Zurück, den Klang des Hier und Jetzt und den Klang des Nach-Vorn zu einer Musik des Ich-bin-Ich.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.