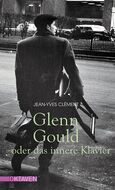Kitabı oku: «Was mich umtreibt», sayfa 2
Aber ich spürte: Du bist ein Ich.
ELIZABETH BISHOP
1Das Bewusstsein vom Ich
1
Von einem «Selbst» zu sprechen klingt zumeist befremdlich. Einige Philosophen behaupten sogar, dass das «Selbst» oder «Ich» eine Illusion sei, entstanden durch einen inkorrekten Gebrauch der Sprache. Das scheint mir wenig plausibel, denn so dumm ist der Mensch nicht. Die Frage nach dem «Ich», nach dem «Selbst», wird nicht durch einen unsachgemäßen Sprachgebrauch aufgeworfen, der unvermittelt grundlos auftritt. Im Gegenteil, der Ausdruck «das Selbst» erwächst aus dem vorausgehenden eigenständigen Empfinden, dass so etwas wie ein «Ich» existiert. Es entsteht aus dem Bewusstsein vom Ich, vom «Selbst». Der Ausdruck «das Selbst» mag in der Alltagssprache ungewöhnlich anmuten und hat in einigen Sprachen auch keine direkte Entsprechung. Nichtsdestotrotz lassen sich in allen Sprachen Umschreibungen finden, die der Rolle des «self» im Englischen oder «Selbst» im Deutschen vergleichbar sind – mag diese Rolle auch noch so diffus sein. Die meisten Menschen verbinden etwas mit dem Ausdruck «das Ich». Er findet auf natürliche, ungezwungene Weise Eingang in philosophische, psychologische oder religiöse Fragestellungen, die ganz selbstverständlich der menschlichen Natur entspringen. Und doch denke ich, dass die Existenz und die Natur des «Ich» die Philosophie vor ein ernsthaftes Problem stellen, das weit über ein bloßes Gedankenspiel hinausreicht. Anthony Kenny und einige andere Philosophen machen es sich zu leicht, wenn sie die «Essenz der Theorie vom Ich» auf einen «grammatikalischen Fehler» herunterbrechen. Es ist schlicht falsch, wenn man in der Wandlung von myself («ich selbst») zu my self («mein Selbst») keine Bedeutungsverschiebung erkennt, sondern eine bloße grammatikalische Nachlässigkeit, «ein Stück philosophischen Nonsens’, bestehend auf dem Missverständnis des reflexiven Pronomens». Es stimmt allerdings, dass wir die Natur des Ich – die ganz gewöhnliche, zutiefst menschliche Erfahrung, ein «Ich» zu besitzen oder ein «Ich» zu sein – erst einmal genauer beleuchten müssen, bevor wir uns die Frage stellen, ob es überhaupt ein «Ich», ein «Selbst» gibt.
2
Einige bezweifeln, dass es überhaupt so etwas wie ein allen Menschen gemeinsames Bewusstsein vom «Selbst» gibt. Und doch existiert ein psychisches Fundament, das allen Menschen eigen ist, gleich welcher Kultur sie entstammen, sogar in weitaus größerer Übereinstimmung, als dies viele Anthropologen oder Soziologen wahrhaben wollen. Ein gemeinsames «Mensch-Sein», tiefe emotionale und kognitive Gemeinsamkeiten, die alle Differenzen kultureller Prägung übersteigen. Die Psyche des Menschen besitzt ein überaus breit gefächertes Spektrum. Und doch findet man große Varietäten in der psychischen Grundstruktur des Menschen eher innerhalb eines einzelnen Kulturkreises als im interkulturellen Vergleich. Der radikale kulturelle Relativismus, wie ihn der Anthropologe Clifford Geertz vertritt und der von breiten Teilen der akademischen Welt immer noch als bindend angesehen wird, scheint die genetischen Determinanten der menschlichen Natur sowie die unstrittigen Gemeinsamkeiten des menschlichen Lebens an sich außer Acht zu lassen.
Daher und weil ich ein unbekümmertes «kantianisches» Vertrauen in die Fähigkeit der Philosophie hege, zu Schlüssen von hoher Allgemeingültigkeit zu gelangen, wenn es um Fragen dieser Art geht, möchte ich diese Bemerkungen zum gewöhnlichen Bewusstsein des Menschen von seinem Selbst – sollten sie sich als wahr erweisen – der gesamten Menschheit zusprechen. Hinsichtlich der Frage nach dem «Selbst» sind die Unterschiede zwischen denen, die schlafen können, und denen, die es nicht können, wohl größer als alle kulturellen Differenzen. Emil Cioran räumt der Schlaflosigkeit sogar eine so immense Bedeutung ein, dass er geneigt ist, den Menschen als «das übernächtigte Tier» zu bezeichnen.
Mit «Bewusstsein vom Ich» meine ich also das sichere Empfinden des Menschen, eine spezifische mentale Gegenwart zu sein, ein mentaler Jemand, mentaler Ort der Wahrnehmung, ein bewusstes mentales Subjekt, das sich von seinen einzelnen Erfahrungen, Gedanken, Hoffnungen, Wünschen und Gefühlen unterscheidet. Dieses «Selbst-Bewusstsein» bildet sich bei fast allen Menschen bereits in der Kindheit aus. Besonders lebhaft erfahren wir es meistens, wenn wir allein sind und denken, aber auch im Lärm eines überfüllten Raumes kann es deutlich zutage treten. Eng damit verbunden ist für die meisten Menschen der Eindruck, dass ihr Körper bloß Wohnstatt für ihr geistiges Wesen ist, ihr eigentliches «Selbst». Physische Betätigung oder Schmerz verdrängen ihn nicht; vielmehr wirken sie oft verstärkend darauf, dass das «Selbst» als etwas vom Körper Unabhängiges verstanden wird.
Damit meine ich nicht, dass ein Bewusstsein vom «Selbst» mit dem Glauben an eine immaterielle, unsterbliche Seele zusammenfällt. Philosophische Materialisten, die, wie auch ich, davon ausgehen, dass jede Bewusstseinsaktivität ein rein physischer Vorgang ist, erleben das «Selbst» im gleichen Maße wie jeder andere Mensch auch.
Unser allgemeiner, natürlicher und unreflektierter Begriff vom «Ich» lässt sich in sechs bis sieben teilweise ineinandergreifende Aspekte gliedern, die ich im Folgenden näher erläutern möchte. Psychische Störungen oder besondere spirituelle Praktiken, so interessant und berechtigt ihre Betrachtung auch sein mag, werde ich dabei ausklammern.
– Erstens: Das «Selbst» wird als Ding erfahren/verstanden, wenngleich schwer fassbar.
– Zweitens: Es ist etwas ausschließlich Mentales; auch dies bedarf genauerer Erläuterung.
– Drittens: Es ist das erlebende Subjekt, welches ganz bewusst fühlt, denkt oder auswählt.
– Viertens: Es ist singulär, einzigartig.
– Fünftens: Es ist etwas Distinktes, klar Unterschiedenes in folgendem Sinne: es ist nicht dasselbe Ding wie der ganze Mensch, insofern der Mensch als ein Ganzes betrachtet wird.
– Sechstens: Es wird als Agens, als Handelndes, Wirkendes erfahren/verstanden.
– Siebtens: Es besitzt einen Charakter, eine individuelle Persönlichkeit.
3
Was genau bedeutet es also, das «Selbst» als Ding zu verstehen? Erst einmal lässt sich sagen, dass das «Selbst» weder ein Zustand noch eine Eigenschaft von etwas ist. Ebenso wenig wird es als Ereignis oder Prozess erfahren. Also kann es sich notwendigerweise nur um ein Ding handeln. Kein Ding im Sinne der Körperhaftigkeit eines Steines oder eines Stuhls, aber doch im weitesten Sinne ein Ding mit Kausalcharakter. Also etwas, das Veränderungen unterliegen kann und das Einfluss auf andere Dinge nimmt. George Berkeleys Charakterisierung des «Selbst» als «geistiges tätiges Prinzip» kann hier genauso gut dienen wie jede andere. «Prinzip» in seinem alten Sprachgebrauch scheint das Problem auf elegante Weise zu lösen, indem es weitestgehend ein Ding evoziert, ohne gleich an ein fassbares Objekt, wie einen Tisch oder einen Stuhl, zu erinnern. Und doch denke ich, dass wir die Kategorie Ding um den von Fichte geprägten Begriff «Tathandlung» erweitern sollten. Objekte physischer Natur, wie Stühle, Berge, etc., werden auf metaphysisch-wissenschaftlicher Ebene ebenso als Prozess betrachtet. Prozesse, die nichts weiter zu sein brauchen, als sie es bereits sind, und darin weiter existieren oder stattfinden dürfen.
Betrachten wir die zweite Eigenschaft des «Selbst», das rein Mentale. Auf den ersten Blick einleuchtend, bedarf es bei der mentalen Natur des «Selbst» doch einer differenzierteren Erklärung. Die zentrale Idee scheint folgende: Wenn das «Selbst» als Ding gedacht wird, scheint seine Forderung, dem Bereich der Dinge anzugehören, schon durch seine mentale Natur ausreichend begründet zu sein. Nichtsdestotrotz kann es über eine nicht-mentale Natur verfügen, wie ich oder andere Philosophen annehmen – eine nicht-mentale Natur in Form eines Systems oder einer Vielzahl von Systemen innerhalb des Gehirns. Aber die «Dinghaftigkeit» des «Selbst» gründet hier nicht auf der Ebene des Nicht-Mentalen. Das «Selbst» ist ein mentales «Selbst». Es stimmt, dass wir ganz selbstverständlich davon ausgehen, mentale und nicht-mentale Eigenschaften zu besitzen. Das wirkt sich allerdings nicht auf die allgemein verbreitete Auffassung vom «Selbst» als etwas spezifisch Geistigem aus.
Wie bereits gesagt, schließt das Bewusstsein vom «Selbst» als einem spezifisch mentalen Ding nicht notwendigerweise den Glauben an eine immaterielle Seele ein. Es trägt allerdings durchaus Züge, die einen solchen Glauben ganz unweigerlich nach sich ziehen können. Es ist einfach, sich das mentale «Selbst» als autarke, sich selbst genügende Einheit vorzustellen, die innerhalb einer Sphäre existiert, die nichts mit der durch die Physik beschriebenen Realität zu tun hat. Die Dinge sind nicht das, was sie scheinen, wie wir Materialisten sagen, aber sie erscheinen als das, was sie scheinen. Und vor diesem Hintergrund lässt es sich einfach erklären, wie natürlich es ist, das «Selbst» als etwas spezifisch Mentales zu betrachten.
Die dritte Eigenschaft des «Selbst» als Subjekt der Erfahrung und des Erlebens erscheint mir eindeutig und leicht zu verstehen. Was also ist ein Subjekt der Erfahrung? Der eine oder andere mag dies als heikle Fragestellung betrachten, und doch meine ich, dass der gesunde Menschenverstand eine sehr präzise Vorstellung davon hat. Vielleicht ist die Antwort nicht so leicht in Worte zu fassen, aber das Verständnis davon besitzen wir intuitiv, da wir alle Subjekte der Erfahrung sind und uns unserer selbst sehr bewusst sind, unabhängig davon, welche religiöse oder philosophische Überzeugung wir vertreten. Eigentlich wird der Mensch in seiner Gesamtheit von Körper und Geist als Subjekt der Erfahrung betrachtet, wie nebenbei auch alle anderen Lebewesen. Wir Menschen tendieren allerdings dazu, insbesondere unser mentales «Selbst» als erfahrendes, erlebendes Subjekt anzusehen. Das muss nicht notwendigerweise korrekt sein. Ich versuche an dieser Stelle vor allem zu beschreiben, wie wir dies erleben.
Nun zum vierten Aspekt des «Selbst», seiner Singularität. Aber inwiefern ist das «Selbst» denn einzigartig? Nicht in Form eines einzelnen Kollektivs, wie beispielsweise ein Haufen Murmeln singulär ist, sondern eher in dem Sinne, dass eine einzelne Murmel einzigartig ist, wenn man sie in Vergleich zu einem Haufen Murmeln setzt. Das «Selbst» wird standardmäßig als singulär betrachtet. Dies gilt sowohl für sein «synchrones» Erscheinen, also zu einem bestimmten Zeitpunkt während einer einheitlichen, lückenlosen Bewusstseinsperiode, als auch für seine «diachrone» Existenz, d. h. als etwas über einen längeren Zeitraum hinweg Bestehendes. Wirklich ununterbrochene Bewusstseinseinheiten sind, wie ich denke, extrem kurz, wenige Bruchteile einer Sekunde vielleicht, allerhöchstens ein paar Sekunden. Man sollte den Terminus «synchron» durchaus etwas ausdehnen, um solche Abschnitte abdecken zu können.
Manche behaupten, das «Selbst» als etwas Fragmentarisches, Multiples zu erleben, und ich glaube, jeder von uns hat entsprechende Erfahrungen gemacht, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Manches Mal sind wir rasch wechselnden, sich überlagernden Stimmungen oder gravierenden inneren Interessenkonflikten unterworfen. Gedankliche Prozesse können mit einer solch rasenden Geschwindigkeit ablaufen, dass sie förmlich auf uns einstürzen und keine gedankliche Ordnung mehr zulassen. Das mag als Beleg für ein multipel-synchrones Erfahren des Selbst genommen werden.
Nehmen wir einander widerstreitende Bedürfnisse in uns wahr, verstärkt dies jedoch meist unseren Eindruck vom «Selbst» als einer singulären Einheit. Ist es nicht letztendlich so, dass man eine derartige innere Diskrepanz nur dann zu registrieren vermag, wenn man sich im Grunde als ein Einziges betrachtet? Wie ist es zum Beispiel, wenn uns eine chaotische Gedankenflut überkommt? Meistens empfinden wir uns dann als hilflose Zuschauer einem mentalen Pandämonium gegenüber. Und auch hier: Die Erfahrung, ein bloßer Zuschauer zu sein, verstärkt doch wieder unsere Wahrnehmung von uns selbst als singulärer Einheit. Und sollte man annehmen, dass es überhaupt möglich ist, sich als multipel-synchrones «Ich» wahrnehmen zu können, setzt dies ein Höchstmaß an selbstreflexivem Denken voraus, das wiederum von vornherein derartige Erfahrungen ausschließt. Die Metapher der Multiplizität ist machtvoll, aber sie bleibt eben doch nur eine Metapher, die ihre Stärke aus der ursprünglichen Erfahrung von Singularität bezieht. Wie Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft bemerkt, «… kann doch das subjektive Ich nicht geteilt und verteilt werden, und dieses setzen wir doch bei allem Denken voraus».
Nun zum fünften Aspekt des «Selbst», seiner Unterschiedenheit. Wovon unterscheidet sich das «Selbst»? Auf diese Frage lassen sich gleich mehrere Antworten finden. Zuallererst wird das «Selbst» als etwas von der körperlichen Gesamtheit des Menschen Verschiedenes verstanden. Darüber hinaus unterscheidet es sich zweitens auch von allen mentalen Vorgängen, wie Gedanken und Gefühlen etc., denn es hat Gedanken und Gefühle, fällt aber nicht mit ihnen zusammen oder wird gar von diesen gebildet. – David Hume zog das «Selbst» als Serie mentaler Vorgänge in Betracht. Der gesunde Menschenverstand steht allerdings einer solchen «Bündel-Theorie» entgegen. Hume selbst hat diesen Gedanken am Ende auch wieder verworfen. – Drittens lässt sich sehr wohl denken, dass das «Selbst» von allen unbewusst ablaufenden mentalen Vorgängen, wie Überzeugungen, Vorlieben, Erinnerungen oder Charakterzügen, unterschieden ist. Und zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass es sich als getrennt von allem Physischen denken lässt – etwa als immaterielle Seele. Diese Idee ist allerdings nicht integraler Bestandteil des «Ich-Bewusstseins».
Unter dem sechsten Aspekt wird das «Selbst» gemeinhin als Agens, als Handelndes verstanden. Es geht seinen eigenen Aktivitäten nach – Denken, Vorstellen, Wählen –, und das ganz unabhängig von den übrigen Aktivitäten des Körpers, ja es setzt diese sogar selbsttätig in Gang. Um es mit den Worten von William James auszudrücken: «Anstrengung der Aufmerksamkeit ist somit die wesentliche Erscheinung des Wollens.» Für uns alle ist dies wohl ohne Weiteres nachzuvollziehen.
Der siebte Aspekt besteht in der These, dass das «Selbst» einen Charakter, eine Persönlichkeit besitzt, so wie auch der gesamte physische Mensch. Wir alle verstehen unseren individuellen Charakter als die Art, wie wir von unserem Wesen her sind. Gehen wir also davon aus, dass unsere Existenz ein mentales «Selbst» einschließt, so sehen wir ganz selbstverständlich dieses geistige «Ich» als Sitz unserer Persönlichkeit.
4
Setzt man voraus, dass diese sieben Aspekte das gewöhnliche «Bewusstsein vom Ich» im Wesentlichen umfassen, stellt sich doch die Frage, ob sie für das genuine, eigentliche «Bewusstsein vom Selbst» allesamt unabdingbar sind. Ich denke nicht – nicht einmal im Falle der menschlichen Spezies.
Der Zweifel an der Charakterlichkeit des Selbst liegt auf der Hand. Für die meisten Menschen ist ihre eigene individuelle Persönlichkeit im jeweilig gegenwärtigen Moment kaum wahrnehmbar. Sie ist der Standpunkt, von dem aus die Welt betrachtet wird, oder das Instrument, durch welches das Äußere erfahrbar wird. Sie stellt sich ihnen als automatische, nicht hinterfragbare Gegebenheit dar, als eine globale, unsichtbare Kondition ihres Lebens, wie die Luft, nicht als ein Objekt der Erfahrung. Ian McEwan spricht von einem «gläsernen Kontinuum unserer Persönlichkeit», wobei er, wie ich glaube, die Transparenz oder Unsichtbarkeit des eigenen «Selbst» meint, das sich der Wahrnehmung durch das «Selbst» entzieht. Sartre äußert sich dazu folgendermaßen:
«Diese Überlegungen ermöglichen eine Erklärung dessen, was wir Charakter nennen. Es ist hierbei ja festzuhalten, dass der Charakter nur als Erkenntnisobjekt für den Andern eine bestimmte Existenz hat. Das Bewusstsein erkennt seinen Charakter nicht – außer, wenn es sich reflexiv vom Gesichtspunkt des Andern aus bestimmt – […] Deshalb bietet die bloße introspektive Selbstbeschreibung nie einen Charakter dar.»
An dieser Stelle sollte unbedingt erwähnt werden, dass die meisten Menschen sich selbst in bestimmten Situationen als «Ort des Bewusstseins», als bloßen «kognitiven Standpunkt» erfahren. Meist sind es kurze Begebenheiten, die in uns ein derartiges Erleben unserer selbst hervorrufen: Erschöpfung, Einsamkeit, Schock, Sex, abstraktes Denken, Langeweile, ein heißes Bad oder einfach das Gefühl beim Aufwachen.
Auch eine klinische Depression kann bei gravierendem Verlauf eine «Entpersonalisierung» mit sich bringen. Ein pathologisches Phänomen, das sich für die erkrankte Person auch über einen längeren Zeitraum hinweg als realer Zustand darstellt. Gleich einer außerirdischen Spezies ohne individuelle Persönlichkeit und dennoch ausgestattet mit einem klaren Verständnis von sich als «Ort des Bewusstseins».
Demgegenüber steht ein starkes Empfinden der eigenen mentalen Individualität, wie es beispielsweise Gerard Manley Hopkins umschreibt:
«Mein Selbst-Sein, mein Bewusstsein und das Gefühl meiner selbst, der Geschmack meines Selbsts, von Ich und mir über und in allen Dingen, der deutlicher ist als der Geschmack von Bier oder Alaun, deutlicher als der Geruch eines Walnussblatts oder von Kampfer, und der für einen anderen Menschen nicht mitteilbar ist auf irgendeine Weise … Nichts anderes in der Natur kommt diesem unbeschreiblichen Akzent von Tonhöhe, Unterscheidungskraft und Selbsterfahrung, dem Bewusstsein meines eigenen Selbst, nahe.»
Mich irritieren Hopkins Zeilen. Es fällt mir schwer, nachzuvollziehen, dass sie der Wahrheit entsprechen sollen, selbst wenn so mancher sie mir als exakt und zutreffend bestätigt hat. Um mit Sartre zu sprechen: Den meisten Menschen entzieht sich ihre Persönlichkeit der eigenen momentanen Wahrnehmung und bleibt für sie schlicht unbemerkt.
5
Hartnäckiger hält sich die Idee, das Empfinden vom «Selbst» müsse zwangsläufig eine gewisse Dauerhaftigkeit einschließen. Ich denke jedoch, dass die Selbstwahrnehmung zu jedem gegebenen Zeitpunkt lebhaft und vollständig ist, mag der ununterbrochene «Bewusstseinsabschnitt» auch noch so kurz sein.
Man mag davon ausgehen, dass es dem Menschen unmöglich ist, sich nicht als fortdauerndes «Selbst» zu empfinden, auch, dass eine solche Hypothese der menschlichen Natur und Lebensrealität entgegensteht, und doch bin ich der festen Überzeugung, dass ein Leben ohne das Bewusstsein einer Langzeitkontinuität des mentalen «Ich» durchaus im Bereich menschlicher Erfahrung liegt. Wir können uns sehr wohl im Klaren darüber sein, als mehr oder weniger gleichbleibende körperliche Präsenz zu existieren, ohne dies notwendigerweise für unser mentales «Ich» in Anspruch zu nehmen. Vielleicht spielt diese Vorstellung von emotionaler Warte aus keine große Rolle für uns, vielleicht trägt sie auch nicht grundlegend zu unserer generellen Wahrnehmungsweise bei. Die einzelnen Menschen unterscheiden sich tiefgreifend in ihrem Erleben von Kontinuität.
Diesen Unterschieden Rechnung tragend, möchte ich William James zitieren:
«In der ersten Person überlasse ich meine Beschreibung der Akzeptanz der anderen, für deren Selbstbeobachtung es [die Kontinuität] sich als wahr erweisen mag, und gestehe meine Unfähigkeit, den Anforderungen anderer zu entsprechen, wenn es andere gibt.»
Als James dies schrieb, wird er wohl kaum ernsthaft in Betracht gezogen haben, dass es jemanden gibt, der anders empfindet als er selbst. Ebenso wenig wird Hume davon ausgegangen sein, dass manche Menschen, wenn sie den Blick nach innen richten, ein gleichförmiges, fortdauerndes «Selbst» vorfinden, auch wenn er, Hume, sich sicher ist, dass ein «solches Prinzip» nicht in ihm zu finden sei. Für mich dagegen steht außer Frage, dass andere Menschen anders sind als ich selbst. Allerdings denke ich, dass meine Art des «Selbst-Erlebens» gleichwohl Teil des normalen menschlichen Erfahrungsspektrums ist, auch wenn sie die Normalität einer Minderheit repräsentiert – einer Minderheit, die in etwa der Häufigkeit roter Haare entspricht.
Die gleiche Divergenz findet sich bei der Merkbzw. Erinnerungsfähigkeit der Menschen. Manche verfügen über ein exzellentes «autobiografisches» Gedächtnis und eine außergewöhnlich lebhafte Erinnerung, die nicht nur verlässlich, sondern ebenso nachhaltig ist. Häufig ist dieses Erinnern sehr aktiv und vermischt sich mit gegenwärtigen Gedanken. Andere dagegen verfügen nicht über ein solch ausgeprägtes persönliches Gedächtnis. Ihr Erinnern verläuft in sehr ruhigen Bahnen und greift fast nie in das gegenwartsbezogene Denken ein. Gleichermaßen variierend zeigt sich die Vorstellungskraft der Menschen, ihre Fähigkeit, Dinge zu antizipieren oder Vermutungen über die Zukunft anzustellen.
Diese Differenzen treten in Wechselwirkung miteinander. Es scheint, dass manche Personen in einer «narrativen» Weise leben und fälschlich annehmen, jeder andere tue dies gleichfalls. Sie erfahren ihr Leben als etwas, das eine Gestalt und eine Geschichte aufweist, als eine Erzählhandlung. Einige führen Tagebuch mit Blick auf die Nachwelt oder entwerfen gar ihre zukünftige Biografie. Andere sind in weitaus größerem Maße «Selbst-Erzähler»: Sie repetieren ihre Erinnerungen regelmäßig und ändern die Interpretation ihres Lebens immer wieder von Neuem ab. Manche sind großartige Planer, die ihr zukünftiges Leben in «Langzeitprojekten» durchstrukturieren. Andere dagegen haben keine frühen Ambitionen, keine späte Erkenntnis einer Berufung, kein Interesse daran, eine Karriereleiter zu erklimmen. Sie besitzen nicht die Tendenz, ihr Leben als Entwicklung zu betrachten, als eine aufeinander aufbauende Lebensgeschichte. Für sie stellt es sich vielmehr als episodische Abfolge einzelner Lebenssituationen dar, zwischen denen sie zu gegebener Zeit wechseln. Manche Menschen planen wenig und sorgen sich kaum um die Zukunft. Manche leben intensiv in der Gegenwart. Manche sind einfach ziellos. Dies kann zum einen durch den Charakter bedingt sein, zum anderen als Folge besonderer spiritueller Übungen auftreten. Sowohl Mittellosigkeit – das absolute Fehlen von Chancen – als auch übergroßer Wohlstand können dazu führen. Es sind die Träumer, Mystiker, Freaks dieser Welt oder aber diejenigen, die hart arbeitend nur von einem Tag zum nächsten zu denken vermögen. Die Ursachen sind hier schillernd. Es gibt Kreative, denen es an Ambition oder langfristigen Zielen mangelt – die Sprunghaften, die von einem kurzen Projekt zum anderen leben, und auch jene, denen ganz «en passant» ein großes, umfangreiches Werk gelingt. Andere hingegen sind, manchmal ohne es zu wissen, in ihrem Charakter sehr beständig, eine Bedingung, unter der das «Selbst» leicht als Kontinuität wahrgenommen werden kann. Dann gibt es noch diejenigen, die beständig in ihrer Unbeständigkeit sind, die sich selbst dauerhaft als «Stückwerk» empfinden, welches sich immer wieder neu zusammensetzt. Und zuletzt auch solche Menschen, die wie betäubt durchs Leben gehen.
Ich selbst befinde mich irgendwo am «episodischen» Ende des Spektrums. Ich habe kein Empfinden meines Lebens als Lebensgeschichte und interessiere mich kaum für meine eigene Vergangenheit. Mein «biografisches» Gedächtnis ist schwach ausgebildet und hat kaum Auswirkungen auf mein gegenwärtiges Bewusstsein. Die Zukunft plane ich allerdings sehr wohl, und insoweit kann ich mich gedanklich durchaus als fortdauernde Präsenz auffassen. Aber diese Art von «Selbstverständnis» fühlt sich für mich fern und theoretisch an. Am besten umschreibe ich das für mich übliche Empfinden meiner selbst folgendermaßen: Ich glaube nicht, dass mein «Ich» als solches in der Zukunft existiert, der Mensch Galen Strawson hingegen schon.
Im Januar 1996 schrieb ich: Der Gedanke, es bis zu den Vorlesungen für das Wolfson College im März fertigstellen zu müssen, bereitet mir einiges Unbehagen, das die üblichen körperlichen Reaktionen mit sich bringt. Ich fühle die Anspannung unvermittelt und empfinde sie auf natürliche Weise als zu mir gehörig, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich es selbst bin, der die Vorlesung halten wird. Es erscheint mir sogar rundheraus falsch, zu sagen, dass ich es sein werde. Das ist exakt, was ich fühle, und nicht etwas, das ich aufgrund irgendwelcher theoretischen Überzeugungen glaube. Warum fühle ich dann Angst? Wahrscheinlich ist die Empfänglichkeit dafür angeboren, quasi «fest verdrahtet» und verbunden mit dem Selbsterhaltungstrieb: Meine Zukunftsangst bewegt sich sicherlich im normalen menschlichen Rahmen. Sie ist biologisch begründet und autonom, insofern sie als etwas unmittelbar Spürbares fortdauert, ohne auf emotionaler Ebene zu gründen, denn es ist ja nicht mein augenblickliches «Ich», das morgen sein wird.
Meine Art von «Selbsterfahren» ist nur eine unter vielen. Ohne Zweifel gibt es weit extremere Formen. Ich habe sie an dieser Stelle beschrieben, um meine These zu stützen, dass das «Bewusstsein vom Ich» nicht notwendigerweise Kontinuität über einen langen Zeitraum einschließt. Das «Selbst» als etwas Fortdauerndes zu erfahren mag verbreitet sein, es ist jedoch nicht universell. Bei manchen schwindet dieses Empfinden mit der Zeit, bei anderen durch Reflexion.