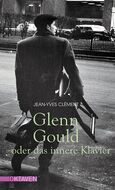Kitabı oku: «Was mich umtreibt», sayfa 3
6
Einige sind der Ansicht, dass Bewusstseinserfahrungen und -vorgänge fließen, gleichsam als «Bewusstseinsstrom». Unabhängig von jedweder theoretischen Annahme reicht ihnen zur Begründung die bloße Erfahrung.
Nach William James:
«Das Bewusstsein erscheint sich daher selbst nicht als in Stücke zerhackt. Worte wie ‹Kette› oder ‹Zug› geben nicht richtig den Eindruck wieder, den es unmittelbar von sich selbst gewinnt. Es besteht nicht aus verbundenen Gliedern; es fließt. Ein ‹Fluss›, ein ‹Strom›, das sind die Metaphern, durch welche es am natürlichsten versinnbildlicht wird. Wir wollen es also, wenn wir von nun an davon sprechen, den Strom des Denkens, des Bewusstseins oder des subjektiven Lebens nennen.»
Das war im Jahr 1890 sicher eine bahnbrechende Neuerung gegenüber dem damals in der Psychologie vorherrschenden Atomismus, der Bewusstseinsprozesse mit Metaphern wie Folge oder Kette, Sammlung, Bündel oder Haufen umschrieb. Der heutige Trend verleitet uns allerdings vielleicht dazu, das Bewusstsein zu sehr als Fluss aufzufassen. Ein wichtiger Aspekt: Wenn Bewusstsein als Strom empfunden wird, mag dies zur Erklärung beitragen, warum Menschen ein Gefühl von Dauerhaftigkeit haben.
In der Tat halte ich die Fluss-Metapher für unangemessen, selbst wenn man einwendet, dass ein Fluss ja auch Seen und Wasserfälle ausbildet (und natürlich Steine und Algen mit sich führt). Von Natur aus hat das Denken wenig Kontinuität. Ein Strömen ist kaum zu vernehmen, zumindest wenn ich von mir ausgehe. Mein Denken springt von bloßem Bewusstsein zu «Selbst-Bewusstsein» und wieder zurück. Es stürmt los, reißt ab, wallt auf und kehrt um. Für James verhält sich das Denken wie «das Leben eines Vogels im beständigen Wechsel flüchtiger Bewegung und Ruhe» – ein wunderbares Bild. Und doch bewegt sich der Vogel innerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums. Der Vergleich lässt also außer Acht, dass die Gedankenfolge immer wieder unterbrochen wird durch Umwege, Brüche, Nebengedanken und das Hintergrundrauschen, vor allem dann, wenn wir unsere Gedanken schweifen lassen.
Anders stellt es sich dar, wenn wir unsere Aufmerksamkeit zielgerichtet auf geordnet ablaufende Prozesse in der Außenwelt lenken, beispielsweise bei einem schnellen, spannenden Spiel oder wenn wir Musik hören. Das Denken oder das Bewusstsein scheint dann die Struktur und den Verlauf des Phänomens anzunehmen, auf das es fokussiert ist. Trotzdem kann es auch jetzt immer noch abschweifen, von Neuem beginnen oder sich mit fremden Inhalten beschäftigen. Aber ist ein einzelner spekulativer Gedanke überhaupt in der Lage, etwas aufzudecken, was in groben Zügen auf das Denken insgesamt zutrifft? Manch einer findet, dass James Joyce in seinem Roman Ulysses die Darstellung von Bewusstseinsprozessen bei Stephen Dedalus besser gelingt als bei Molly Bloom.
Stephen Dedalus:
Wer schaut mir hier zu? Wer wird denn wohl je irgendwo die geschriebenen Worte hier lesen? Zeichen auf weißem Feld. Für irgendwen irgendwo in deinen flötendsten Tönen. Der gute Bischof von Cloyne zog den Vorhang des Tempels aus seinem Schaufelhut: Schleier des Raums mit gefärbten Emblemen, schraffiert auf seinem Feld. Moment mal, halt. Gefärbt auf einer Fläche: doch, das stimmte schon.
Molly Bloom:
lass mal sehn, ob ich noch wieder etwas eindämmern kann 12345 was sind das eigentlich für Blumen die sie da erfunden haben wie die Sterne die Tapete in der Lombard Street war viel schöner die Schürze die er mir geschenkt hat die war so ähnlich gemustert ich hab sie aber bloß zweimal getragen lieber die Lampe bißchen runterdrehn und nochmal versuchen dass ich früh auch aus den Federn komme ich werde zu Lambe gehen da neben Findlater dass sie uns ein paar Blumen schicken die ich in der Wohnung aufstellen kann für den Fall dass er ihn morgen mit nach Hause bringt heute meine ich nein nein …
Andere favorisieren Dorothy Richardson, die als Erste im Roman die «stream of consciousness»-Technik verwendet.
«Es war ganz sicher falsch, Predigten zu hören … verdummend … es sei denn, sie waren intellektuell … Vorträge wie die von Mr. Brough … aber das war ebenso schlecht, weil das keine Predigten waren … Beides war schlecht und sollte nicht erlaubt sein … eine Kanzelrede … Predigten … Kanzelreden … eine ruhige Kanzelrede mochte schon nett sein … und keine Mildtätigkeit – klingendes Kupfergeld und ein klirrendes Becken … Caritas … Ich bin sicher, ich habe keine …»
Virginia Woolf schrieb einst, dass Richardson zu einer neuen Form gefunden habe, die man als «psychologischen Satzbau des weiblichen Geschlechts» bezeichnen könne, aber ich bezweifle, dass diese Merkmale in irgendeiner Weise geschlechtsspezifisch sind.
7
Während des Bewusstseinsprozesses kommt es immer wieder zu Brüchen, und das nicht nur auf inhaltlicher Ebene. Das Denken kann sich auf einen vollkommen anderen, neuen Gegenstand richten, ohne dass wir eine Unterbrechung oder zeitliche Lücke im Bewusstseinsprozess empfinden. Trotzdem scheint mir, dass ein nahtlos fortlaufendes Bewusstsein relativ selten zu erleben ist. Wenn ich allein bin und nachdenke, vor allem über das Denken selbst, stelle ich fest, dass mein Bewusstsein immer wieder von Neuem hervorgebracht wird. Dies impliziert automatisch punktuelle Phasen von Nicht-Bewusstheit. Die (unvergleichlich kurzen) Sequenzen ununterbrochenen Bewusstseins stehen radikal unverbunden nebeneinander, selbst wenn es sich um denselben (oder nahezu denselben) Gedanken handelt, der nach blitzartigem Aussetzen wiederauftaucht. Nach meinem Empfinden handelt es sich um eine kontinuierliche Abfolge von Bewusstseins-Neustarts aus dem Nichts.
Manche Brüche bringen einen kompletten Fokus-Wandel mit sich, andere trennen Gedanken, die sich mit demselben Inhalt beschäftigen. Manches Mal richten wir unsere Aufmerksamkeit in so vollständiger Weise auf etwas, dass uns ein Bewusstseins-Bruch fast entgeht. Es handelt sich dann eher um eine Zäsur, ein gänzlich akzidentelles Merkmal des Bewusstseins-Mechanismus (quasi eine «refresh rate»). Vielleicht liegt ihre Funktion darin, die Aufmerksamkeit neu zu fassen und zu bündeln, um eine neue Synthese im kantianischen Sinne zu schaffen. Diese Sequenzierungsprozesse laufen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ab, sodass es uns extrem schwerfällt, solche Lücken oder Brüche wahrzunehmen; aber unmöglich ist es nicht. Man stelle sich dies ungefähr so wie den Lidschlag vor: Eigentlich bleibt er unbemerkt, erst wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, nehmen wir ihn wahr.
Vielleicht ist dies ja eine vorschnelle Generalisierung meines eigenen Erlebens oder ein unwillentliches Bekenntnis von Schizophrenie. Und doch gehe ich davon aus, dass ein sorgfältiges mentales Selbst-Studium jedem Menschen bis zu einem gewissen Grad ähnliche Erkenntnisse beschert. Glaubt man daran, dass Bewusstsein fließend vonstatten geht, wird man es unweigerlich auch als Bewusstseinsstrom erleben, aber bei genauerer Überlegung wird man diese Metapher mit Sicherheit in Zweifel ziehen.
Ezra Pound scheint so etwas nicht ganz Perfektes im Sinn gehabt zu haben, als er schrieb:
«Eine bewusste Disjunktion,
Nichts sein als diese verwischte
Serie
von Unterbrechungen.»
Pounds Worte treffen hervorragend auf jemanden wie Malcolm Lowry zu – auf seine Begabung und seine Vision, nicht seine Trunkenheit. Für einige stellen sie eine akkurate Beschreibung harter und effektiver Gedankenarbeit dar, die sich mit schwierigen Inhalten beschäftigt. Für andere bilden sie ganz gewöhnliche Denk-Prozesse ab, ohne irgendeine Geringschätzung zu implizieren.
«Sind Sie sicher? Vielleicht ist die Erfahrung der Disjunktion ein Artefakt der Introspektion: Vielleicht werden die Tatsachen durch den Versuch, sie zu beobachten, verzerrt. Vielleicht ist das nicht beachtete Bewusstsein in Wirklichkeit ein Fluss.»
Darauf habe ich zwei Antworten. Erstens: Auch wenn das Auftreten von Unterbrechungen teilweise oder sogar zu großen Teilen durch das «Hinschauen» künstlich erzeugt wäre, zeigt dies doch, wie Bewusstsein sich selbst erscheint. Dieser Aspekt ist vor allem dann interessant, wenn man Bewusstseinsaktivitäten das Gefühl von Kontinuität zugrunde legt. Zweitens: Wir werden spontan einer Zäsur im Bewusstsein gewahr, d.h. wir stellen fest, was gerade passiert, und nicht umgekehrt, dass wir nur dann etwas stattfinden sehen, wenn wir auch genau darauf achten. (Man kann hier schlicht und ergreifend keine Entscheidung treffen, denn das würde voraussetzen, dass wir in der Lage wären, etwas zu beobachten, während es gleichzeitig unbeobachtet bleibt.)
8
Wenn es in der Natur unseres Bewusstseins liegt, sich von Moment zu Moment zu bewegen, entstammt unser Empfinden von Kontinuität also nicht wirklich einem objektiv ununterbrochenen Gedankenstrom. Die Quellen für dieses Gefühl müssen zwangsläufig andere sein. Dank unseres Kurzzeitgedächtnisses und durch die Beständigkeit und Kohärenz des gedanklichen Inhalts bleiben unsere Erfahrungen durch die Zeit hindurch miteinander verbunden – trotz radikaler Sprünge und Zäsuren im Bewusstseinsprozess.
Untersuche ich den Ablauf meines Denkens detailliert, mag es fahrig und ruckartig erscheinen. Und doch steht meine Erfahrung in Verbindung mit einem ganzen Pool von Konstanten und stetigen Wandlungsprozessen in meiner Umwelt, meinen Körper eingeschlossen. (Ein Beispiel: Ich arbeite eine Stunde lang in einem Raum; ich betrachte den Regen auf der Fensterscheibe, denn kehre ich zu meiner Seite zurück; während der ganzen Zeit halte ich denselben Stift.)
Auf den ersten Blick wirken diese äußerlichen Konstanten und die Beständigkeit meiner Gedankeninhalte wie Charakteristika meines Bewusstseinsprozesses. Sie sind dies aber nicht wirklich. Und doch vermögen sie mir das Gefühl eines beständigen «Ichs» zu geben und tun dies den ganzen Tag über. Auf diese Weise bahnt sich die Idee ihren Weg, dass dieses «Ich» auch über den Schlaf hinaus fortbesteht, und so von Woche zu Monat und von Monat zu Jahr.
Wenngleich mir mein Bewusstseinsprozess nicht als nahtloser Fluss erscheint, kann ich trotzdem mein mentales «Selbst» als Konstante empfinden. Beim ersten Blick auf unser Bewusstsein vom «Ich» – es ist bereits schwer, darüber nachzudenken und es nicht bloß zu haben – wird unsere unmittelbare Reaktion sein, unser «Selbst» als etwas zu begreifen, das den gesamten wachbewussten Tag über fortbesteht. Etwas, das all die Gedankenfragmente und Erfahrungssequenzen hat, selbst jedoch ungeteilt ist. Gestützt wird diese Reaktion durch unsere Wahrnehmung unserer selbst als gesamter Mensch mit einer fest verankerten Palette von grundsätzlichen Überzeugungen, Vorlieben, Begabungen, mentalen Fähigkeiten usw.
In meinem Fall ist diese Reaktion an sich schwach ausgeprägt und leicht zu untergraben. Denke ich über mein mentales Leben nach, verstehe ich mich sowieso nicht als gleichbleibendes «Ich», nicht einmal für einen einzigen Tag, geschweige denn darüber hinaus. Das Gefühl von Kontinuität beschränkt sich bei mir auf meine rein körperliche Anwesenheit. Wenn ich mich als «mentales Subjekt der Erfahrung» betrachte, empfinde ich mein «Ich» in jedem Augenblick als ein neues. Nicht was meine Persönlichkeit oder mein Aussehen betrifft, in der Hinsicht besitze ich sehr wohl eine perfekte Kenntnis davon, was mich, Galen Strawson, an jedem Tag gleichbleibend ausmacht. Wenn ich allerdings den Kern meines Selbstverständnisses als mentales Wesen nehme, fühle ich mich immer wieder neu.
In seiner Autobiografie schreibt John Updike: «Ich habe das beharrliche Gefühl, im Leben und in der Kunst, dass ich gerade erst anfange.» Das trifft es genau. Die Erfahrung vom «Ich» als etwas, das sich immer wieder neu bildet, ist meines Erachtens fundamental und universal zugänglich, wird bei vielen aber durch vertraute und gegenläufige Denkgewohnheiten blockiert. Nur Reflexion kann dies klar zutage treten lassen. Ich fühle mich besonders den Zeilen Harold Brodkeys verbunden:
«Unser Gefühl von Gegenwärtigkeit bewegt sich gewöhnlich in Wellen voran, von denen wir geistig abgeworfen werden; wir schweifen ab. Gewöhnlich tauchen wir wieder auf, reiten weiter auf der Welle und stürzen ab, immer von Neuem … doch was uns ausmacht, ist dieses Abfallen und Wiederkehren.»
Ich empfinde mich als Nomaden in der Zeit, wobei diese Metapher widersinnig ist, denn es handelt sich ja um das «Ich» selbst, das die Flüchtigkeit einer temporären Lagerstätte hat.
Wissenschaftliche Untersuchungen von Ernst Pöppel und Eva Ruhnau haben ergeben, dass das «bewusste Jetzt» ungefähr drei Sekunden andauert, d.h. länger bestehen wir nicht als wir selbst. «In diesem Sinne», schreibt Miroslav Holub, «währt unser Ich drei Sekunden». Seine Behauptung hat Berührungspunkte mit meiner Ansicht. Aber die Kürze des «bewussten Jetzt» muss meines Erachtens nicht notwendigerweise zu dem Gefühl eines Bewusstseinsbruchs oder der Neuheit beitragen. Unsere Erfahrung kann wie ein dünner Lichtstrahl erscheinen, der weich und beständig umherschweift. Die festgestellte Dauer des «bewussten Jetzt» mag das obere Limit einer unterbrechungsfreien Gedankensequenz sein, aber daraus ist nicht zu folgern, dass innerhalb einer vier Sekunden langen Periode überhaupt eine Zäsur bewusst wahrgenommen wird (dies muss nicht einmal ein einziges Mal an einem Tag passieren). Ebenso wenig meine ich, dass das «Ich» uns nicht auch länger andauernd als dieses «bewusste Jetzt» erscheinen kann, wenn wir darüber nachdenken. Ich gebrauche das Wort «Langzeit-Ich» nur vage, aber mit folgender Grundintention: Selbstverständlich kann es so empfunden werden, dass das «Ich» über einen Zeitabschnitt hinaus besteht, der einen Bruch oder eine Zäsur umfasst, und seine zeitliche Ausdehnung mag in unterschiedlichen gedanklichen Kontexten sehr verschieden sein. (Todesangst wirft da interessante Fragen auf).
9
Manch einer mag Zweifel daran hegen, auf welche Weise ich Bewusstsein erfahre. Diejenigen, die mich nicht gerade anzweifeln, werden mich mit Sicherheit einer kleinen Minderheit zurechnen. Wahrnehmungen wie die meinen mögen als das unnatürliche Resultat philosophischer Betätigung erscheinen oder gar als Folge von Drogenkonsum. Philosophische Überlegungen führen aber nicht dazu, die geistige «Festplatte» durcheinanderzubringen. Philosophie bringt uns nur dazu, die uns angeborene Erfahrungsweise genauer zu betrachten. Erscheint sie uns im alltäglichen Leben ungewöhnlich oder gar unnatürlich, kann sie dennoch ein zutreffendes Bild von den wirklich ablaufenden Prozessen liefern. Umgekehrt lassen schließlich viele naturhafte Erfahrungen die Dinge in einem falschen Licht erscheinen. Viel wichtiger noch: Jeder normale Mensch, der sich mit diesen Themen beschäftigt, kann zu derselben Erkenntnis gelangen.
Menschen können durchaus ein sehr lebhaftes Bewusstsein ihrer selbst haben, ohne zwangsläufig anzunehmen, dass dieses «Selbst» eine Persönlichkeit oder eine Dauer besitzt. Sogar das Verständnis vom «Selbst» als Agens, als Handelndes, als Akteur, kann sich auflösen (in positiver wie in negativer Weise). Verbessern sich dadurch unsere Aussichten für die These, dass ein Bewusstsein vom Selbst die genaue Darstellung von etwas sein könnte, das tatsächlich existiert, selbst unter der Voraussetzung eines wahren Materialismus? Ich denke schon, obwohl eine vollständige Diskussion eine genaue Stellungnahme erfordert, was es heißt, ein wirklicher und wahrhaftiger Materialist zu sein. (Zu Beginn sollte man jedenfalls ganz Realist sein in Bezug auf das Bewusstsein.) Eingehender müsste dann untersucht werden, welches Verständnis wir davon haben, was überhaupt ein Ding oder Objekt ist.
Den besten Beleg für die Existenz des «Selbst» kann man bei einigen Vertretern des Buddhismus finden. Er lässt die Existenz des «Selbst» im Sinne eines Subjekts der Erfahrung, eines Bewusstseinsortes zu jedem gegebenen Zeitpunkt zu, ohne auf die für den Buddhismus wesentliche Kritik an der Idee vom «Selbst» zu verzichten. Diese Auffassung stellt also keine Bestätigung für diejenigen dar, die an eine Seele glauben, lässt uns aber auch nicht mit dem Nichts zurück. Und sie geht andererseits nicht so weit wie die analytische Philosophie, die das «Selbst» als Mythos betrachtet, sofern es als etwas von dem als ein Ganzes betrachteten Menschen Unterschiedenes betrachtet wird. Diese Auffassung bietet uns ein «Selbst», das gleichzeitig materiell solide und unverwechselbar mental ist. Wie kurzlebig auch immer es sein mag – es ist so real wie ein Stein.
Ich denke, ich werde diese Zeilen nicht abschicken, der Geist erscheint als so neuer Ort, letzte Nacht ist für mich überholt.
EMILY DICKINSON
2Ein Irrtum unserer Zeit
1
Für den Psychologen Jerome Bruner ist das «Selbst eine fortwährend von Neuem geschriebene Geschichte». Wir sind ständig damit beschäftigt, eine «selbst-produzierende Erzählung» zu betreiben. «Am Ende werden wir zu den autobiografischen Geschichten, in denen wir ‹über unser Leben erzählen›.» Oliver Sacks stimmt dem zu:
«Jeder von uns hat eine Lebensgeschichte, eine Art innerer Erzählung, deren Gehalt und Kontinuität unser Leben ist. Man könnte sagen, dass jeder von uns eine ‹Geschichte› konstruiert und lebt. Diese Geschichte sind wir selbst, sie ist unsere Identität.»
Vielstimmig klingt die Akzeptanz aus den Reihen der Geistes- und Sozialwissenschaften: Literaturwissenschaften, Psychologie, Anthropologie, Soziologie, Philosophie, Politikwissenschaft, Religionswissenschaft. Ein Echo findet sich auch in der Psychotherapie, in der Medizin, in der Rechtswissenschaft, in Wirtschaft und Design: Im typischen Fall erfahren Menschen ihr Leben als eine Geschichte irgendeiner Art oder zumindest als eine Sammlung von Geschichten.
Ich nenne dies die Psychologische Narrativitätsthese. Sie besteht in einer Behauptung darüber, wie Menschen normalerweise ihr Leben erfahren, zumindest den empirischen Fakten nach. Dies entspreche unserer Natur. Oft erscheint sie in Verbindung mit der Ethischen Narrativitätsthese, wie ich sie bezeichne, die einen normativen, evaluierenden oder ethischen Anspruch hat. Das heißt, ein reicher erzählerischer Ausblick auf das eigene Leben ist unbedingt wünschenswert, denn er ist essenziell, um gut zu leben und eine vollständige Persönlichkeit zu sein.
Diese beiden Thesen führen zu vier möglichen Positionen. Erstens: Man nimmt an, die empirische, psychologische These trifft zu, die ethische nicht. Unser Denken sei also zutiefst narrativ, und dies wird negativ bewertet, wie in Roquentin verkörpert, dem Protagonisten in Sartres Roman Der Ekel. Diese Haltung wird auch den Stoikern zugeschrieben, speziell Mark Aurel.
Zweitens: Die empirische These wird abgelehnt, die ethische These anerkannt, was bedeutet, dass wir nicht von Natur aus narrativ sind, es aber sein sollten, um ein gutes Leben führen zu können. Verschiedene Versionen dieser Haltung findet man bei Plutarch und in einigen Schriften aus heutiger Zeit.
Drittens: Man ist von der Richtigkeit beider Thesen überzeugt. Es liegt in der Natur des Menschen, das Leben als Lebensgeschichte zu betrachten, und es ist darüber hinaus auch notwendig, dies zu tun, um glücklich sein zu können. Diese Ansicht wird von der heutigen Psychologie vertreten, gefolgt von der zweiten Position. Sie lässt der Möglichkeit viel Raum, dass wir sehr davon profitieren würden, narrativer zu sein, als wir es in Wahrheit sind. Und sie stellt in Rechnung, dass wir beim «Schreiben» unserer Lebensgeschichte darüber hinaus auf die eine oder andere Weise falschliegen können.
Viertens und letztens: Beide Thesen sind falsch, was meiner Meinung entspricht. Ich halte es für bedauerlich und sogar schädlich, dass der aktuelle Trend zur dritten Position geht. Ich glaube nicht, dass es nur einen einzigen Weg gibt, wie Menschen ihr Dasein in der Zeit erleben, und erst recht nicht, dass es nur einen guten und richtigen Weg gibt, den es zu beschreiten gilt. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die ihr Leben nicht als zusammenhängende Geschichte erfahren. Genauso wie es unterschiedliche nicht-narrative oder explizit anti-narrative Arten gibt, die eigene Existenz auf Erden gelungen zu gestalten. Vertritt man die zweite oder dritte Ansicht, so beschränkt man das menschliche Selbstverständnis, indem man wichtige Denkmöglichkeiten gar nicht erst zulässt. Ethische Alternativen werden von vornherein ausgeklammert und belasten fälschlicherweise all jene, die nicht ins gängige Modell passen. Im psychotherapeutischen Kontext kann sich dies als hochgradig destruktiv erweisen.