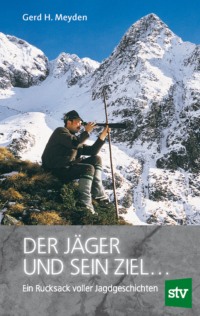Kitabı oku: «Der Jäger und sein Ziel ...», sayfa 2
Welcher Gegenstand macht Sie glücklich?
Kürzlich erzählten im Freitags-Magazin der Süddeutschen Zeitung die Prominenten unserer Tage, welche Gegenstände sie glücklich machen. Da konnte der staunende Leser erfahren, dass ein berühmter Koch sein Nakiri-Messer oder dass Reinhold Messner den Kletterhammer eines lang verblichenen, berühmten Bergsteigers nannte. Das erscheint einigermaßen logisch und nachvollziehbar. Einen anderen Prominenten machte seine Rolex glücklich. Das kann ich in meinem Fall nicht behaupten, denn ich habe die meinige verkauft, weil sie weder Hämmern noch Holzhacken vertrug. Doch wenn jemand eine japanische Kloschüssel, eine Wärmflasche, einen Wecker oder gar einen Rechenschieber dazu erwählt hat, dann muss auch eine besondere Geschichte dahinterstecken.
Meine Wahl braucht kein langes Überlegen: Da hängt sie am schmiedeeisernen Haken und scheint mich aufzufordern: „Auf, auf, schlupf rein! Geh’ mer zum Jagern!“ Sie haben es sicher erraten: Es ist nichts anderes als eine alte Lodenjoppe.
Auf den meisten Jagden war sie meine Wohnung, mein Begleiter. Selbst bei meinen Jagdreisen in die Mongolei war sie ein Stück Heimat. Der Schnitt, ohne Revers und Umschlag-Kragen, mit der geraden, hochgeschlossenen Knopfleiste, entspricht zufällig dem der Ostasiaten. Nehru, Mao, um nur ein paar Prominente zu nennen, trugen Jacken in diesem schlichten Schnitt. Nur hatten deren Jacken keine bequeme Rücken-Quetschfalte mit den aufapplizierten Seerosenblättern der Tegernseer Meister, und vor allem fehlten ihnen die Hirschhornknöpfe.
Als das heißgeliebte Kleidungsstück nach Jahren auseinanderzufallen drohte, hat ihr ein Schneidermeister in unserem Dorf, der alte Dinge noch zu schätzen wusste, ein neues Leben geschenkt. Zuvor wollte ich das heute 53 Jahre alte Stück reinigen lassen. Doch die Firma schickte mein Lieblingsstück unbehandelt retour, mit dem Vermerk, es würde hernach nicht mehr zu gebrauchen sein. Die Ärmelabschlüsse, Kragen, Knopflöcher, die Einfassung der Schubtaschen, alles war total abgewetzt und wurde nun vom dörflichen Meister mit weichem Rehleder eingefasst. Die rechte Schulter war vom Büchsriemen fast gänzlich durchgescheuert. Nun habe ich ein rehledernes Schulterstück darauf. Wie passend! Ein wollenes, neues Karofutter macht die abgeschabte Lodenjoppe wieder zur kuscheligen Heimat. Der Schneider schnitt mit Kennerschaft das seinerzeit aufs alte Innenfutter gestickte Monogramm mit Jahreszahl der Anfertigung aus und nähte es im neuen Futter wieder ein. Die abgewetzten Ellbogen bekamen Lederherzerln drauf, und auch die Löcher, die einst ein junger Schweißhund hineingenagt hatte, wurden mit gleichartigem Stoff geflickt. Der kleine Hund wollte zu den Belohnungsbrocken in der Tasche gelangen. Er schaffte es sogar.
Ein Freund hatte mir damals, als ich dessen Joppe bewunderte, zu einem renommierten Schneider am Tegernsee geraten. Doch seinerzeit war jener Meister dermaßen mit Aufträgen ausgelastet, dass ich über eineinhalb Jahre hätte warten müssen. Da er der Haus- und Hofschneider der Wittelsbacher war, also sozusagen königlich-bayerischer Lieferant, drängten sich zu viele „Gernegrafen“ danach, ebenfalls ein so „geadeltes“ G’wand zu besitzen.
So kam ich zum gleichfalls am Tegernsee beheimateten „Eisenburg Bene“. Hier dauerte die Maßanfertigung nur ein paar Wochen, und zwischen Kunde und Meister entstand bald ein kleines Freundschaftsverhältnis. Ungezählte Hosen, Joppen und Janker fertigte er im Laufe der Jahre auf seinem Schneidertisch – da saß er tatsächlich mit gekreuzten Haxen drauf – für meinen Luxuskörper. Doch mit besagter Lieblingsjoppe gab es ein kleines Anfangsproblem.
Nachdem der Bene meine Maße genommen hatte, wählte ich dürrlaubfarbenen Lodenstoff, tannengrünes Passepoil, kariertes Wollfutter, besonders schöne Hirschhornknöpfe und besprach mit ihm meine Sonderwünsche. Dabei hat er, der ein guter Beobachter war, mich als Linkshänder erkannt. So platzierte er die Patronentasche, wo man fünf Stück zum schnellen Zugriff hineinsteckt, auf die rechte Brustseite. Er dachte, dass ein Linkshänder auch ein Linksschütze sein müsse. Der muss, um schnell seine Kipplaufbüchse nachladen zu können, mit der linken Hand aus der rechten Brusttasche eine Patrone greifen können.
Weil ich jedoch ein Rechtsschütze bin, ließ die Folge dieses Irrtums nicht lange auf sich warten. Stolz, neu gewandet, war ich beim Kahlwildjagern. Ich schoss ein Kalb. Es brach im Feuer zusammen, während das Stuck, irritiert durch das Schussecho, noch kurzzeitig verhoffte. Schnell nachladen, bevor es abspringt! Mit der Rechten griff ich nach links, um eine neue Patrone aus der Brusttasche herauszuziehen. Doch da war keine Tasche! Bis ich merkte, dass nun die Patronen rechts stecken, waren nur ein, zwei Sekunden verstrichen. Die genügten, um dem Stuck Klarheit zu verschaffen und abzuspringen. Verflixt nochmal! Da hatte der gute Bene die Tasche an der falschen Körperseite angebracht. Im guten Glauben, das sei dem Bewegungsablauf eines Linkshänders angepasst.
Als ich ihm die Joppe wieder brachte, um die andere Brustseite ebenfalls mit einer Tasche zu versehen, staunte der Meister. Er hätte etliche Kunden, die Linkshänder seien, sagte er, doch würden diese auch brav links anschlagen und schnell mit der linken Hand zur rechten Patronentasche finden. Dumm gelaufen!
Die Belohnung für den Seitenwechsel der Patronentasche bekam ich im Herbst desselben Jahres. Auf der Drückjagd meines Freundes Helmut Wölfel im Pfälzer Wald schoss ich mit meiner Kipplaufbüchse aus einer Rotte Sauen vier Frischlinge heraus. Nach jedem Schuss die Büchse mit der rechten Hand aufgeklappt, der Ejektor warf die leere Hülse aus, in derselben Sekunde holte die Rechte aus der linken Brusttasche eine neue Patrone, schob sie in den Lauf, zugeklappt, und schon war ich wieder feuerbereit. Mein Nachbarschütze, der mir zugeschaut hatte, stellte nach dem Trieb verwundert fest, dass ich mit meiner Kipplaufbüchse so schnell wie mit einem Repetierer geschossen hätte.
Neben dieser fast nebensächlichen Eigenschaft der Jagdjoppe sind es zu ihrer Funktionalität die ungezählten gemeinsamen Erlebnisse. Stunden, Tage, Wochen im Berg und im Wald; bei Regen, Schnee und Sonnenschein, stets waren wir beisammen. Sie wärmt in ihren weich gefütterten Mufftaschen meine Hände und beherbergt in ihren vielen Außen- und Innentaschen die kleinen, notwendigen Dinge griffbereit für den Jäger.
Weil ich gerade die vielen Taschen erwähne, fällt mir eine kleine Geschichte ein, die zwar nicht im direkten Zusammenhang mit der Jagd steht, aber dennoch ihren Ursprung auf einer Jagd hat, bei der meine Mutter mich begleitete. Unter einem alten Kastanienbaum machten wir Rast. Dabei hob sie eine der zu Boden gefallenen, frisch und glänzend aus der Schale geplatzten Kastanien auf.
„Da“, sagte sie schmunzelnd, „steck sie in Tasche, das ist gut gegen Rheuma! Als Jäger bist du ja gefährdet.“
Selber glaubte sie zwar auch nicht so recht an den alten Aberglauben – aber man kann ja nie wissen. So steckte ich die glatte braune Kugel in eine Tasche der Joppe und – vergaß sie. Nach vielen Jahren, meine Mutter lebte längst nicht mehr, drückte mich etwas im Futter der Jacke. Irgendwas war irgendwann durch ein winziges Loch in der Tasche in den unteren Saum des Innenfutters geschlupft. Durch einen kleinen Trennschnitt herausgeholt, hielt ich die lang vergessene Kastanie in der Hand. Gleich wieder war mir die Szene unter dem alten Baum gegenwärtig. Die Kastanie nun einfach wegzuwerfen, brachte ich nicht übers Herz. Stattdessen steckte ich sie in einer Ecke des heimischen Gartens in die Erde – und vergaß sie abermals. Eines Tages, es mochten vielleicht zwei, drei Jahre vergangen sein, entdeckte ich dort einen kleinen Kastanienschössling. Er war bereits einen halben Meter hoch gewachsen. Wieder stand mir die Erinnerung an meine Mutter und die Rheumavorsorge vor Augen. Inzwischen ist daraus ein stattlicher Baum mit einem Stammdurchmesser von gut dreißig Zentimetern geworden, der nun selber Früchte trägt. Und ganz nebenbei – Rheuma habe ich immer noch nicht.
Das Glück unzähliger Erlebnisse ist so sehr mit der alten Joppe verknüpft, und wenn ich in sie hineinschlupfe, wird’s mir nicht nur von außen warm. Kurz gesagt, sie ist der greifbare Inbegriff glücklicher Jagdtage.
Ich weiß, lieber Leser, auch Sie sind nicht der jedem Besitz abholde Asket. Sie haben genau wie ich einen glücklich machenden Gegenstand. Es muss ja nicht unbedingt eine japanische Kloschüssel oder gar ein Rechenschieber sein.
Eine unrühmliche Geschichte oder Was zu viel ist, geht zu weit
Es war in der Zeit, als Ungarn sich der Unfreiheit unter dem Kommunismus beugen musste. Ein lieber ungarischer Freund, Géza Graf Adorjányi, der 1945 als adeliger, enteigneter Großgrundbesitzer vor den, wie er sagte, „Blutsäugäärrn“ hatte fliehen müssen, machte mit seinen bunten Erzählungen meine Frau und mich auf das Land seiner Väter neugierig.
Während des blutigen Ungarn-Aufstands 1956 hatte ich über alle Maßen Anteil an den Geschicken des tapferen Volks genommen. Wohl weil meine eigene Familie vor den Schikanen der deutschen Kommunisten noch in letzter Minute hatte fliehen können. Daher ging mir das Märtyrerschicksal der Helden des Aufstands, wie des Imre Nagy und Pál Maléter, sehr nahe. Ich musste mich ein wenig überwinden, in den finsteren Machtbereich der Sowjets zurückzukehren.
Freund Géza empfahl uns schwärmerisch eine Rehbockjagd mit der Pferdekutsche in den Weiten der pannonischen Ebene und einen anschließenden Besuch Budapests, auch „Paris des Ostens“ genannt. Ein wenig wehmütig schwärmte er, dass es seinerzeit dort „herrliche Püffe“ gegeben habe. Das war aber nicht unser erklärtes Reiseziel. In für uns weitaus verlockenderen Farben beschrieb er die Pirsch mit der Kutsche, die starken Trophäen, die man erbeuten könne und vor allem müsste der krönende Abschluss ein Wochenende in Budapest sein. Wir sollten unbedingt auf der Margareteninsel wohnen, der „Márgit-Sziget“. Ein Abendessen im Matthiaskeller („Mátiás Pince“) sei obligatorisch. Dort würde sein alter Freund, der Zigeunerprimas Sándor Lákátos mit seiner Banda spielen. Als Gruß aus der Freiheit drückte er mir einen Fünfzigmarkschein in die Hand, den ich dort, wie’s Tradition sei, dem Primas in den Fiedelbogen klemmen sollte. „Mit vielen Grüßen von Géza Graf von Adorjányi.“
Voller Vorfreude buchten wir bei einem Jagdreisenanbieter eine Rehbockjagd sowie übers Reisebüro die Flüge und zum Wochenende ein Zimmer im Grand Hotel auf der Margareteninsel.
Ein wenig bedrückend war die Passkontrolle bei unserer Ankunft im Flughafen. Finster blickende Männer in schwarzen Ledermänteln beschäftigten sich verdächtig lange mit meinem Reisepass. Lag doch mein Geburtsort Königsberg im damaligen Sowjetreich. Wortlos verschwanden sie mit dem Dokument in ihrem Büro. Banges Warten. Aber bald durften wir einreisen; der Verdacht, ich sei ein Republik-Flüchtling aus dem „Arbeiter- und Bauernparadies“ DDR erwies sich als grundlos. Doch eine gewisse Beklemmung – wie ein Grundrauschen – konnte ich nicht abschütteln. Die eiskalte Luft des Ostblocks.
In der Ankunftshalle wurden wir von einem Fahrer des Jagdvermittlers erwartet. Ich holte die Reisebestätigung hervor und versuchte, ihm den Namen des Zielorts vorzulesen, es klang wie „Hodmeszöwasarhelikutasipusztaszarvasicsikoshalott“. Der Mann lachte nur und sagte: „Jo, ich weiß, nach Ligeti-Puszta!“
Nach zweistündiger Reise setzte er uns am Jagdhaus mit dem langen und dem kurzen Namen ab. Der Empfang durch das Jagd- und Hauspersonal war herzlich und so voll warmer Freundlichkeit, dass wir uns bei diesen Menschen und in dem gemütlichen Haus schnell sehr wohl fühlten. Ein mit Schilfrohr gedecktes Dach breitete sich über das einstöckige, weiß getünchte Gebäude. Es erinnerte mich an Bilder, die ich in Jagdbüchern von Ungarn- und Karpatenjägern gesehen hatte. Ein kleiner Hain von Akazien und Pappeln umgab das Anwesen, das mitten in den unendlich weiten, baumlosen Feldern lag.
Schon früh an diesem Maienabend begannen überall die Nachtigallen zu singen. Leider konnten wir dem Gesang nicht die ganze Nacht lauschen, denn wir sollten die Zimmerfenster geschlossen halten. Es gäbe hier, wie man sagte, viele „Gälsöön“, also Mücken. Da hatten wir wieder die „Blutsäugäär“. Doch die waren im Gegensatz zu den eingangs erwähnten wesentlich harmloser.
Unsere Vorfreude auf eine Kutschfahrt durch die Ebene wurde bitter enttäuscht. Keine „schnaubenden Rosse“ erwarteten uns, sondern ein rostiger Russen-Kleintransporter stand ratternd und dieselqualmend vor dem Haus. Der Berufsjäger István erklärte uns, dass die Rehe in den weiten Getreidefeldern stünden. Zu Fuß käme man bei der fehlenden Deckung gar nicht an sie heran. Auch könnte man vom Boden aus wegen des flachen Winkels wenn überhaupt, dann vielleicht gerade nur das Haupt eines Bockes sehen. An einen Schuss wäre da nicht zu denken. Nur von erhöhter Position aus wäre das möglich. Im Klartext hieß das, entweder vom Kutschbock aus – was wohl ein Märchen aus lang vergangenen Tagen war – oder aus dem Auto. Damit man während der Fahrt schießen konnte, hatte man den hinteren Teil des Daches wie eine Sardinendose aufgeschnitten. Von so hoher Warte aus sind Sicht und Schussposition optimal. Auf andere Weise könnte man in diesem Gelände wohl kaum einen Bock erlegen. Doch Autojagd ist überhaupt nicht mein Ding und war auch nie meine Art zu jagen. Vom Kutschbock aus, wo die Silhouette des Jägers erkennbar ist und dadurch dem Wild noch eine kleine Chance zur Flucht bleibt, das war mir akzeptabel erschienen. Aber aus dem als harmlos erachteten Fahrzeug heraus? In dem der Mensch, der Feind, nicht erkennbar ist? Wie ein Panzerfahrer aus der Luke das Feuer eröffnen? Worauf hatte ich mich da eingelassen? Jetzt aber war es zu spät, diese Art von Jagd abzubrechen. Wir rollten los.
Das Getreide stand in jenem Jahr – es ging auf Ende Mai zu und es hatte im Frühjahr viel geregnet – schon ziemlich hoch, sodass es schwer war, überhaupt Wild in Anblick zu bekommen. Nach vielen Kilometern Fahrt hatten wir immer noch nichts gesehen. Da hupte der Fahrer laut und weithin vernehmlich. Sogleich schnellten aus dem Korn ein paar Häupter hoch. Aha, also so geht das hier! Bis zum Träger waren die Rehe aber im Grün verdeckt. Ich konnte mich nur an den teilweise sehr starken Gehörnen erfreuen und staunte, was hier alles so wächst. Ein Schuss, meist auf über 200 bis 300 Meter auf ein so kleines Ziel wie den Träger, gerade einmal handflächengroß, noch dazu mit einem fremden Gewehr – kein Gedanke. So ging unsere Pirschfahrt ergebnislos über zwei Tage. Frühmorgens los, Mittagspause, dann am Nachmittag dasselbe Spiel. Es war ohne jede Romantik, ohne jede Stimmung, ohne Reiz. István war todunglücklich, dass es bei all seinen Anstrengungen nicht klappen wollte.
Trotz allem Zureden blieb ich bei meinem Vorsatz, nicht aus dem Auto heraus zu schießen. Wie ein Schädlingsbekämpfer so kunstlos einen Bock zu erlegen, das war und ist für mich nicht Jagd, sondern nur Abschießen und ähnelt verteufelt einem Killerkommando. So schlug ich dem braven Istvàn vor, dass ich es vom Boden aus, auf einer Gasse zwischen den Getreidefeldern versuchen wollte. Da, wo wir auf der „Gummipirsch“ vorbeigekommen waren, gab es mehrere Stellen, wo vier Felder am Kreuzungspunkt aneinanderstießen. Dort hätte ich, so sagte ich dem Jäger, Ausblick auf vier etwa drei Meter breite Schneisen. Wie auch immer der Wind gehen würde, einige von ihnen würden frei von meiner Witterung bleiben. Das Korn war ja schon recht hoch, sodass ich, am Boden hockend, mit einigen Zweigen getarnt, relativ unentdeckt bleiben könnte.
Istvàn kratzte sich am Kopf: „Aber die Gälsöön!“
Das, sagte ich, wäre mein Risiko. Und außerdem hätte ich ein ganz vorzügliches Mückenmittel. Nachdem er merkte, dass mit mir sonst nichts zu machen war, stimmte er zu.
Noch war’s dunkle Nacht, als er mich an einer Kreuzung im Getreidemeer absetzte. Getarnt durch ein paar belaubte Akazienzweige hockte ich mich mit einem Zielstock ein wenig in den Rand eines Weizenfeldes. Sofort war ich in eine Wolke blutgieriger Gelsen gehüllt. Doch gut und reichlich eingesprüht wie ich war, mussten sie mich ohnmächtig umschwirren.
Der nachtgraue Osthimmel begann allmählich rosig zu erglühen, die Farben des Tages erwachten. Die ersten Lerchen begrüßten jubilierend den jungen Morgen. Ein Fasanenhahn nach dem anderen marschierte mit „gook-gock“ und Flattersprüngen auf dem grasbewachsenen Weg. Hasen hoppelten um mich herum, und die Wachteln schlugen im Korn. Von fern das Locken eines Rebhahns. Sonst kein anderer Laut außer dem stechendfeinen Sirren der Gelsen um mein edles Haupt. Das war die Grundmelodie der nächsten Stunden. Auf der Autopirsch gehen die Stimmen der Natur im Motorengeratter verloren.
Wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich eine Geiß auf der rechten Schneise. Sie naschte links und rechts des Weges an den verschiedenen Kräutlein und zog zum Glück langsam von mir weg.
Meine Rechnung schien aufzugehen. Die Rehe konnten doch in der Getreidemonokultur niemals genug Äsung finden. Sie mussten ja irgendwann auf einen der Wege ziehen. Zumal hier begrünte Raine mit vielerlei Äsung lockten.
Unvermittelt stand auf der gleichen Schneise noch ein Reh. Ein Bock. Da brauchte ich kein Glas. Bereits vollkommen verfärbt, prahlte er mit enorm hohem Sechsergehörn auf seinem jugendlichen Haupt. Na also. Wo ein Bock kommt, da kommen auch andere. Jedoch der Morgen verging ohne weiteren Anblick.
Nach diesem Anfangserfolg wollte ich mich hier am Abend abermals ansetzen. Istvàn jedoch riet zu einem anderen Kreuzungspunkt. Er meinte, dass meine Witterung noch zu sehr am Boden stünde. Da er seine Böcke besser kennt, sagte ich gern zu und saß am Abend an einem anderen Viererstern.
Wieder die bunten Gockel, wieder Hasen über Hasen. Hier musste ja bei den Herbstjagden ganz schön was los sein. Die Sonne war in meinem Rücken längst untergegangen, die Mücken wurden nun bei einfallender Dunkelheit immer aggressiver. Da stand, diesmal recht weit entfernt, auf dem linken Weg ein Bock. Im Wildbret ein starker Bock. Der hatte eine ganz andere Figur als der Jüngling vom Morgen. Auf jeden Fall war der alt. Es war bereits recht finster, sodass ich nicht mehr recht erkennen konnte, was er aufhatte. Verzweifelt suchte ich mit dem trüben Zielfernrohr das Abkommen. Verdammtes Gependel mit dem Zielstock. Endlich, als ich glaubte, wieder ins Ziel hineingewackelt zu sein, krachte der Schuss. Vom Mündungsblitz überblendet, sah ich den Bock gerade noch nach rechts wegtauchen. Vorerst half nur eins, sitzenbleiben und warten. Meine Beine waren eingeschlafen. Ich bin halt kein Yogi. Also aufstehen und die Blutzirkulation wieder in Gang bringen. Nach zehn Minuten hörte ich Motorengebrumm, und bald sah ich den Lichtschein unserer Knatterkiste.
Istvàn hatte den Schuss gehört. Neugierig kam er heran: „Räbock halott - tott?“
Zu Fuß gingen wir zum Anschuss. Der Hund des Jägers fiel sofort die Wundfährte an. Nach ein paar Metern hörten wir ihn knurrend den Bock beuteln. Der war nicht mehr weit gekommen. Im Schein der Taschenlampe konnte ich mir nun endlich das Gwichtl anschauen. Noch selten habe ich, ohne ganz genau zu wissen, was hernach daliegen wird, geschossen. Aber hier, nur nach der Figur angesprochen, bestätigte sich, dass ich mich nicht verschätzt hatte. Mein tastender Finger glitt im Unterkiefer über eine total glatt heruntergekaute Zahnreihe.
Ein uralter Spießer war’s, mit nur knapp luserhohen, aber starken, enorm gut geperlten Stangen. Wie Stachelgewächse ragten sie über sein Greisenhäuptl.
Der Jäger schaute mich fragend an. Er dachte wohl, ich sei enttäuscht, weil es kein Medaillenbock war.
„Wunderbar, Istvàn, das ist genau das, was mir Freude macht. Solch ein Bock ist seltener als die üblichen Sechser, so stark sie auch sein mögen.“
Jetzt war der Jäger erleichtert, und nun freute er sich auch mit mir.
Es wurde noch ein stimmungsvoller Abend mit unseren Gastgebern im Jagdhaus. Bei Nachtigallengesang und Mondschein wäre es draußen sicher weit romantischer gewesen, doch das Gesirre der „Blutsäugäär“ wäre nicht zu ertragen gewesen.
Am Morgen, bevor der Fahrer des Jagdbüros uns abholen kam, überreichte mir Istvàn das bereits sauber hergerichtete Gwichtl des alten Bocks. Eine seltene Trophäe als Lohn für meine „Bodenjagd“.
Nach einem herzlichen Abschied von unseren lieben Jägersleuten trafen wir am späten Vormittag in unserem Hotel in Budapest ein. Ein kleiner Bummel durch die Stadt wurde gemacht, und bevor der Abend im Matthiaskeller heranrückte, wollten wir noch einigen von Géza empfohlenen Programmpunkten folgen.
Zuerst zog es uns zum Hüvösvölgy. Dieser Ausflugsort liegt auf den sich jenseits der Donau auf etwa 160 Meter erhebenden Hügeln. Mit einer von Kindern und jugendlichen Pionieren bedienten Kleinbahn gelangten wir nach einer romantischen Fahrt durch Laubwald im frischen Maigrün zu einer Ausflugsgaststätte. Wie in einer Biedermeier-Szene luden gedeckte Tische unter Schatten spendenden Kastanien zum Verweilen bei Speis und Trank. Einer der Tische erschien uns noch frei, und so ließen wir uns nieder. Nach einiger Zeit stellte sich mit fragender Miene ein Mann vor unseren Tisch, wie ich glaubte, der Ober. Da wir Wein trinken wollten, brachte ich aus meinem „ungeheuren“ ungarischen Wortschatz – es sind nur ein Dutzend Worte – an den Mann: „Bor szivesen! Wein bitte!“ Der Mensch schaute uns nur verdutzt an und setzte sich wortlos an unseren Tisch. Nach mühevollem Radebrechen mit Händen und Füßen stellte sich heraus, dass er – ebenfalls ein Gast – nur kurz seinen Platz verlassen hatte, um am Buffet etwas zu bestellen. Zudem war er Russe. Nun kramte ich aus meiner „profunden Halbbildung“ noch meine russischen Rest-Vokabeln hervor und das Gelächter über meinen Irrtum war beiderseits. Den Wein musste ich selber beim Buffet abholen, es war, wie man noch sehen wird, das Getränk des Tages beziehungsweise des Abends: „Balatonfüredi rizling“.
Es war ein heißer Tag, der Wein schmeckte gut, und so blieb es nicht bei der einen Flasche, wobei uns der Russe tapfer mithalf.
Froh beschwingt ging es nach dem Mittagessen zu einer der berühmtesten Konditoreien Europas, dem Café Gerbeaud. Dort, so hatte uns Géza ans Herz gelegt, war es obligatorisch, die legendäre Dobostorte zu genießen. Es war wirklich ein Erlebnis.
Abends brachte uns der Chauffeur mit der hoteleigenen, russischen Luxuslimousine noch auf die Fischerbastei hoch über dem Stadtteil Pest. Der Anblick des abendlich erleuchteten Budapest, der Parlamentsgebäude vor der majestätisch dahinströmenden Donau, die hier schon so viel gesehen hatte, war wirklich eine Reise wert. Wir mussten uns fast gewaltsam von diesem Anblick losreißen. Doch der Fahrer mahnte, unser Tisch im Matthiaskeller sei für 20 Uhr reserviert. Und heute Abend würde Sándor Lákátos spielen. Das durften wir keinesfalls versäumen.
Eine Treppe führte uns hinab in das riesige Kellergewölbe. Alle Tische waren voll besetzt. Im Hintergrund hörten wir schon die Zigeuner fiedeln und die ersehnten Cymbalklänge. Sofort stand ein Ober an unserem Tisch – diesmal war’s wirklich ein Ober. Seine Frage „Aperitif?“ sollten wir auf Anraten von Freund Géza mit „nein danke“ beantworten, denn was dann käme, würde einem die Füße wegziehen. Also sagten wir brav „nein danke!“ Kurz darauf stellte uns die Bedienung aber trotzdem den Aperitif auf den Tisch. Ein Wasserglas randvoll mit Schnaps. Barack oder Kirsch, ich weiß es nicht mehr. Brav schoben wir ihn beiseite. Zum Essen bestellten wir als Getränk natürlich „Balatonfüredi rizling“. An den Nebentischen prunkten viele russische Uniformen. Gesprächsfetzen in deutscher und russischer Sprache übertönten die Zigeunerklänge. Wir waren umgeben von kommunistischen „Genossen“. Das ungute Ostblock-Gefühl, das mich schon bei der Einreise wie ein böser Alb bedrückt hatte, war wieder präsent. Ich kippte den Aperitif hinunter.
Während des Essens kam die Kapelle, die an jedem Tisch ein wenig verweilte, immer näher, um die jeweiligen Musikwünsche zu erfüllen. Bald standen die Zsigans in ihren prächtigen Kostümen ein paar Tische weiter bei einer Gruppe von offenbar hohen kommunistischen Figuren. Ordengepanzerte, blechverklebte Brüste der Russen, servil lachende, sächselnde Zivilisten.
Und dann zogen sie weiter, an unseren Tisch. Mit einer Verbeugung fragte der Primás „Was wollen hören, bittä?“ Ich stand auf, holte den Fünfzigmarkschein hervor, klemmte ihn Sándor Lákátos in den Fiedelbogen: „Einen schönen Gruß von Graf Géza von Adorjányi!“
Ein Aufschrei! „Joi, Géza, meiner bester, alter Freund, joi, welcher Freudä!“ Er fiel mir um den Hals, busselte mich auf beide Backen.
Die Banda blieb nun bei uns, spielte ein Stück nach dem anderen. Natürlich auch jeden Schmachtfetzen wie „Die Lerche“ und „Szomorú vasárnap“ – den „Traurigen Sonntag“. Sie blieben und blieben, spielten und spielten – nur für uns. Die Sachsen und die Russen an den Nebentischen winkten und riefen, doch die Zigeuner standen wie gemauert. Uns wurde es langsam unheimlich. Die Leute tuschelten, deuteten auf uns und sicher wurde vermutet, wir seien ganz geheime Promis. In einer Musik- und Atempause fragte ich den Ober, wo man denn sonst noch Zigeunermusik hören könne – möglichst in einem Lokal, wo nur Einheimische seien und die Zigeuner ohne Kostümierung? Er riet uns zum „Fröhlichen Matrosen“ („Víg mátros“), einem Lokal am Hafen.
Beim Verlassen des Kellers begleiteten uns unsere neu gewonnenen Musikantenfreunde mit schwungvollen Czardasklängen noch bis zur steil nach oben führenden Treppe. Bei jedem Schritt in die Höhe, bei jedem Atemzug der frischen Nachtluft verlieh mir der Ungarwein die gerade besungenen Flügel einer Lerche. In ein bereits wartendes Taxi verfrachtet, brausten wir los zum „Fröhlichen Matrosen“.
Auch hier ging es in einen Keller hinab. Auch hier waren alle Tische besetzt, doch irgendein Mensch mit Übersicht – war es meine Frau oder der Ober – hatte zwei Plätze reservieren lassen. Die Zigeuner, diesmal ganz normal gekleidet, spielten, und ich war selig. Hier war kein Russe zu sehen.
Meine Bestellung konnte ich nun schon recht flott loswerden. „Balatonfüredi rizling!“ Ich weiß nicht mehr, ob mich nach der ersten oder zweiten Flasche das Bedürfnis überkam, den lieben Ungarn etwas Schönes zuzurufen.
Die Frau eines guten Jagdfreundes, die aus Siebenbürgen stammte, hatte mir viel von der Ungarischen Revolution erzählt. Der damalige historische Schlachtruf „Éljen a Magyar szabadság! – Es lebe die ungarische Freiheit!“ erschien mir gerade recht, um den Menschen hier eine Freude zu bereiten. Also stand ich auf, hielt mich schon ein wenig schwankend am Tisch fest, reckte die rechte Faust in die Höhe und rief in die Menge: „Éljen a Magyar szabadság!“
Erschrockenes Schweigen! Eisige Stille! Keine Hochrufe! Sofort sprangen vom Nebentisch zwei junge Männer auf, packten mich unter den Armen. „Schnell, Herr! Zahlen Sie! Sie müssen sofort hier weg! Schnell, schnell!“
Meine Frau schaltete fixer als ich, warf ein paar Scheine auf den Tisch, und schon schleppten mich die Männer die Treppe hoch, warfen mich förmlich in ein bereits wartendes Taxi und wir brausten los.
Was war da geschehen? Ich besäuselter Narr hatte mit diesem Schlachtruf erneut zur Revolution aufgerufen. Die beiden jungen Männer waren Angestellte unseres Hotels, hatten uns gleich erkannt und gerettet. Ja, wahrhaftig gerettet. Denn, so sagten sie, wenn jemand die Geheimpolizei informiert hätte, dann wäre ich oder wir beide ganz sicher verhaftet und eingesperrt worden. Und wer weiß, ob da nicht irgendwelche Spitzel im Lokal waren.
Unsere Retter meinten, dass wir nach diesem Schrecken zur Abkühlung noch einen Ausflug auf die Burg machen sollten. Die Sonne würde bald aufgehen und den jungen Tag von der Höhe aus zu begrüßen – das wäre doch ein schöner Abschluss.
Droben auf der Burg war zum Glück das Lokal längst geschlossen, sodass wir den Sonnenaufgang nun wirklich im Freien und in Freiheit erleben konnten.
Endlich waren wir dann wieder im Hotel und begaben uns auf unser Zimmer. Dort lag eine Liste mit den verschiedenen Vorschlägen fürs Frühstück. Das Lesen wollte mir nicht mehr so recht gelingen, ich sah alles doppelt und verschwommen. Also kreuzte ich einfachheitshalber sämtliche Gerichte an und legte den Zettel vors Zimmer. Da wir beide merkten, dass wir viel zu viel Alkohol im Blut hatten (bei mir war eher viel zu wenig Blut im Alkohol), legten wir uns in die riesige Badewanne, und zwar ins eiskalte Wasser – ein Trick, den meine Frau weiß der Teufel woher hatte. Bald schlotterten wir wie „nackerte Schullehrer“, doch der Höhenrauch wollte nicht weichen. Der Trick taugte wohl auch nichts. Also ab in die Heia.
Nach nur wenigen Stunden Schlaf wurden wir vom Zimmerservice geweckt. Die Türe öffnete sich und herein rollte ein Servierwagen, noch einer und noch einer. Jeder war übervoll bestückt: Rührei mit Schinken, Omelette mit Schinken, knusprig gebratener Speck, Croissants, Semmeln, aufgeschnittenes Brot, Butter, Honig, Marmeladen, Käse, Aufschnitt, Müsli, Orangensaft, Grapefruitsaft, Milch, Kakao, Kaffee, Tee – halt die ganze Palette eines üppigen Buffets.
Verwundert schauten sich die Service-Damen um. Sie sahen aber nur zwei Personen. Oder bewunderten sie uns ob des großen Appetits?
Kein Wunder, dass mein Hunger nicht im Entferntesten der Frühstücksmenge entsprach. Im Gegenteil, es war mir gar nicht so recht wohl. Mir war kreuzelend zumute. Ich wünschte, ich wäre nie geboren. Doch wem passiert das schon. Kaum einem unter Millionen. Zum Glück hatte sich meine Frau mit dem Trinken mehr zurückgehalten. Auch war sie erstaunlicherweise trinkfester als ich.