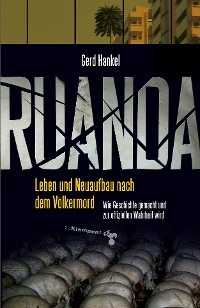Kitabı oku: «Ruanda», sayfa 10
1.1 Das Selbstverständnis der neuen ruandischen Politik und die Frage nach seiner Berechtigung
Mit der Eroberung Ruandas durch die APR/FPR war der Völkermord beendet. Das lässt sich schwerlich bestreiten. Wäre die Armee der FPR langsamer vorgerückt, wären noch mehr Menschen, in erster Linie Tutsi, getötet worden. Ebenso wenig lässt sich bestreiten, dass die ruandischen Tutsi bis dahin schon auf eine lange Geschichte der Verfolgung zurückblicken mussten. Sie begann 1959, als Hutu die sogenannte »soziale Revolution« ausriefen, und setzte sich nach der 1962 erreichten Unabhängigkeit des Landes fort. Nicht immer war sie gleichermaßen intensiv. Phasen massiver Verfolgung und systematischer Massaker, die eigentlich Pogrome waren, wechselten ab mit Phasen relativer Ruhe und beginnender sozialer Integration. Zuletzt, unter dem Staatspräsidenten Juvénal Habyarimana, überwogen deutlich Versuche einer Verständigung und friedlichen Koexistenz. Doch bei vielen Tutsi blieb ein Grundgefühl der Unsicherheit: In der Vergangenheit war es zu Verfolgungen gekommen und was geschehen war, konnte sich wiederholen. Und dass dieses Gefühl nicht trog, zeigte sich wieder und mit zunehmender Häufigkeit ab 1990, nachdem der Krieg begonnen hatte.
Tutsi als Opfer, Hutu als Täter, so stellt sich nach offizieller ruandischer Ansicht das Bild der jüngeren eigenen Geschichte dar. Nach Jahrhunderten friedlichen Zusammenlebens zwischen Hutu und Tutsi hatten die Kolonialherren sukzessive das soziale Gefüge zerstört, indem sie mit rassistischem Vorverständnis die Bevölkerung Ruandas aufteilten in rassisch Über- und Unterlegene, in Herrscher und Beherrschte, in Herren und Knechte. In einem Zustand der Unschuld seien die Ruander von ausländischen Mächten missbraucht worden und sehr viele von ihnen hätten schließlich, unter dem Einfluss verantwortungsloser Politiker, diesen Missbrauch nicht mehr als solchen erkennen können. Sie hätten sich für dunkle Zwecke instrumentalisieren lassen. In den Worten eines Kommentators der New Times: »Verfälscht durch künstliche Unterschiede, die über sieben Jahrzehnte kolonialer Herrschaft geschaffen worden waren, dazu eine institutionalisierte Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung und kein wirklicher Plan für den Fortschritt des ruandischen Volkes, war der 1. Juli 1962 (Tag der Unabhängigkeit Ruandas, G. H.) nicht so vielversprechend, wie er sein sollte.«32 Denn, so der Kommentator weiter: »Die Führer Ruandas vor 1994 weigerten sich anzuerkennen, dass Ruanda ein Land für alle Ruander ist; sie sahen es lieber als ein Land für einen Teil der Bevölkerung, dessen anderer Teil auf den Status von Fremden im eigenen Land reduziert wurde und der deshalb alles, was ihm widerfuhr, auch verdiente, auch Deportation, Verfolgung und Exil.«33
Vergleichbare Beiträge fanden sich bereits vor den Wahlen in vielen Ausgaben regierungsnaher Zeitungen. Nach den Wahlen gab es keine, in der nicht der Frieden des vorkolonialen Zusammenlebens, dessen Zerstörung durch die koloniale Herrschaft und durch deren Vermächtnis thematisiert worden wären – und in der die Thematisierung der Vergangenheit nicht selbstredend die Funktion gehabt hätte, das nach 1994 Erreichte in umso helleren Farben zeichnen zu können. Und wie die Presse, so auch der Rundfunk. Mehrmals täglich gab es Sendungen, in denen vergangenes Elend einer vielversprechenden Gegenwart und strahlenden Zukunft gegenübergestellt wurde. War das nur mehr oder weniger geschickte und darum auch im Ausland Anklang findende Regierungspropaganda? Oder traf es zu beziehungsweise hatte zumindest einen wahren Kern?
Wenn wir unseren Rückblick mit der Vorkolonialzeit beginnen, fällt als Erstes auf, dass bis heute unsicher und umstritten ist, wie die Begriffe »Hutu«, »Tutsi« und »Twa« im damaligen sozialen Diskurs benutzt wurden.34 Schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit, die darüber Auskunft geben könnten, gibt es nicht. Weder ist bekannt, woher die Begriffe »Hutu« und »Tutsi« kamen (die Gruppe der »Twa«, kleinwüchsige, oft als Pygmäen bezeichnete Menschen, kann hier unberücksichtigt bleiben, weil sie mit maximal einem Prozent der Gesamtbevölkerung zahlenmäßig nicht ins Gewicht fiel und auf den Fortgang der Geschichte keinen Einfluss hatte), noch wen sie in welcher Eigenschaft genau benannten. Die lange Zeit favorisierte Theorie, wonach vor zirka 500 Jahren Hirten, Tutsi, aus den Regionen um den Oberlauf des Weißen und Blauen Nil (heute Südsudan beziehungsweise Äthiopien) in das Gebiet des heutigen Ruanda und Burundi kamen, die dort vom Ackerbau lebenden Hutu unterwarfen und ein von Ausbeutung und Unterdrückung geprägtes System der Gewaltherrschaft installierten, wird heute nicht mehr vertreten.35 Zu Recht steht sie, die oft auch Hamiten-Theorie genannt wird, unter dem Vorwurf, das Ergebnis eines äußeren, das heißt europäischen Blicks auf die ruandische Geschichte zu sein, bei dem bewusst oder unbewusst vorurteilsbehaftete Erwartungen Untersuchungsfragen generierten, die bereits in der Fragestellung die Antworten vorwegnahmen: Hutu sind von gedrungenem Wuchs, von unbekümmertem Wesen und mit Landwirtschaft beschäftigt, während Tutsi schlank und großgewachsen sind, von kaukasischem Typ, vornehm und zum Herrschen berufen.36 Was europäische Forschungsreisende und Missionare sehen wollten, sahen sie und fanden für die angeblich natürliche, rassisch bedingte Unter- und Überordnung etliche Bestätigungen. Dabei gab es nach Jahrhunderten interner Kämpfe erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Machtzentrum, an dessen Spitze ein Mwami, ein Tutsi-König, stand, dessen Vorfahren wahrscheinlich aus dem jetzigen Tansania nach Ruanda eingewandert waren.37 Daneben gab es noch, vornehmlich im Nordwesten des Landes, kleine Hutu-Königreiche, die jedoch nach und nach und nach heftigem Widerstand unter die Herrschaft des Mwami gerieten.38 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war in Ruanda die Monarchie der Tutsi unangefochten, und weil auch die Durchsetzung ihres absoluten Herrschaftsanspruchs selbst bei äußerster Dehnung des Begriffs nicht als friedlich bezeichnet werden kann, unterscheidet sie sich nur in geographischer Hinsicht von der Art und Weise der Herausbildung zentraler Herrschaft in vorstaatlichen europäischen Gesellschaften.
Was blieb, war der nicht zu übersehende physische Unterschied zwischen Hutu und Tutsi. Und zwei Einrichtungen, die in ähnlicher Form auch aus der Geschichte Europas bekannt sind: ubuhake war ein Vertrag zur Nutzung von Kühen, abgeschlossen zwischen dem Eigentümer der Kühe, gewöhnlich einem Tutsi, und einer anderen Person, gewöhnlich einem Hutu, dem gewissermaßen der Nießbrauch an den Kühen eingeräumt wurde und der als Gegenleistung dafür landwirtschaftliche Arbeit für den Tutsi erbringen musste. Uburetwa war ein Arbeitsdienst, der sich nur auf die Erbringung landwirtschaftlicher Arbeit bezog und den ausschließlich Hutu für den jeweiligen Tutsi-Herrscher leisten mussten.39 Zwar waren beide Frondienste längst nicht im ganzen Land verbreitet,40 aber ihre pure Existenz verband sich mit der unterschiedlichen Physis von Hutu und Tutsi bei fremden Beobachtern zu der so starken wie verhängnisvollen Überzeugung, in Ruanda – und mit Abstrichen auch in Burundi – die natürliche Überlegenheit einer Rasse über eine andere zu erleben. Dass selbst ausgeprägte Hierarchien und Abhängigkeiten auch in Europa ein nicht ungewöhnliches Phänomen waren und zudem in größeren Familienverbänden des ruandischen Königreichs (Clans) Loyalitäten existierten, denen ein höherer Wert als der Status von Hutu oder Tutsi beigemessen wurde, geriet darüber in Vergessenheit oder gar nicht erst in den außerruandischen Vorstellungshorizont.41
Als ab 1898 zuerst die Deutschen, ab 1916 dann die Belgier Kolonialherren in Ruanda und Burundi waren, war deren Vorgehen darum vorgezeichnet. Die zweifellos vorhandene und vielfach beschriebene drückende Ungleichheit zwischen Hutu und Tutsi42 erfuhr eine ausschließlich rassische Interpretation, mit den Tutsi als den natürlichen Erfüllungsgehilfen der neuen Herren (nicht alle Tutsi selbstverständlich, schließlich gab es auch arme unter ihnen, sondern die monarchische Elite und deren Umfeld) und der vergleichsweise großen Zahl der Hutu als den eigentlichen Objekten der Kolonisierung. Das entsprechende Modell nannte sich »indirekte Herrschaft« (indirect rule/administration indirecte) und bedeutete konkret: die existierenden Sozial- und Herrschaftsstrukturen blieben unangetastet, über den Herrschaftsverband des Mwami wölbte sich die Kolonialmacht und beeinflusste, möglichst unauffällig, aber gleichwohl den eigenen Vorteil im Auge behaltend, dessen Handeln.43 Was lag auch aus Sicht der Kolonialherren näher, als die angenommene rassische Überlegenheit des Mwami und seiner Ethnie und deren tatsächliche militärische und politisch-wirtschaftliche Dominanz für die Verwaltung des Kolonialgebiets zu nutzen. Vorsichtige Reformen beseitigten zwar gegen Ende der 1920er Jahre die Einrichtungen des ubuhake und uburetwa, doch wenige Jahre später wurde, als das Ergebnis einer Volkszählung, die Ausweispflicht eingeführt. Darin musste fortan angegeben werden, welcher Ethnie – Hutu, Tutsi oder Twa – der Ausweisinhaber angehörte. Die ethnische Spaltung des Landes war damit administrativ beglaubigt, zugleich hatte die eindeutige Konnotation der Begriffe »Hutu« und »Tutsi« quasi Gesetzeskraft erlangt. Alles das, was europäische Reisende und Missionare berichtet und verstanden hatten, entsprach nun offiziell der Wahrheit.44
Die Tutsi Ruandas, oder genauer gesagt: die Wohlhabenden und Einflussreichen unter ihnen, begrüßten die Anerkennung ihrer Dominanz, die sie, davon waren sie überzeugt, zum Wohle aller Ruander ausgeübt hatten und auch künftig, unter dem kolonialen Schutzschirm, ausüben würden.45 Nicht zufrieden waren, aus nachvollziehbaren Gründen, die Hutu. Nahmen sie anfangs die mit ihrer Ethnie verbundene niedere soziale Stellung noch widerstrebend hin, so änderte sich das mit dem Einsetzen der Emanzipationsbewegungen in den afrikanischen Kolonien, da sie die Sensibilität für bestehende Ungerechtigkeiten erhöhte (gegen Ende der 1950er Jahre waren zum Beispiel von den 45 Leitern [chefs] der größten Verwaltungseinheiten Ruandas 43 Tutsi, von den 559 Verwaltungseinheiten eine Stufe darunter [sous-chefs] 549).46 Der Unmut innerhalb der Hutu-Bevölkerung wuchs zusehends, und erstmals wurde er auch von Hutu in die Öffentlichkeit getragen, die an Schulen und in Seminaren der Katholischen Kirche gelernt und studiert hatten (der Zugang zu staatlichen Einrichtungen war für sie wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit begrenzt). Die Kritik blieb nicht ohne Wirkung. Der belgische Vize-Generalgouverneur Jean-Paul Harroy (1955–1960) zeigte mehr und mehr Verständnis für die Forderungen der Hutu, und auch die Katholische Kirche stellte sich nach der Amtseinführung des neuen apostolischen Vikars, Monseigneur Perraudin, 1955 immer offener auf die Seite der Hutu.47
Beflügelt von dieser Unterstützung und frustriert von einer sozialen Realität, die auch aufgrund der Unterstützung als nicht mehr hinnehmbar erschien, veröffentlichten neun Hutu, fast alle ehemalige Seminaristen, im März 1957 ein Manifest, das eine Zäsur in der jüngeren ruandischen Geschichte darstellen sollte. Überschrieben war es mit »Bemerkung über den sozialen Aspekt des Rassenproblems in Ruanda« und gab damit Ton und Inhalt der nunmehr öffentlichen Auseinandersetzung vor. Denn natürlich konnten die Tutsi der Annahme, in Ruanda habe sich die Haltung mental verfestigt, dass die Eliten des Landes nur aus »hamitischen Kreisen« (rangs hamites) stammen könnten, es daher eigentlich zwei Völker gebe, von denen das eine der innere Kolonialherr des anderen sei, nichts abgewinnen.48 Doch die soziale Realität brach sich scharf an den hilflos wirkenden Appellen zur Wahrung der Einheit aller Ruander unter dem Mwami, und da die Kolonialmacht Belgien und die Katholische Kirche eindeutig Partei für die Hutu nahmen, überschlugen sich nun die Ereignisse. Parteien, die zugelassen wurden, konstituierten sich sogleich nach ethnischen Kriterien, die Parteiprogramme wurden immer radikaler, bald kam es zu den ersten Morden. Während Tutsi-Politiker für eine möglichst schnelle Loslösung von Belgien und – zum Zwecke des eigenen Machterhalts – die Einführung einer konstitutionellen Monarchie eintraten, forderten die Wortführer der Hutu eine »soziale Revolution«, das heißt die Teilhabe an der Macht und, mit dem absehbaren Ende der Kolonialzeit, die Macht schlechthin.49
Eine »soziale Revolution« war die Umkehrung der Machtverhältnisse, die sich zu jener Zeit in Ruanda vollzog, in der Tat, zugleich ist dieser Ausdruck aber auch ein Euphemismus für das, was außerdem noch geschah. Den ersten politisch motivierten Morden folgten weitere Gewaltaktionen. Morde an Hutu-Politikern wurden mit einem Massenmord an Tutsi beantwortet, Tausende von Hütten, in denen Tutsi lebten, wurden in Brand gesetzt und ihre Bewohner vertrieben. Der Unmut, und – nach den ersten Morden – die Wut und der Hass der Hutu richteten sich nicht nur gegen Tutsi, die Machtpositionen innehatten. Zum Feind der großen Mehrheit der Ruander wurden jetzt alle Tutsi (etwa 15 Prozent der seinerzeit etwa drei Millionen Einwohnern Ruandas), auch wenn sie nur einfache Bauern wie die Hutu selbst waren. Sie galten automatisch als Teil des königlichen und kolonialen Machtsystems, als Bedrohung für die noch junge und fragile Hutu-Identität, die mit allen Mitteln, Gewalt eingeschlossen, geschützt werden musste.50
Im Januar 1961 riefen Hutu-Politiker die Republik aus, erklärten den Mwami für abgesetzt und die Monarchie sowie all ihre Institutionen und Symbole für abgeschafft. Die neue Verfassung vom 28. Januar 1961 unterstrich dies noch einmal, indem sie in der Präambel das Ziel formulierte, »de libérer le peuple du joug féodal et colonial« (»das Volk vom Joch des Feudalismus und des Kolonialismus zu befreien«). Erster Präsident des ab 1. Juli 1962 unabhängigen Ruanda wurde Grégoire Kayibanda, einer der Autoren des »Hutu-Manifests«, der inzwischen zum bekanntesten Führer der Hutu-Bewegung avanciert war.
Innerhalb von ein paar Jahren hatte sich der ruandische Staat also fundamental geändert. Die neue Elite kam aus den Reihen der Benachteiligten von gestern, und die Elite von gestern (und mit ihr die mit ihr assoziierte Bevölkerungsgruppe) war nunmehr nur noch geduldet, solange sie sich loyal zur Hutu-Republik verhielt. Das Verständnis von »loyal« wurde jedoch höchst einseitig und pauschal bestimmt: Aufgrund der Gewalttätigkeiten, die mit der »sozialen Revolution« einhergingen, hatten etwa 150 000 Tutsi das Land verlassen und waren nach Uganda, Tansania, Burundi und Zaire geflüchtet. Ihre Versuche, die Rückkehr durch militärische Angriffe gewaltsam zu erzwingen, waren seitens der Hutu-Regierung ebenfalls mit militärischer Gewalt abgewehrt worden. Gleichzeitig waren, aus Rache und Vergeltung für die Angriffe der Exil-Tutsi, die noch in Ruanda lebenden Tutsi zu Hunderten und Tausenden umgebracht worden.51
Auch wenn in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Kayibandas (1962–1973) die Angriffe von außen deutlich nachließen, an dem »Hutismus« in Ruanda änderte sich nichts. Er blieb das bestimmende Merkmal der neuen ruandischen Identität, die in Frage zu stellen bei Strafe der vollständigen Vernichtung der Tutsi (so sinngemäß Kayibanda Ende 1964 in einer Warnung an die Tutsi im Exil) verboten war.52 Dass die Warnung sehr ernst zu nehmen war, wurde in den folgenden Jahren mehrfach unterstrichen, zuletzt 1973 so sehr, dass der Staat in dem allgegenwärtigen Klima der Verdächtigungen und Verfolgungen nahezu seine Funktionsfähigkeit verlor.53 Für eine Gruppe von Offizieren aus dem Norden des Landes war das der Auslöser, den Sturz des Staatspräsidenten zu betreiben. Die Vorwürfe, die gegen Kayibanda erhoben wurden, lauteten: Korruption, Nepotismus sowie Gefährdung der ruandischen Einheit durch Anti-Tutsi-Rassismus. 1974 wurde Kayibanda von einem Militärgericht wegen der Verfolgung der Tutsi ein Jahr zuvor zum Tode verurteilt.54
Die neue Regierung unter dem Präsidenten Juvénal Habyarimana (1973–1994) wollte die »soziale Revolution« durch eine »moralische Revolution« ergänzen. Dazu gehörte, neben der Beseitigung von Bereicherung und Protektion aufgrund der regionalen Herkunft (unter Kayibanda wurden bevorzugt Menschen aus dem Zentrum und dem Süden des Landes mit attraktiven Posten versorgt), vor allem die Aufwertung der Tutsi. Sie galten nicht mehr als Rasse hamitischer Herkunft, sondern als eine ethnische Gruppe in Ruanda, das heißt als eine ruandische Minderheit und nicht mehr als Fremde. Durchgesetzt werden sollte diese neue Sichtweise wie auch die gleichmäßige regionale Berücksichtigung bei der Postenbesetzung in Verwaltung und Militär durch ein Quotensystem, welches nach Größe der Ethnie und der regionalen Bevölkerungsdichte gestaltet war (60 Prozent aller Posten für »den Norden«, 40 für »den Süden«; gut 90 Prozent der Stellen an Schulen, Universitäten in der Verwaltung und beim Militär für Hutu, etwa 10 Prozent für Tutsi).55
Die Wirklichkeit, wie sie sich in den kommenden Jahren darstellte, war jedoch eine völlig andere. Entgegen den programmatischen Aussagen über die künftige Entwicklung unter dem neuen Regime blieben Korruption, Nepotismus und Klientelismus nicht nur bestehen, sie wurden noch intensiviert und systematisiert. Die politische, militärische und ökonomische Macht lag bald in den Händen einer kleinen Gruppe aus der Heimatregion des neuen Präsidenten Juvénal Habyarimana im Norden des Landes. »Akazu« (kleines Haus) wurde diese Gruppe genannt, die sich nach und nach den Staat aneignete und ohne die in Ruanda nichts mehr ging. Begünstigt und verstärkt wurde diese Entwicklung durch eine lückenlose, zentralisierte Verwaltung und ein Einparteiensystem. Dem Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement/MRND (national-revolutionäre Bewegung für Entwicklung) musste jeder Ruander qua Geburt angehören.
Das System schien stabil. Das ethnische Quotensystem funktionierte leidlich, obgleich es unter den Bürgermeistern und Präfekten nicht einen einzigen Tutsi gab (mit Ausnahme des im August 1992 ernannten Präfekten von Butare), unter den Offizieren der Armee und den zwischen 25 und 30 Ministern nur jeweils einer Tutsi war und sich auch unter den 70 Abgeordneten nur zwei Tutsi fanden.56 Allerdings stieg die Zahl der Eheschließungen zwischen Hutu und Tutsi und damit auch die Zahl der Kinder, die aus solchen Ehen hervorgingen und die nicht mehr die charakteristischen Züge einer bestimmten Gruppe trugen oder aber entgegen ihrer physischen Erscheinung – im patrilinearen System Ruandas entschied die Zugehörigkeit des Vaters über die der Kinder – einer anderen Gruppe angehörten.57 Die Gesellschaft schien befriedet, die Wirtschaft florierte, die Armut ging zurück, und Ruanda galt bei den Geberländern in der internationalen Entwicklungshilfe bald als »Modellstaat« in Afrika. Ende der 1980er Jahre folgte jedoch der wirtschaftliche Einbruch. Kaffee, der 75 Prozent des Außenhandels von Ruanda ausmachte, verfiel im Preis. Eine Dürre verwüstete die Ernte. Hunger und Arbeitslosigkeit wurden schnell zu einem Massenphänomen. Der Druck der Öffentlichkeit, der Geberländer und der Gläubiger (Weltbank) auf die Regierung wuchs. Reformen wurden verlangt, deren wichtigste die Zulassung von Parteien war, um auf diese Weise, so hoffte man, das korrupte System der Günstlingswirtschaft aufbrechen und das Land mittels der Einführung demokratischer Strukturen wieder stabilisieren zu können. Gleichzeitig sollte erstmals auch die Frage einer Rückkehr der im Exil lebenden Tutsi, deren Zahl sich zwischen 600 000 und 700 000 bewegte, diskutiert werden.58
In dieser Phase, in der trotz aller Widrigkeiten erste Fortschritte im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr erreicht worden waren und eine Kommission zur Erarbeitung konkreter politischer Reformen eingerichtet worden war, griff am 1. Oktober 1990 von Uganda aus die Befreiungsbewegung FPR Ruanda an. Es gelang ihr, bis kurz vor die Hauptstadt Kigali vorzustoßen, nur belgisch-französische Militärhilfe, verstärkt durch zairische Unterstützung, hielt sie vom weiteren Vorrücken ab.59 Zwar wäre die Einnahme Kigalis durch die FPR von vielen in Ruanda lebenden Tutsi begrüßt worden, viele fürchteten sie jedoch auch, erinnerten sie sich doch noch gut an die Vernichtungsdrohungen der Vergangenheit. Ein Leben in einem Quotensystem mit der (irgendwann vielleicht) realistischen Aussicht auf dessen baldige Aufhebung erschien vielen lebenswerter als ein Leben begleitet von der Gefahr möglicher Racheakte. Und Racheakte seitens des Habyarimana-Regimes ließen nicht lange auf sich warten. In beinahe unmittelbarer Reaktion auf den FPR-Angriff wurden insbesondere in Kigali, wo es zu Schießereien gekommen war, Tausende Personen festgenommen, in der Mehrzahl Tutsi, doch auch viele Hutu, die der Opposition zugerechnet wurden – Hutu aus dem Zentrum und dem Süden des Landes, das heißt aus den Herkunftsgebieten führender Politiker der Ersten Republik.60 Hunderte starben im Gefängnis, und in den Augen der Opposition und der internationalen Öffentlichkeit hatte das Regime damit erneut sein hässliches, brutales Gesicht gezeigt.
In den Hintergrund geriet darüber, dass der Angriff auf die Nordgrenze Ruandas ein aggressiver Akt und als solcher eine Völkerrechtsverletzung war. Ruanda war ein souveräner Staat und konnte sich auf das Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta berufen. Obschon es generell nur die Gewalt verbietet, die von einem Staat ausgeht und gegen einen anderen Staat gerichtet ist, erfasst es auch die Fälle, in denen ein Staat den gewaltausübenden Personen erhebliche Ressourcen zur Verfügung stellt wie beispielsweise in Form von sicheren Operationsbasen oder erheblichen Waffenlieferungen.61 Genau dies ist im Oktober 1990 und in der Folgezeit in Uganda geschehen. Die FPR hatte sich dort gegründet, ihre Mitglieder waren zugleich Mitglieder der National Resistance Army (NRA) Yoweri Musevenis (zirka 4000 von 14 000) und hatten diesen 1986 mit an die Macht gebracht. Ein Ruander, Fred Rwigyema, stieg sogar bis zum Generalstabschef der NRA und stellvertretenden Verteidigungsminister Ugandas auf, ein anderer, Paul Kagame, wurde Leiter des militärischen Nachrichtendienstes.62 Beider Einfluss sank zwar infolge von Machtkämpfen nach kurzer Zeit schon wieder, doch die numerische Größe ihrer Armee innerhalb der NRA sowie die ehemalige Kampfgemeinschaft lassen, wie im Übrigen auch die USA feststellten, keinen vernünftigen Zweifel an der zumindest bis 1992 dauernden – Anfang 1993 entstand im Norden Ruandas eine »befreite Zone«, die dann der FPR als Rückzugsgebiet diente – massiven Unterstützung Ugandas für die FPR.63
Formal begann also die Durchsetzung des »Rechts auf Rückkehr« oder des »Rechts auf Heimat« mit einem massiven Völkerrechtsbruch, gegen den sich Ruanda nach dem Selbstverteidigungsrecht aus Artikel 51 der UN-Charta zur Wehr setzen und gegen den Ruanda, nach derselben Rechtsregel, die Nothilfe verbündeter Staaten beanspruchen durfte. Allerdings nur in dem durch das Recht abgesteckten Rahmen, nicht durch die Begehung neuen Unrechts. Doch eben dazu kam es im Rückgriff auf die unselige Tradition, Tutsi im Land kollektiv der Komplizenschaft mit den Angreifern zu beschuldigen, an mehreren Orten Ruandas. Zwischen Januar und Juni 1991 töteten fanatisierte Hutu auf den Wink offizieller Stellen hin Hunderte, vielleicht weit über tausend Tutsi in verschiedenen Präfekturen im Nordwesten des Landes. Im März 1992 wiederholten sich die Mordaktionen, nunmehr als »Selbstverteidigung« deklariert, im Südosten des Landes unweit der Grenze zu Burundi. Wieder waren die Täter aufgehetzte Hutu, einfache Bauern, wie sie auch die Täter waren in den vielen kleinen Massakern, die sich 1992/93 hier und dort im Land ereigneten.64 Die Letztverantwortung für diese Taten war darum eindeutig, so ein internationaler Untersuchungsbericht im März 1993: Es war die ruandische Regierung, die sie ermöglichte und förderte, und die Opfer waren Opfer geworden, weil sie Tutsi waren und damit als ibiyitso, als Verräter, galten.65 Nur am Rande, in den letzten beiden Punkten einer langen Auflistung von Gräueltaten, wird auch die FPR der Urheberschaft von Gewalttaten beschuldigt. Ein uneingeschränkter Zugang zu möglichen Zeugen sei nicht möglich gewesen, hieß es zur Erklärung im Bericht.66
Heute weiß man – oder kann es in Gesprächen erfahren –, dass die FPR in weit größerem Maße an den Verbrechen beteiligt war und bereitwillig an der weiteren Beschleunigung der Gewaltspirale mitwirkte. Sie agierte nicht so offensichtlich aggressiv und rassistisch wie das Habyarimana-Regime zum Beispiel mit der Verkündung der »Zehn Gebote des Hutu«67 oder der Gründung des Propagandasenders »Radio Télévision Libre des Mille Collines« (RTLM),68 dafür aber sehr effektiv und zielgerichtet destabilisierend. Es ist auffallend, mit welcher Regelmäßigkeit die FPR militärische Operationen lancierte, nachdem bei den Friedensverhandlungen in Arusha unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft Kompromisse geschlossen werden mussten, und wie umfassend staatliche Institutionen und neugegründete Parteien unterwandert wurden. Ein Zeitzeuge: »Ich war Mitglied in der FPR und zugleich auch in der neuen Parti Social-Démocrate (PSD/sozialdemokratische Partei). Und ich kenne sehr viele Tutsi, bei denen das auch der Fall war. Sie waren in der FPR und entweder in der PSD oder in der Parti Libéral (PL/liberalen Partei). Wir hatten, vor allem ab Herbst 1993, keine Hoffnung mehr auf eine Reform des Regimes.«69
Die Folge waren Aufspaltungen der Parteien in gemäßigte und radikale Flügel (mit FPR-infiltrés auf beiden Seiten), Attentate gegen Protagonisten des einen wie des anderen Flügels mit oft unklarer Täterschaft und eine rasante Militarisierung der Gesellschaft. Die Regierung und ihr nahe stehende Personen kauften im großen Stil Waffen ein und verteilten sie an die Bevölkerung, angeblich zur Selbstverteidigung, doch wurde die zur Tat drängende Vernichtungsrhetorik unüberhörbar.70 Das wiederum mobilisierte die FPR und ihre Sympathisanten, mehrheitlich Tutsi, aber auch Hutu: »Auf dem Gelände des CND (Conseil National du Développement, Name des Parlaments in der Zweiten Republik unter Habyarimana, G. H.), auf dem seit Dezember 1993 als vertrauensbildende Maßnahme 600 FPR-Kämpfer untergebracht waren, haben wir eine militärische Grundausbildung absolviert. Sie dauerte drei bis vier Tage und war streng geheim. In meiner Gruppe, die aus fünf Männern bestand, war ich der einzige Tutsi. Wir haben den Umgang mit Waffen gelernt und uns körperlich trainiert, indem wir im Treppenhaus rauf und runter liefen. Nach der Grundausbildung haben wir nur noch einmal wöchentlich geübt, natürlich streng geheim. Nicht mal meine Frau wusste, was ich machte. Wir haben auch Waffen bekommen, vier Gewehre und zwei Pistolen, die haben wir in einem Versteck aufbewahrt. Ingesamt wird die geheime Armee der FPR allein in Kigali ungefähr 3000 Mann stark gewesen sein. Das war zumindest mein Eindruck.«71
Die weitere Entwicklung ist nur zu bekannt: Das Flugzeug mit dem Präsidenten Habyarimana und, was oft übersehen wird, auch mit dessen burundischem Amtskollegen und einem halben Dutzend höchster ruandischer Armeeoffiziere an Bord, wird kurz vor dem Erreichen des Flughafens Kigali abgeschossen. Schlagartig trat das Land in die Phase der Gewaltexplosion ein. »Wir saßen im ›Chez Lando‹ (ein Restaurant zirka 1,5 Kilometer vom Flughafen entfernt, G. H.), als plötzlich ein lauter Knall zu hören war. Ich weiß es noch wie heute. Wie schauten uns gerade ein Fußballspiel an – es war Nigeria gegen Sambia –, als es knallte. Als wir dann erfuhren, was geschehen war, bekamen wir Panik. Wir wollten nichts wie weg, denn die Stimmung wurde bedrohlich. ›Ihr guckt Fußball, und der Präsident stirbt‹, rief man uns zu. Auf dem Nachhauseweg musste ich Umwege fahren, weil viele Straßen schon gesperrt waren.«72
Nicht einmal eine Stunde später waren die ersten Straßensperren errichtet, und die Todesschwadronen begannen, gezielt Menschen zu ermorden: Tutsi, weil sie alle als reale oder potenzielle Verräter angesehen wurden, und Hutu, die den Gegnern des Regimes angeblich oder tatsächlich zu nahe standen.73 Widerstand war nicht möglich, die Überraschung über das Ausmaß des Furors, der über das Land hereinbrach, und über die Planmäßigkeit des Vorgehens der Mörder war zu groß. Das war selbst, cum grano salis, dann nicht anders, als nach der ersten Welle der Vernichtung, die sich auf Kigali und den nordöstlichen Teil des Landes konzentriert hatte, etwa zehn Tage später die zweite Welle der Vernichtung die südwestlichen Präfekturen erfasste. Allerdings konnte beides, Furor wie Planmäßigkeit, auch ein Jahrzehnt später die bohrende Frage nicht verhindern, warum die FPR 1994 drei Monate gebraucht hat, um das Land zu erobern und das Morden zu beenden, wo sie doch bei vorherigen Angriffen, zuletzt im Februar 1993, weit schneller vorgerückt war.74 Auch Roméo Dallaire kommt am Ende seines langen Berichts über das gescheiterte UN-Engagement in Ruanda zu dem Schluss (nachdem er für den Völkermord zuallererst jene Ruander verantwortlich machte, die ihn planten, anordneten, überwachten und durchführten): »Aber der Tod so vieler Ruander lässt sich auch dem Militärgenie Paul Kagame anlasten, der seinen Feldzug nicht beschleunigte, als das Ausmaß des Völkermordes klar wurde (…).«75 Alison Des Forges ist ebenfalls bestürzt über die Weigerung der FPR-Führung, eine neue, stärkere UN-Friedensmission mit erweitertem Schutzmandat in Ruanda zuzulassen. Ende April 1994, der UN-Sicherheitsrat fühlte in dieser Frage bei den absehbaren Siegern des Bürgerkrieges vor, hätte eine Zustimmung noch viele Menschenleben retten können. Der militärische Sieg der FPR sollte jedoch, so die Reaktionen ihrer Führer, möglichst vollständig sein, eine Einmischung von außen mit vielleicht unkontrollierbaren Folgen war daher unerwünscht.76