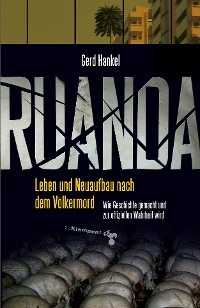Kitabı oku: «Ruanda», sayfa 11
Von dieser Perspektive aus gesehen wird man schwerlich behaupten können, der FPR stehe der geltend gemachte Anspruch, entschlossen für die Sache der Menschlichkeit eingetreten zu sein, zu Recht zu. Schon die Herleitung und erste Begründung des Anspruchs ist falsch. Weder in der Vorkolonialzeit noch in der Kolonialzeit hat es eine konfliktfreie Koexistenz, gar ein wirkliches Zusammenleben zwischen Hutu und Tutsi gegeben. Aus subjektiver Sicht mag, besonders unter dem Eindruck der Pogrome zu Beginn der 1960er Jahre, eine idyllisierende Wahrnehmung jener Vergangenheit eingetreten sein, so wie es nur zu verständlich ist, dass dieselben Pogrome auch die nun völlig andere Wahrnehmung der folgenden Jahrzehnte prägten. Tatsache aber ist, dass die – zum Vorteil der Tutsi – bestehenden Spannungen zwischen Hutu und Tutsi vor der Unabhängigkeit des Landes weit größer waren als von der neuen offiziellen Meinung Ruandas behauptet, und dass die Diskriminierung der Tutsi nach der Unabhängigkeit zwar rasant anstieg, um dann jedoch, wiederum entgegen dieser Meinung, kontinuierlich zurückzugehen, bis sie Ende der 1980er Jahre ein Niveau erreicht hatte, dass beispielsweise den Vergleich mit dem Apartheid-Regime in Südafrika als viel zu dramatisch hätte erscheinen lassen.
Krieg und Bürgerkrieg änderten die Situation von Grund auf. Jetzt entstand tatsächlich, noch verschärft durch den von außen ausgeübten ökonomischen und politischen Reformdruck, die nach 1994 so heftig angeprangerte Repression. Initiiert und durchgeführt wurde sie von dem Hutu-Regime an der Macht, es trägt die Hauptverantwortung für das Wiederaufleben rassistischer Stereotypen und eines »Hutismus« inklusive »Hutu-Power«, für die die finale Auslöschung der Tutsi-Präsenz in Ruanda wünschenswert und praktikabel war. Im Lichte der Folge dieses kühl berechnenden Fanatismus dürfte es auf den ersten Blick schlechterdings abwegig anmuten, der FPR einen gewissen Grad an Mitverantwortung zuzuweisen. Doch kommt man nicht umhin, genau dies zu tun. Ohne den von der FPR begonnenen Krieg, ohne deren Destabilisierungsversuche in Form von geheimen Kommandounternehmen und subversiven Zellen hätte es die Gewalteskalation insbesondere in den Jahren 1993/94 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gegeben. Dass der Völkermord von Hutu begangen wurde, bleibt davon unberührt.
Auf die Frage nach der Berechtigung des Selbstverständnisses, wie es sich gut zehn Jahre nach dem Völkermord unter Führerschaft der FPR in der ruandischen Politik etabliert hatte, wäre folglich zu antworten: Dieses Selbstverständnis steht auf äußerst schwachen Füßen. Es kann sich nur auf die Nicht-Verantwortlichkeit für den Völkermord und auf dessen Beendigung stützen. Für sich genommen wäre das schon sehr viel und würde keinesfalls das einschränkende »Nur« rechtfertigen. Allerdings bestehen teilweise ernsthafte Zweifel an der Lauterkeit des Selbstverständnisses, Zweifel, die noch dadurch vertieft werden, dass das Verständnis der eigenen Geschichte instrumentellstrategischen Überlegungen zu gehorchen scheint. Dort, wo gezielt kritisch hinterfragt werden müsste (im Hinblick auf die Vorkolonial- und Kolonialzeit), beschönigen die Vertreter des neuen Ruanda das Zusammenleben von Hutu und Tutsi, und dort, wo die Fakten das Bild in helleren Farben erscheinen lassen müssten (so in Bezug auf die zweite Hälfte der 1970er und die 1980er Jahre), wird ausschließlich schwarz gezeichnet.
1.2 Der Unterschied zwischen geschriebenem Recht und praktischer Politik oder der Verweis auf die afrikanische Form der Demokratie
Dass der Präsident der Ersten Ruandischen Republik, Grégoire Kayibanda, als Inkarnation des Bösen präsentiert werden konnte, warf keinerlei Schwierigkeiten auf. Die Pogrome während seiner Amtszeit und die Vernichtungsdrohungen gegen die Tutsi waren Teil der kollektiven Erinnerung aller. Bei seinem Nachfolger Juvénal Habyarimana war es schwieriger. Verfolgungsmaßnahmen, die nur annähernd den unter Kayibanda üblichen nahe kamen, gab es bis Oktober 1990 nicht. Und doch, so die späteren offiziellen Erklärungen, seien die Ursachen für die dann einsetzende Gewaltpraxis des Regimes bereits in dessen Anfangsjahren gesetzt und stetig intensiviert worden. Die Einheitspartei MRND habe die segrationistische Hutu-Ideologie übernommen, habe das Feindbild gepflegt und die Macht in den Händen einer kleinen Gruppe von Politikern und Militärs aus den nördlichen Präfekturen Gisenyi und Ruhengeri konzentriert.77 Die Folgerung daraus sei für das neue Ruanda klar: Niemals wieder dürfe nur eine Partei über Wohl und Wehe des Landes entscheiden, und immer müssten die Parteien nur dem Volk und nicht einer Ethnie oder Region verpflichtet sein.78
Die neue Verfassung hat dies in verbindliches Recht gegossen. Zur Vermeidung jeder Machtkonzentration darf die Mehrheitspartei nicht mehr als die Hälfte der Regierungsmitglieder stellen (Artikel 116) und Staatspräsident sowie Parlamentspräsident müssen verschiedenen Parteien angehören (Artikel 58). Richtern, Staatsanwälten, Soldaten und Polizisten ist überhaupt die Mitgliedschaft in einer Partei untersagt (Artikel 59). Allerdings hat der Staatspräsident, wie wir gesehen haben, eine starke Stellung innerhalb der Institutionen. Er verfügt über die mit Abstand weitreichendsten Kompetenzen, wozu auch gehört, dass er die höchsten Posten in Justiz und Armee besetzen kann.
Erinnern wir uns nun an die Kampagne vor der Präsidentschaftswahl, in der die Erfolge der neunjährigen Übergangszeit mit der Person Paul Kagame in einen unlösbaren Zusammenhang gebracht wurden, eine Kampagne, die nach der erfolgreichen Wahl in Form von medial prominent platzierten Glückwünschen diverser Ministerien sowie in- und ausländischer Firmen beziehungsweise Organisationen eine Neuauflage erfuhr, erinnern wir uns weiter an die umfangreiche (Medien)Kampagne zugunsten der Kagame-Partei FPR vor und nach den Parlamentswahlen, wäre es da übertrieben, von einer großen, möglicherweise bedenklichen Machtkonzentration (von außen herangetragen und von innen erwartet und umgekehrt) zu sprechen? Vielleicht sogar von beunruhigenden Parallelen zum früheren Habyarimana-Regime, wie es in Gesprächen unter vier Augen von Ruandern häufig zu hören war?
Sicherlich wird man hier in Betracht ziehen müssen, dass die Ausübung politischer Macht in Afrika ohnehin sehr personenabhängig ist. Im Vordergrund stehen nicht die Parteien beziehungsweise das Parlament, im Vordergrund steht, und zwar mit großem Abstand zu den anderen Kräften im Land, das Staatsoberhaupt. Das klingt – bei rechtsstaatlichem Vorverständnis – normaler, als es tatsächlich ist, denn im Unterschied zu präsidialen Systemen wie in Frankreich oder den USA ist die personenabhängige (patrimoniale) Macht in Afrika durch drei Charakteristika gekennzeichnet: Sie ist zunächst, was sich bei ihrer Bezeichnung von selbst versteht, personalen Charakters, das heißt Gesetze für Wahl und Abwahl, Amtseinsetzung und Amtsenthebung des Staatsoberhaupts gibt es nicht oder sie sind in ihrer Rechtsgeltung beliebig handhabbar. Sie ist weiterhin von Reziprozität durchsetzt, von Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme im Verhältnis von Machtinhaber, dem Patron, und seiner Klientel. Politische Loyalität wird mit materiellen Vergünstigungen erkauft. Schließlich ist Kennzeichen der patrimonialen Macht die Zentralisierung von Ämtern und Kompetenzen oder, anders formuliert, die fehlende institutionelle Trennung zwischen den verschiedenen Staatsgewalten.79 Big Men werden im anglophonen Afrika die Beherrscher dieses »vertikalen Netzwerks« in einer merkwürdigen Mischung aus Angst und Respekt genannt.80
Glaubt man der ehemaligen britischen Entwicklungsministerin Claire Short, dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton oder auch dem Vertreter der EU in Ruanda, Jeremy Lester, dann gehörte Paul Kagame gewiss nicht zu den klassischen, nur auf das eigene Wohl und das Wohl einer ihnen gefälligen Clique bedachter afrikanischen Führer. Für Claire Short, die im Juni 2003 zu einem Kurzbesuch in Kigali weilte, war der ruandische Weg »eine Geschichte der Hoffnung«, die zu der Empfehlung Anlass gab: »Ruanda kann andere Länder zur Nachahmung einladen«.81 Clinton, ein Jahr später in Ruanda, bescheinigte dem Land »dieses kleine Land hat sich in einer Weise entwickelt, die in jeder Hinsicht bemerkenswert ist«,82 und Lester meinte zur etwa gleichen Zeit sogar direkt an die Adresse Kagames: »Über zehn Jahre sind Fortschritte gemacht worden, von denen vor zehn Jahren nur geträumt werden konnte; Fortschritte in guter Regierungsführung und in der Schaffung neuer Institutionen, um das Land zu regieren (…)«.83
In ähnlichen Worten hätten noch viele andere die Leistungen Kagames gelobt, wäre ihnen dazu die Gelegenheit gegeben worden. Ersatzweise mussten sie sich mit der Bekanntgabe neuer Hilfsleistungen an Ruanda begnügen, von denen die ruandische Presse beinahe im Wochenrhythmus berichtete. Millionenbeträge für den Gesundheitsbereich, für die Landwirtschaft, für die Dezentralisierung, den Neuaufbau von Verwaltung und Justiz oder für Korruptions- und unmittelbare Armutsbekämpfung. Ruanda war 2003/2004 endgültig zum Lieblingsland internationaler Hilfe avanciert. Dank eines energischen, auf Effektivität versessenen Präsidenten gab es endlich gute Nachrichten aus einer Region, die sonst nur schlechte lieferte. Dass dessen Konterfei in allen öffentlichen Gebäuden, Unternehmen und Hotels hing und die präsidiale Autokolonne sich in halsbrecherischer Fahrt und ohne Rücksicht auf Leben und Eigentum anderer den Weg erzwang, galt als Relikt aus vergangenen Zeiten, dass milde lächelnd hinzunehmen sei. Es verblasste angesichts einer ruandischen Zukunftsplanung, die anlässlich der Verabschiedung der UN-Millenniumsziele im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben worden war und die den programmatischen Titel »Vision 2020« erhalten hatte.84 Regelmäßig wurden in den Medien ihre zentralen Aussagen in Erinnerung gerufen, wurden erste Erfolge präsentiert und die Erreichbarkeit der nächsten Schritte zugesichert.85 Die Vision 2020 werde in Ruanda täglich ein wenig konkreter, davon waren nicht nur Claire Short, Bill Clinton, Jeremy Lester und viele andere überzeugt.
Als Claire Short als Erste dieser Reihe im Juni 2003 das hohe Lied auf Ruandas Entwicklung unter Paul Kagame zu singen begann, war Jean Mbanda nach dreijähriger Haftzeit gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Mbanda, ein Abgeordneter der sozialdemokratischen PSD im Übergangsparlament, hatte im Mai 2000, zwei Monate nach dem Rücktritt des Staatspräsidenten Pasteur Bizimungu – ein Rücktritt, der das Ergebnis eines Machtkampfs mit Paul Kagame markierte – einen offenen Brief an die Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Parteien geschrieben. »Ich erlaube mir hochachtungsvoll, Ihnen meine Befürchtungen hinsichtlich der in den letzten Jahren festzustellenden zunehmenden Verkleinerung des politischen Raums in Ruanda mitzuteilen«, hieß es darin einleitend, und weiter: »Ich bin der Meinung, dass ich wie jeder andere ›bewusst lebende‹ Bürger Ruandas die Pflicht habe, rechtzeitig vor einem Wiederaufleben autoritärer Machtausübung zu warnen, von der allgemein gesagt wird, dass sie für die schlechte Regierungsführung steht, die unser Land in die verschiedenen zyklischen Krisen geführt hat, deren Höhepunkt mit dem Völkermord erreicht wurde, den im April 1994 ein Teil der Ruander an einem anderen begangen hat. Die einen werden sagen, dass es Selbstmord (oder eine Verrücktheit) ist, den (die) ich begehe, indem ich dieses Papier veröffentliche (ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie dadurch meine Befürchtungen bestätigen!), andere wiederum werden mir Publizitätssucht unterstellen.«86 Nichts von dem sei wahr, die Vorwürfe seien Ausdruck politischer Willfährigkeit, so Mbanda entschieden, um dann auf zehn Seiten zu einer politischen, historisch und philosophisch argumentativ abgestützten Kritik anzusetzen, die sich am Ende unmittelbar an Kagame wandte. Kurz gefasst, lautete seine Kritik, dass die FPR andere Parteien ausgrenze, charakterschwache Proselyten auf ihre Seite ziehe und auf diese Weise die Politik des Landes dominieren wolle. Abweichende Meinungen würden nicht mehr zugelassen, selbst die Vertreter der Zivilgesellschaft seien schon gleichgeschaltet worden. Statt eines demokratischen Pluralismus, wie er auch von der FPR gefordert worden sei, gebe es Ausgrenzung und hemmungslose Bereicherung bei denen, die auf der angeblich richtigen Seite stünden. Kagame, in seiner monarchistischen Art hauptverantwortlich für die lähmende Erstarrung, die das Land präge, müsse aus der ersten Reihe der Politik zurücktreten und den Weg für eine angstfreie Debatte über die Zukunft Ruandas freimachen.87
Der Brief schlug ein wie eine Bombe. In Windeseile wurde sein Inhalt überall dort bekannt, wo man sich für Politik interessierte. Öffentliche Diskussionen fanden nicht statt. Diejenigen, die ihn gelesen hatten, ergingen sich in Anspielungen, versicherten sich bei ermutigender Reaktion der anderen Seite des politischen Durchblicks, der sich jedoch mit zunehmender Gesprächsdauer schließlich in ein resignierendes, vielfältig einsetzbares »il faut attendre« (wir müssen abwarten) auflöste. Bei dieser Haltung blieb es auch, als das weitere Schicksal Jean Mbandas bekannt wurde. Auf einer Veranstaltung des Übergangsparlaments noch im Mai 2000 wurde er von einem Parlamentsdiener in einen Nebenraum gebeten, Beamte des Geheimdienstes nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gefängnis. Eine Haftzeit mit für ihn ungewisser Dauer begann. Weder hat Mbanda je einen Haftbefehl, noch eine Anklageschrift oder sonst ein offizielles Schriftstück gesehen. Körperlich misshandelt wurde er nicht, aber zur perfiden Verfeinerung der Haftbedingungen hat man ihn, einen Tutsi, der im Völkermord 25 Mitglieder seiner Familie verloren hatte, über mehrere Monate hinweg zusammen mit den Mördern seiner Eltern und Geschwister in eine Zelle gesperrt.88 Verlassen hat er sie erst, eine pure zeitliche Koinzidenz, als Claire Short die Kagame-Regierung mit ihrem Lob bedachte. Die staatliche Repressionsmaschine hatte ihn verschluckt und wieder ausgespuckt, sicher, dass die Lektion gelernt worden ist.
Das Lehrbuch zur »Stabilisierung der ruandischen Demokratie«, wie dessen geistige Väter die eigentlich gemeinte Festigung der FPR-Dominanz in der Übergangsregierung umschrieben,89 sollte indes noch andere Lektionen bereithalten. Mit der nächsten wurde im Frühjahr 2003 begonnen und sie zielte auf die Existenz der Partei MDR ab, die wie die FPR mit dreizehn Abgeordneten im Übergangsparlament vertreten war und schon eine Reihe von Ministern gestellt hatte. Der Premierminister zu jener Zeit, Bernard Makuza, gehörte ebenfalls dieser Partei an, hatte sie aber verlassen, bevor er im März 2000 in das Amt berufen worden war. Vermutlich ahnte er, dass die Partei unter Druck geraten würde, oder es war ihm von anderer Stelle bedeutet worden, dass die Partei in den Fokus einer Untersuchungskommission geraten sollte.90 Jetzt also, gut drei Jahre später, schickte sich die Staatsmacht an, das insgesamt dritte Parteiverbot in der Geschichte des neuen Ruanda zu verhängen. Das erste hatte 1994 die Habyarimana-Einheitspartei MRND betroffen und war eine Selbstverständlichkeit. Für eine Partei, die mit ihrer Miliz, den Interahamwe (diejenigen, die zusammen stehen), den Völkermord ganz besonders mitzuverantworten hatte, war im neuen Ruanda kein Platz. Das zweite hatte 2001 zum Verbot der Parti Démocratique pour le Renouveau (demokratische Partei für Erneuerung/PDR-Ubuyanja) des zurückgetretenen Präsidenten Bizimungu geführt. Die Staatsführung hatte große Mühe, es als unumgängliche Verteidigung staatlicher Stabilität und Einheit erscheinen zu lassen, die Welle der Verhaftungen und die allgemeine Repression gegen PDR-Sympathisanten waren jedenfalls längst nicht mehr getragen von der Legitimation, wie sie noch 1994 bei der Liquidierung der MRND fraglos existierte.91 Und nun der MDR. Der größte Konkurrent der FPR bei den anvisierten Wahlen, allerdings einer mit einer widersprüchlichen Vergangenheit, der sich wegen seiner Parmehutu-Ideologie92 einerseits und seiner konstruktiven Rolle als Koalitionspartner im Staatsneuaufbau nach 1994 andererseits zwischen den Attributen »historisch kompromittiert« und »demokratisch kooperationsfähig« bewegte. Je nachdem, worauf das Augenmerk gelegt wird, war und blieb die Partei der ethnischen Spaltung Ruandas verpflichtet oder ist verlässlicher Teil des neuen Parteienspektrums geworden. Für die parlamentarische Untersuchungskommission war Ersteres der Fall. Im übergeordneten Interesse der Nation erfordere die staatsfeindliche, subversive Haltung des MDR »die sofortige und definitive Lösung« des dadurch aufgeworfenen Problems, erklärte die Kommission.93 An Bernard Makuza, dem langjährigen MDR-Mitglied, lag es dann, in der Presse zu verkünden: »Der MDR ist seit 1959 hauptsächlich verantwortlich für die fortwährenden Tötungen von Tutsi; zwischen 1991 und 1994 war der MDR am Völkermord beteiligt und seitdem hat er seiner Ideologie der Spaltung nicht abgeschworen.«94
Erwartungsgemäß wurde der MDR verboten, jedoch nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, durch Gerichtsurteil,95 sondern in einem schleichenden Verfahren, in dem das gewünschte Ergebnis von vorneherein feststand und das erst später, nachdem der politische Erfolg der verbotsinteressierten Partei FPR, das heißt die Wahlsiege bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, tatsächlich eingetreten war, justiziell abgesichert wurde. Dass dies auf der Grundlage einer gesetzlichen Bestimmung geschah (Artikel 55 der neuen Verfassung), die zur »Tatzeit« noch gar nicht in Kraft war, fiel da schon nicht mehr auf. Die größte Oppositionspartei war jedenfalls rechtzeitig ausgeschaltet worden.
Und damit beginnt die dritte Lektion aus dem Lehrbuch der ruandischen FPR-Demokratie. Sie besagt, dass der politische Gegner ein Feind ist. Allein der Umstand, dass er ein anderes Programm vertritt und dafür wirbt, dass er es wagt, die Staatsmacht zu kritisieren und Alternativen aufzuzeigen, macht ihn zu einer Unperson, von der man sich tunlichst fernhält. Es reicht nicht, dass er lächerlich gemacht und diffamiert wird,96 er muss so nachhaltig besiegt und unschädlich gemacht werden, dass von ihm nie mehr eine Gefahr für die Staatsmacht ausgehen kann. »Manchmal fürchte ich sogar um mein Leben«, gestand Faustin Twagiramungu, Hutu und Gegenkandidat von Paul Kagame bei der Präsidentschaftswahl, in einem Interview, »doch dann denke ich an meine politischen Freunde, die im Krieg und Völkermord getötet worden sind und versuche, die Angst nicht zu groß werden zu lassen. Was mich antreibt, ist meine Zuversicht, bei der Wahl 40 oder 42 Prozent der Stimmen zu bekommen«.97
Twagiramungu erhielt bekanntlich nicht einmal vier Prozent der Stimmen. Dafür verantwortlich war gewiss in erster Linie der Wahlbetrug, aber auch eine aggressiv-erfindungsreiche Propaganda sollte in diesem Sinne wirken. Aufgrund seines langen freiwilligen Exils (in Wahrheit verließ Twagiramungu das Land 1995 nach seinem Rücktritt als Premierminister, weil er um sein Leben fürchtete)98 sei Faustin Twagiramungu ein Mann von gestern, der das Ruanda von heute nicht verstehe, behaupteten die Medien. Und am Abend vor der Wahl meldete das Radio, Twagiramungu habe, zutiefst frustriert über die Aussichtslosigkeit seiner Kampagne und wohl auch eine Haftstrafe fürchtend, das Land bereits wieder verlassen. »Twagiramungus Programm wird sicher im Völkermord enden«, hatte nämlich da schon einer seiner ehemaligen Wahlkämpfer, bevor dieser der FPR beigetreten war, gewarnt, woraufhin andere, die erkennbar schon bei der FPR angekommen waren, in langen Zeitungsartikeln und feinerer Argumentation auf die sofortige Inhaftierung Twagiramungus gedrängt hatten.99
Wie lässt sich das, was dem ehemaligen Premierminister und Präsidentschaftskandidaten Faustin Twagiramungu, was der Partei MDR und ihren Anhängern und dem Abgeordneten im Übergangsparlament, Jean Mbanda, widerfahren ist, mit dem vereinbaren, was Claire Short und andere zu Lobeshymnen hinriss? Wieder stoßen wir auf den Gegensatz zwischen einer Realität, die als hässlich bezeichnet werden kann, und einer Realitätswahrnehmung, die sich auf eine völlig andere Realität zu beziehen scheint. Wenn es Unkenntnis oder Pragmatismus sind, die diese Wahrnehmung bestimmen, wo ist dann die Grenze, von der an Unkenntnis oder Pragmatismus keine legitimierende Wirkung mehr haben? Wann können Erfolge ihr (teilweise) dunkles Fundament nicht mehr verdecken?
»Es gibt eben die afrikanische Form der Demokratie«, lautete der Kommentar des ehemaligen ruandischen Botschafters in Deutschland, Eugène Richard Gasana, dazu.100 Afrikanische Gesellschaften seien politisch noch nicht so entwickelt wie europäische. Viele, so auch die ruandische, seien in einer Situation des Umbruchs, in der das Recht als Zielvorgabe zwar existiere, die alltägliche Praxis aber nach Lösungen verlange, die damit nicht immer in Einklang stünden. Wo die Grenzen so gelagerter Zwänge liegen sollten, behielt er indes für sich, und blieb so ganz in der Tradition eines afrikanischen Politikverständnisses, das sich scheinbar problemlos mit dem Widerspruch zwischen rechtlicher Selbstverpflichtung des Staates und der de facto mangelhaften Umsetzung dieser Verpflichtung arrangiert (man denke hier nur an die Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker von 1981–2004 schon seit Längerem von allen 53 afrikanischen Staaten ratifiziert – auf der einen und an die ernüchternden externen Bewertungen zum Stand der Freiheits- und Bürgerrechte in Afrika auf der anderen Seite).101 Und noch eine zweite Traditionslinie war in der ruandischen Haltung festzustellen, sie betrifft die patrimoniale Macht afrikanischer Big Men und ihre Attribute. War nach den Wahlen 2003 das Verhältnis zwischen Hutu und Tutsi unter den Ministern und Staatssekretären noch ausgewogen (einigen Hutu-Ministern in Schlüsselministerien waren jedoch Tutsi-Generalsekretäre zugeordnet worden – zur Kontrolle, wie kolportiert wurde), stellten Tutsi unter den Provinzgouverneuren, Botschaftern, höchsten Richtern und Offizieren die deutliche Mehrheit bis hin zur ausschließlichen Präsenz. Bis auf ganz wenige Ausnahmen gehörten alle der FPR an.102
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.