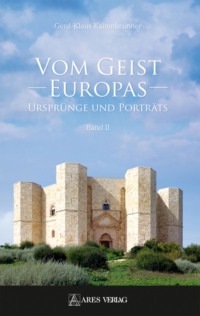Kitabı oku: «Vom Geist Europas», sayfa 2
Der den Kult der Musen als Bürgschaft politischer Harmonie empfehlende Pythagoras setzt seine Rede an die Stadtväter von Kroton mit der Ermahnung fort:
„Fasset das Vaterland als ein Pfand auf, das ihr gemeinsam von der Mehrheit der Bürger empfangen habt. Verwaltet es daher so, daß eure Vertrauenswürdigkeit auf eure Erben übergeht. Dies wird gewiß dann eintreten, wenn ihr euch allen Bürgern gleichstellt und nur in der Gerechtigkeit etwas vor ihnen voraushabt.”
Er begründet abermals diese Forderung nach Gerechtigkeit mit einem Fingerzeig auf den Mythos:
„Denn im Wissen darum, daß jeder Ort der Gerechtigkeit bedarf, erzählen sich die Menschen den Mythos, Themis — die Göttin des Gesetzes — habe dieselbe Stellung neben Zeus wie Dike — die Göttin des Rechts — neben Pluton, dem Gott des Reichtums und Herrscher über die Unterwelt, und wie das Gesetz in den Staaten, damit derjenige, der nicht in Gerechtigkeit seinen Pflichten nachkommt, sich zugleich als Frevler am ganzen Kosmos erweise.”
Abermals fällt an bedeutsamer Stelle das Herzwort pythagoreischer Philosophie: „Kosmos”. Wiederum begründet der Samiote ein staatsbürgerliches Gebot mit Hinweis auf die Gesetze der Weltordnung. Wie im Olympos die Göttin Themis, wie im Hades die Göttin Dike und wie im ganzen Kosmos die Musen herrschen, so sollen Gerechtigkeit und Gesetz im Staat die Könige sein. Wer sich dagegen vergeht, ist nicht nur ein politischer Übeltäter und Schädling, sondern ein „Frevler am ganzen Kosmos”, ein Aufrührer gegen die Ordnung des Weltalls.
Das von Pythagoras kosmomythisch unterbaute Regierungsideal ist weder die Demokratie noch die Tyrannis, sondern eine aristokratische Republik. Pythagoreertum ist von allem Anfang an kämpferischer Elitismus, Bekenntnis zur Aristokratie im wörtlichen Sinne einer „Herrschaft der Besten”. Weder die Masse noch ein despotischer einzelner sollen regieren, sondern eine qualifizierte Elite von solchen, die, obgleich sonst allen Bürgern gleichgestellt, „nur in der Gerechtigkeit etwas vor ihnen voraushaben.” Diesem Staatsideal war der Orden verpflichtet, den Pythagoras gründete. Der Orden, der seine Lehren nicht jedem zugänglich machte, verstand sich als aristokratischer Geheimbund der Musischen, Wissenden und Gerechten.
Wie an die Jünglinge wendet sich Pythagoras auch an den Senat mit sittlichen Imperativen. Hat er den Jugendlichen Ehrfurcht vor dem Alter und Freundessinn gepredigt, so gebietet er den Erwachsenen eine strengere Ehemoral. Die Männer sollten ihre Kebsweiber entlassen:
„Sehet auch ernstlich darauf, daß ihr selbst nur eure eigene Frau kennt und daß die Frau nicht mit anderen das Geschlecht verfälsche… Beherzigt, daß ihr eure Frau wie eine Schutzflehende unter Trankopfern vom Herd aufgehoben und so im Angesicht der Götter ins Haus geführt habt.”
Auch mit dieser zweiten Rede fand der eben erst in Kroton Angekommene Beifall und Nachfolge, wie wir Jamblichos entnehmen können. Die Ratsherren entließen ihre Nebenfrauen, beschlossen die Errichtung eines Musenheiligtums und luden Pythagoras ein, im Tempel des Apollon zu den Knaben und in dem der Hera zu den Frauen zu sprechen.
Zu den noch unmündigen Knaben sagte Pythagoras unter anderem:
„Trachtet ernstlich nach der Bildung (paideia), die von eurem Lebensalter (pais, das Kind) ihren Namen hat. Wer als Knabe gut ist, dem fällt es leicht, sein Leben lang ein edler Mensch zu bleiben. Wer aber in der Kindheit nicht wohlgeraten ist, dem wird es später sauer, es zu werden und zu bleiben. Ja es ist vielmehr unmöglich, von einem schlechten Ausgangspunkt aus gut zum Ziele zu laufen.”
Abermals kommt Pythagoras, der ja in einem Tempel redet, auf die Götter und ihren Kult zu sprechen. Er erinnert daran, wie die Gottheiten vor allem den Kindern hold gesinnt seien. Ein Kind genieße das Vorrecht, jederzeit jeden Tempel betreten zu können. Es würde ja auch immer vorausgeschickt, wenn es darauf ankomme, von den Göttern außergewöhnlichen Beistand frommsinnig zu erflehen. Solcher Gnade müßten sie sich würdig erzeigen. Dies aber vermögen sie am besten dadurch, daß sie den Eltern ehrfürchtig folgen.
Den Frauen, die sich auf Geheiß des Senats im Heiligtum der Hera versammelt hatten, legte Pythagoras ebenfalls dar, wie sie die Götter am geziemendsten ehren können. Er beschwor sie mit eindringlichem Ernst, die lautere Gesinnung am höchsten zu schätzen und nur Opfergaben darzubringen, die sie mit eigener Hand und auf unblutige Weise zubereitet hätten. Wie Zarathustra, den er besucht hatte, und wie Empedokles, der später einer seiner Jünger wurde, empfand Pythagoras einen tiefen Abscheu vor der Befleckung menschlicher Hände und den Göttern geweihter Altäre durch Schlachtopfer:
„Was ihr der Gottheit spenden wollt, das bereitet eigenhändig und bringt es ohne Hilfe von Sklaven an die Opferstätte: Kuchen, Backwerk, Waben und Weihrauchkörner. Mit Mord und Totschlag ehret das Göttliche nicht.”
Es ist offenkundig, daß die pythagoreische Ächtung blutiger Opfer als kannibalischer Bräuche mit der Lehre von der Seelenwanderung zusammenhängt, mit der Idee einer Mensch und Tier umfassenden Gemeinschaft des Lebendigen, durch die dasselbe Blut kreist und die deshalb zu schonen sei.
Hoch dachte Pythagoras, der Apolliniker, von dem religiösen Genius des weiblichen Geschlechts. Die Frauen hielt er für das recht eigentlich zu wahrer Frömmigkeit befähigte, für das von Natur aus zu Götterverehrung bestimmte und selber göttlicher Verehrung würdige Geschlecht. Die vier weiblichen Lebensalter, so lehrte er, seien nicht umsonst nach vier Göttinnen benannt und ihnen zugeordnet:
„Der, den man den Allerweisesten nennt, der die Stimme der Menschen geschaffen und die Namen erfunden hat — war es nun ein Gott, ein Dämon oder ein göttlicher Mensch —, hat in der Erkenntnis, daß das Geschlecht der Frauen am tiefsten zur Frömmigkeit veranlagt ist, jeder Altersstufe den Namen einer Göttin gegeben: die Unverheiratete nannte er Kore, die Verheiratete Nymphe, die Mutter Meter, und die Großmutter in dorischer Mundart Maia …”
Kore, Nymphe, Meter, Maia — alle vier sind Namen göttlicher Wesen: Kore ist die jungfräuliche Tochter der Erdgöttin Demeter; Nymphen sind jene bräutlichen Gottheiten, die, nach Homer (Ilias 20, 4 ff.), „die schönen Haine bewohnen, die Quellen der Flüsse und die blumigen Triften”; Meter ist ein Ehrentitel der aus dem kleinasiatischen Bergland stammenden Magna Mater Kybele; und Maia, unter die Plejaden eingereiht, heißt die Mutter des Götterboten Hermes. Diese Gestalten ahmt, von Stufe zu Stufe fortschreitend, ein erfülltes Frauenleben nach; ja Pythagoras geht sogar so weit, das gesamte weibliche Leben für einen Götterdienst, ein hohepriesterliches Walten anzusehen.
Ähnlich wie in seinen drei vorangegangenen Reden äußert sich Pythagoras vor den versammelten Frauen schließlich zu ganz konkreten Fragen. Hierher gehören nicht nur die schon erwähnten Worte gegen blutige Opfer, in denen bereits der Vegetarismus seines Ordens anklingt, sondern auch seine Verurteilung von Luxus, Mißtrauen und Streit und seine vergeistigte Deutung des kultischen Reinheitsgebots. In manchen Tempeln galt die Vorschrift, daß sie nur von jenen betreten werden durften, die unmittelbar vorher einige Tage lang geschlechtlich enthaltsam gelebt hatten; zumindest sollte vor dem Opfer eine rituelle Reinigung die durch den Beischlaf erfolgte „Befleckung” bannen. Pythagoras hingegen bestritt die Gültigkeit dieser Übung. Aus den Armen des ihr angetrauten Mannes könne die Frau jederzeit noch am selben Tage vor die Altäre treten. Dies sei ihr göttliches Recht. Einer eigenen Sühnung bedürfe es nicht, denn sie sei rein, weil sie doch etwas getan habe, das sogar den Göttern heilig sei. Nur wenn sie ehebrecherisch verkehrt habe, dürfe sie den Tempel niemals betreten.
Pythagoras ist der einzige antike Denker, der nicht nur Mädchen und Frauen philosophisch unterwies, sondern auch zum „Guru” einer weiblichen Ordensgemeinschaft wurde, die gleichberechtigt neben dem pythagoreischen Männerbund wirkte. Jamblichos erwähnt insgesamt siebzehn Pythagoreerinnen namentlich. Bemerkenswert ist, daß etwa ein Drittel der von ihm genannten Frauen aus Sparta stammte oder mit Spartanern verheiratet war. Sparta war aber die einzige griechische Polis, in der die Frauen als dem Manne ebenbürtige Wesen galten. Die bedeutendste Pythagoreerin hieß Theano. Spätere Zeiten, die keinen Sinn für die Eigenart philosophisch angeleiteten bündischen Lebens mehr hatten, erfabelten eine sentimentale Liebesgeschichte, die sich zwischen dem alternden Pythagoras und der jugendlichen Krotoniatin Theano abgespielt habe. Bald wird sie als Schülerin, bald als Gemahlin oder auch als Tochter des Philosophen ausgegeben. Unter ihrem Namen wurden später neben Gedichten und Briefen auch Abhandlungen „Über die Frömmigkeit”, „Über die Tugend” und „Über Pythagoras” in Umlauf gebracht. Sie galt als Bewahrerin und Fortführerin pythagoreischer Lebensform und Geistesart. Clemens von Alexandrien, der um 200 nach Christus lebende Kirchenvater, erwähnt sie in seinen „Teppichen” (1, 16, 80) ehrfürchtig als „die erste Frau, die philosophiert und Gedichte geschaffen habe.” Er hebt auch hervor (ebd. 4, 7, 44), daß Theano von einem Fortleben der Seele nach dem leiblichen Tod überzeugt gewesen sei, indem er ihren Ausspruch zustimmend zitiert: „Es wäre ja das Leben ein wahrer Festschmaus für die Schlechten, die, nachdem sie gefrevelt haben, einfach sterben könnten; aber die Seele ist eben unsterblich.” Bewundernd stellt Clemens die Pythagoreerin Theano in eine Reihe mit vorbildlichen biblischen und griechischen Frauengestalten wie Judith, Esther und Susanna, Atalante, Makaria und Sappho. Sie beweise, so betont der Kirchenvater ausdrücklich, daß das weibliche Geschlecht in gleicher Weise wie das männliche der Vollkommenheit teilhaftig sein könne (ebd. 4, 19, 121).
Mit den vier Reden, in denen keimhaft und anspielungsweise seine Kosmosophie und Ethik enthalten sind, gewann Pythagoras die Sympathien der Bürgerschaft der griechischen Pflanzstadt Kroton. Alsbald scharte sich um den Eingewanderten, der weiterhin vor größeren und kleineren Gruppen Vorträge hielt, eine beträchtliche Gemeinde von Männern, Frauen und Epheben, der sich Einwohner anderer italischer Griechenstädte anschlossen.
Es konnte nicht ausbleiben, daß die Aktivitäten der Pythagoreer, insbesondere ihre betont aristokratischen Ambitionen, von Außenstehenden und politischen Gegnern mit Argwohn und schließlich erbitterter Feindseligkeit beobachtet wurden. Die enge Verbindung von Pythagoreertum und Adelspartei brachte den Orden in ernstliche Schwierigkeiten, als sich allenthalben sowohl demokratische als auch tyrannische Gegenbewegungen formierten. Die antipythagoreische Fronde führten teilweise Männer an, denen es nicht gelungen war, in den engsten Kreis des Bundes aufgenommen zu werden.
Im Jahre 490 stellte sich ein begüterter Mann an die Spitze des Aufbegehrens gegen die pythagoreische Aristokratie. Vor einem Haus, in dem sich Anhänger des Philosophen zu einer Feier versammelt hatten, rottete sich eine wütende Menge zusammen, die das Anwesen stürmte und anzündete. Sämtliche Festgäste, bis auf zwei, fanden den Flammentod. Dem greisen Pythagoras gelang es, mit seiner Familie nach Tarent zu fliehen. Dort lebte er einige Jahre unbehelligt. Große Teile der Mitglieder seines Bundes zerstreuten sich in Gebiete der Magna Graecia, wo ihnen die Herrschaft des Adels noch gesichert erschien. Hier suchten sie die Grundsätze des Bundes zu verwirklichen. Doch alsbald kam es auch dort zu ähnlichen Reaktionen wie in Kroton. Die Pythagoreer wurden allgemein verfolgt. Man bezichtigte sie fälschlicherweise, nach der Tyrannis zu streben, und stellte mit verhetzenden Schlagworten ihre esoterische Lehre als „eine Verschwörung gegen die Massen” dar (Jamblichos 260). Viele von ihnen flohen nach Hellas und möglicherweise auch in entferntere Länder. Denn manche Spuren pythagoreischen Denkens lassen sich später bei den Kelten, den Skythen in Südrußland und bei den im Gebiet des heutigen Staates Rumänien siedelnden Dakern nachweisen. Einer der ersten Schüler des Pythagoras, der Sklave Zalmoxis (oder Zamolxis), ging nach seiner Freilassung zu den mit den Dakern verwandten Geten und arrivierte dort zum Propheten, Gesetzgeber und höchsten Gott.
Als später in Tarent bürgerkriegsgleiche Wirren ausbrachen, mußte der greise Pythagoras nochmals ins Exil gehen. Der Philosoph fand seinen letzten Zufluchtsort in Metapontion, einer ehemaligen sybaritischen Pflanzstadt am tarentinischen Meerbusen. Aber auch dort kam es zu grausamen Ausschreitungen. Wieder massakrierte ein wütender Pöbel Pythagoreer, die sich in einem Hause versammelt hatten; nur wenige entkamen der Lynchjustiz, unter ihnen Pythagoras, der bald darauf starb. Nach Timaios von Tauromenion wurde Pythagoras neunundneunzig Jahre alt. Andere — meist spätere — Autoren geben ihm eine Lebensdauer von 75, 80, 82, 90, 104 oder sogar 117 Jahren. Sein Tod in Metapontion, wo er auch begraben sein soll, entbehrt nicht einer tiefen Symbolik. Dieser zutiefst apollinische Philosoph vollendete sein langes Leben in eben der Stadt, in der sich zwei große, noch zur Zeit seines Wirkens erbaute Apollontempel befanden; doch das Haus, das er zuletzt bewohnt hatte, widmeten die Metapontiner der Erd- und Muttergöttin Demeter, die vor allem von den Pythagoreerinnen verehrt wurde. Jamblichos sagt in seiner von mir schon wiederholt herangezogenen Pythagoras-Vita, die ich als ein evangeliengleiches Buch betrachte:
„Die Metapontiner behielten Pythagoras, auch als er nicht mehr unter den Lebenden weilte, im Gedächtnis, weihten sein Haus zum Heiligtum der Demeter und machten aus dem Gäßchen, an dem es stand, ein Musenheiligtum.”
Pythagoras war, wenn wir nicht allzu genau rechnen, ein Zeitgenosse Zarathustras, Konfuzius’, Buddhas, der Propheten Altisraels und des halblegendären römischen Priester-Königs Numa. Diese Gleichzeitigkeit hat nicht erst Karl Jaspers als „Achsenzeit” erkannt. Schon hundert Jahre vor ihm sprach der heute leider fast vergessene Münchner Geschichtsphilosoph Ernst von Lasaulx von dem „merkwürdigen Zusammentreffen” so herausragender Gestalten in einer Epoche tiefgreifender religiös-ethischer Wandlungen sowohl in Asien als im Mittelmeerraum.
Pythagoras gehört zu den Stiftern europäischer Geistigkeit. Der aristokratische Bundes-Gedanke, die kosmosophische Esoterik und der harmonikale Grundzug seiner Lehre haben ebenso wie die Seelenwanderungs- und Zyklentheorie und die ausgesprochene Frauenfreundlichkeit seines Ordens mächtig durch die Jahrtausende gewirkt. Diese Wirkungsgeschichte ist ein Thema für sich, das ich demnächst in einem eigenen Buch, an dem ich seit 1986 arbeite, ausführlich entwickeln werde. Sie gehört zu den erregendsten Abenteuern in der Welt der Ideen und beweist, daß Pythagoras zu den unveralteten, weil zu stets neuen Verwandlungen und Wiedergeburten drängenden Großmächten Europas zählt. Seine spirituelle Autorität wird alle Ideologien unseres Zeitalters überdauern. Sein Sternbild ist immer noch im Steigen begriffen. Ich vertraue in diesem Punkt auf das gelassene Bekenntnis des alten Goethe, der, auf seine Weise, zur Bruderschaft der Pythagoreer gehörte:
„Gewinnt auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrigbleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine andere Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Überzeugungen fragt, oder wo diese sich bei verbreitetem allgemeinen Licht auch wieder hervorwagen dürfen.”
(1987)
Sokrates
Das schöne Wagnis, den Tod vom Leben her zu verstehen
Sokrates allein, der uns glauben lassen könnte, daß der Mensch gottähnlich sei, predigte Philosophie; alle anderen predigten nur ihre beschränkten Systeme. Er lehrte die Menschen, daß Philosophie in jedem gesunden Kopfe, in jedem reinen Herzen wohne, und daß sie die Quelle einer allgemeinen und unzerstörbaren Glückseligkeit sei.
Frans Hemsterhuis (1721 - 1790)
Von dem geistreichen Amerikaner Emerson stammen die Worte: „Aus Platon kommen alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen werden.” Der britische Logiker, Mathematiker und Kosmologe Whitehead stimmte in diesen Hymnus ein, als er augenzwinkernd die gesamte europäische Philosophie eine Abfolge von Fußnoten zu den Platonischen Dialogen nannte. Dies gilt auch für Systeme, Bewegungen und Schulen, die in allgemeinen nicht zum „Platonismus” gerechnet werden. Ohne Platon keine Augustinus, kein Eckhart, kein Erasmus, kein Galilei, kein Rousseau, kein Kant, kein Schiller, kein Schopenhauer, kein Solowjow, kein Kardinal Newman, kein Heisenberg und auch kein Sigmund Freud. Der Sokrates-Schüler Platon war und ist Quelle, Vorbild und Archetyp auch dort, wo Wege gebahnt werden, die aus dem Bereich griechischer Metaphysik hinausführen sollen. Gibt es im Werk des Anti-Platonikers Nietzsche einen wesentlichen Gedanken, für den sich bei Platon keine Entsprechung aufweisen ließe? Sogar für den „Übermenschen”, den „Willen zur Macht” und die „Ewige Wiederkehr” lassen sich Pendants in den Dialogen des Griechen leicht finden. Vielleicht kann man sogar die Titelgestalt von „Also sprach Zarathustra” als einen trunkenen Sokrates mit antiplatonischer Maske begreifen. Wieviel bewußter, wieviel verschwiegener Platonismus steckt doch im antipositivistischen Affekt der „Frankfurter Schule”, vor allem in den Lehren Herbert Marcuses, oder auch — am andern Ende des geistespolitischen Spektrums — im Ganzheitsdenken Othmar Spanns!
Jeder von uns hat schon von Platon gehört, wohl auch irgendeinmal von „platonischer Liebe” geredet, häufiger freilich von irgendwelchen „Ideen” — damit einen der Grundbegriffe des Philosophen gedankenlos im Munde führend. Nachdenklichere ahnen höchstwahrscheinlich auch, daß sich hinter dem Namen Platon ein riesiger Erdteil verbirgt, ja ein ganzer Kosmos von Einsichten, Eingebungen und Grundsätzen, und daß es sich wohl lohnte, ihn zu erkunden und aus seinen Schätzen zu schöpfen. Haben nicht sogar noch in allerjüngster Gegenwart Georg Picht, Carl Friedrich von Weizsäcker, Günter Rohrmoser und der leider viel zu wenig als eigenständiger Sozialphilosoph gewürdigte Österreicher Ernst Karl Winter eindringlichst daran erinnert, daß hier, trotz jahrtausendelangen Abbaus, unerhörte Vorräte lagern, die planmäßig zu erschließen uns weiterbringen würde?
Platon zu lesen, gibt es somit manche Gründe. Ein letzter sei noch genannt, weil er die Brücke zu dem Band bildet, dessen Anschaffung und Lektüre hier empfohlen werden soll: Es gibt, vertrauenswürdigen Berichten zufolge, nach wie vor Männer und Frauen unter uns, die auf die Frage, mit welchem Autor man die letzten Stunden am besten bestehen könne, als einzigen Platon nennen. Welches seiner Werke aber könnte dafür angemessener sein als der Dialog „Phaidon”, in dem auch der sterbende Schriftsteller Charles Sealsfield geblättert hat? „Lest den ‚Phaidon’!” sagte noch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein Philosoph zu den Seinen, als er das Zeitliche segnete; und ein anderer zu sich selbst: „Ja, mit Sokrates muß es gehen.”
„Phaidon” — das Werk ist benannt nach einem der Lieblingsschüler des Sokrates. Er war zugegen, als der Meister im Jahre 399 vor Beginn der christlichen Zeitrechnung gelassen den Giftbecher leerte. Es war an einem frühen Abend; der Sonnenuntergang nahte zwar bereits, doch lag noch Licht auf den Bergen. Vorher aber hatte sich Sokrates gründlich gebadet, um „den Frauen keine Umstände zu machen, die Leiche zu waschen”. Als ihn der Vollstreckungsbeamte daran erinnerte, daß nun die Stunde des Abschieds gekommen sei, weinte er — nicht aber der Todeskandidat. Welcher Scharfrichter oder Kerkermeister kann zartfühlender sein als dieser namenlose Mann, der zum Verurteilten sagte: „Ich habe dich kennengelernt als den edelsten, sanftmütigsten und besten Menschen von allen, die jemals hierher gekommen sind, und auch jetzt weiß ich sicher, daß du mir nicht zürnst — denn du kennst die Schuldigen.”
Wenn man dies im „Phaidon” liest, denkt man unwillkürlich an die Hinrichtung eines anderen Unschuldigen, von der es im Lukas-Evangelium heißt: „Als der Hauptmann dies gesehen hatte, pries er Gott und sagte: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!” Dem Leser bleibe es überlassen, weitere Parallelen zu entdecken zwischen dem letzten Freundesgespräch des Sokrates, das Platons „Phaidon” überliefert, und den Abschiedsreden Jesu, wie sie die Johannes-Passion festhält. Es gibt deren mehrere, nur eine einzige Ähnlichkeit sei noch kurz erwähnt: das Unverständnis der Jünger, der griechischen wie der galiläischen. Mit einem Unterton bitterer Ironie sagt Sokrates, er hoffe, für seine ihm lauschenden Freunde überzeugender gewesen zu sein, als bei seiner Verteidigung für die ihm feindlichen Richter. Am Ende muß er illusionslos erkennen, daß trotz menschlicher Nähe und geistiger Anteilnahme nicht einmal der engste Kreis ihm vorbehaltlos zu folgen vermag. Damit vergleiche man das wehmütige Wort beim letzten Abendmahl: „So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?”
Diese Andeutungen mögen genügen, um den Rang des Platonischen Dialogs „Phaidon” zu kennzeichnen. Keineswegs soll der Sohn der Phainarete mit dem Sohn Marias, der seinem „Daimonion” getreulich folgende Sokrates mit dem menschgewordenen Gotteswort gleichgestellt werden. Nicht nur theologische Gründe verbieten ein derartiges Unterfangen, sondern schon ein von allen dogmatischen Rücksichten unbeeinflußter biographisch-physiognomischer Takt. Sokrates wurde nicht gefoltert und nicht gekreuzigt. Während der ans Marterholz genagelte Jesus seine Verlassenheit hinausschrie, behielt Sokrates bis zuletzt seine philosophische Ruhe und empfahl mit hintergründiger Heiterkeit, dem heilkundigen Gott Asklepios einen Hahn zu opfern. Üblicherweise tat man dies zum Dank für eine Genesung. Nietzsche unterstellte, daß der sterbende Sokrates damit angedeutet habe, das Leben als solches sei eine Krankheit, der Tod aber die gründlichste Kur. Das ist jedoch falsch. Nietzsches polemische Behauptung läßt sich gerade durch eine aufmerksame Lektüre des „Phaidon” (und der meisterlichen Einführung von Barbara Zehnpfennig zur jüngsten Ausgabe) entkräften.
Keiner Gleichsetzung von Sokrates und Jesus soll hiermit das Wort geredet sein, sondern bloß einer — wie der Fachausdruck lautet—„typologischen” Vergleichung. Diese aber hat ein langes und ehrwürdiges Herkommen. Sie reicht von dem frühchristlichen Apologeten und Märtyrer Justinus, der vor seiner Bekehrung Platoniker gewesen war, bis zu dem protestantischen „Magus in Norden”, Johann Georg Hamann aus Königsberg, dem Verfasser „Sokratischer Denkwürdigkeiten”, und dem rheinländischen Katholiken Ernst von Lasaulx, der als Sproß vom Stamme Schellings, Görres’ und Baaders in Würzburg und München lehrte. Sogar den erst 1974 verstorbenen kulturkonservativen Außenseiter Gerhard Nebel muß man diesem Chor zurechnen. Sie alle stimmen darin mit Theodor Haecker überein, daß es ein „adventistisches Heidentum” gab, zu dem neben Cicero, Seneca und Vergil auch Heraklit, Pythagoras und insbesondere Sokrates gehören. Mit Hamann sind sie davon überzeugt, „daß wir die Wolke dieser Zeugen nicht verachten sollen, daß sie der Himmel zu seinen Boten und Dolmetschern salbte, und zu eben dem Beruf unter ihrem Geschlecht einweihte, den die Propheten unter den Juden hatten.”
Man kann oft hören, daß Griechentum und Christentum, Jerusalem und Athen, attische Philosophie und biblischer Prophetismus zu den bleibenden Grundlagen europäischer Kultur gehören. Wenn diese fast zum geflügelten Wort gewordene Aussage keine unverbindliche Floskel sein soll, dann müßte wenigstens eine geistige Elite sich dazu aufraffen, neben dem „Gastmahl” und der „Politeia” auch Platons „Phaidon” zu lesen.
Der „Phaidon” findet sich selbstverständlich in allen deutschen Platon-Ausgaben. Deren berühmteste ist immer noch die Schleiermacher’sche. Die Patina, die seit längerem darüber liegt, verleiht ihr zwar einen gewissen nostalgischen Reiz, erschwert aber streckenweise das Verständnis des ursprünglichen Sinns. Moderner ist die Edition von Otto Apelt aus den zwanziger Jahren, die der Felix Meiner Verlag in anerkennenswerter Weise vor kurzem als wohlfeilen Reprint neu auf den Markt gebracht hat. Am wenigsten kostet wohl die kartonierte Einzelausgabe des Reclam Verlags.
Die allerjüngste Edition aber sei den anspruchsvolleren Platon-Lesern und Sokrates-Neugierigen ans Herz gelegt. Sie sei hier am meisten empfohlen — nicht weil sie der neueste Versuch einer „Phaidon”-Übertragung ist, sondern aufgrund ihrer qualitativen Vorzüge. Erstens enthält sie sowohl den griechischen Urtext als auch den deutschen Wortlaut. Zweitens zeichnet sich die Übersetzung — bis auf zwei oder drei Ausdrücke, bei denen man vielleicht eine andere Formulierung bevorzugen könnte — ebenso durch treffsichere Genauigkeit wie durch ansprechende Eleganz aus. Drittens ist hervorzuheben, daß die Übersetzerin Barbara Zehnpfennig eine mehr als dreißig Seiten umfassende Einleitung geschrieben hat, die mit energischen Strichen einige weitverbreitete Sokrates-Bilder gründlich berichtigt. Viertens hat sie dem Text weitere dreißig Seiten mit Anmerkungen beigefügt, die den Leser nicht nur über biographische und geistesgeschichtliche Details, mythologische Anspielungen und Dichterzitate gediegen unterrichten, sondern auch die philosophischen Grundaussagen des Dialogs sorgfältig freilegen. Und fünftens ließ sie sich’s nicht nehmen, den Band mit umfangreicher Bibliographie und gründlichem Register der Eigennamen wie Begriffe (griechisch und deutsch!) zu versehen. Dies sei ausdrücklich hervorgehoben, weil inzwischen sogar namhafte Verlage solche für wissenschaftliche Arbeit unerläßlichen Dienstleistungen entweder schludrig oder überhaupt nicht erbringen. Alles in allem kann man ohne Überteibung sagen, daß die jüngste Ausgabe des Meiner Verlags preiswert ist und es dem Käufer leichtmacht.
Das Lesen kann und will sie ihm natürlich nicht ersparen. Warum aber soll man Platon und ausgerechnet den „Phaidon” lesen, der ja, anders als das „Symposion”, so etwas wie eine philosophische Henkersmahlzeit darstellt? Um diese Frage zu beantworten, könnte ich auf das zu Beginn Gesagte zurückgreifen und mich auf viele autoritative Eideshelfer stützen. Whitehead und Emerson bilden ja nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges europäischer Platon-Begeisterung. Ich könnte von „Phaidon” als einem der großen Bücher der Weltliteratur sprechen, ihm kanonischen Rang bescheinigen, ihn als philosophischen Evergreen erweisen. Aber dies wäre nichts Neues, das hat man vielleicht schon zu oft getan. Der Deutsche, der Mitteleuorpäer des Jahres 1991 zeigt wenig Gewogenheit, abendländisch-kulturkonservativ tönenden Empfehlungen zu trauen. Der fernsehende, zeitunglesende und mit gräßlichen Tagesnachrichten gemästete Normalverbraucher, der, wie bekannt, das Gros unserer kritischen Intellektuellen stellt, wittert nichts als drohende Langeweile, wenn ihm jemand die Lektüre Platons oder auch Franz von Baaders zumutet. Deshalb sei nicht viel Zeit und Raum damit verschwendet, um zu beweisen, warum man eine fast zweieinhalb Jahrtausende alte Schrift mit Gewinn lesen kann. Was will es einem abgestumpftem Geschlecht schon besagen, daß die heiligen drei Könige durch einen Stern, der heilige Paulus durch einen Blitz, der heilige Augustinus aber durch ein Buch berufen wurde, durch den wunderbaren Weckruf: „Tolle, lege”, „Nimm und lies!” Warum noch lesen, außer um sich zu „informieren” oder um etwas zu „erleben” oder um „gebildet” zu scheinen?
Aber gibt es nicht noch ein ganz anderes, wenngleich seltenes, ein im wahrsten Sinne des Wortes „erlesenstes” Lesen? Die allermeisten Bücher lesen wir, wie gesagt, um uns zu unterrichten oder um uns zu unterhalten. Einige Titel aber sind rarer als Inkunabeln aus der Offizin des Aldus Manutius, weniger verbreitet sogar als Papyrusrollen aus Nag Hammadi oder Pergamente der Merowingerzeit. Es sind dies Bücher, die mit den andern eigentlich nur den Namen gemeinsam haben. Umgekehrt als die üblichen Bücher lesen nicht wir sie, sondern sie lesen uns. Es sind königliche oder, wie man in der vorchristlichen Antike anstandslos gesagt hätte, göttliche Bücher, die nicht nur von uns gelesen werden, sondern die in uns lesen und uns überhaupt erst zu Lesern anspruchsvollster Art werden lassen. Es ergeht uns in der Begegnung mit Büchern dieser kostbarsten Art ähnlich wie dem Dichter vor dem archaischen Standbild des Apollon: „… denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.” Man fühlt die einsetzende Verwandlung bisweilen sofort, meistens jedoch erst im Laufe der Lektüre. Möglicherweise ist es anfänglich bloß ein diagonales Lesen, dann wird es ein Schmökern, hin und wieder regt sich sogar halb belustigter, halb entrüsteter Widerwille: War Sokrates womöglich doch ein Verrückter? Wie kann ein reifer Mann seine letzte Stunde damit vergeuden, daß er begriffsstutzigen Jüngern Argumente für die Unsterblichkeit der Seele unterbreitet? Was soll die Darlegung der Ideenlehre und der Anamnesistheorie angesichts des Schierlingsbechers? Es sind dies naheliegende Einwände, und ich gestehe, daß sich auch mir solche spöttischen Fragen aufgedrängt haben.
Aber dann kommt alles ganz anders. Man versinkt und wird zugleich getragen. Man kommt sich selbst abhanden, entgleitet der eigenen Gewöhnlichkeit, schämt sich der vorlaut geäußerten Beanstandungen, wird demütig und ineins erhoben, beschwingt und leicht wie selten zuvor. Eben habe ich noch zu lesen geglaubt; mich hier und da über das Protokoll eines antiken Abschiedsgesprächs sogar lustig gemacht; mir desgleichen manches wiederholt, was seit Nietzsches Tagen kleinlich, herablassend, empört oder denunziatorisch dem alten Platon angekreidet worden ist. Schließlich hat der aufgeklärte Leser schon in jungen Tagen etliche Lektionen von Karl R. Popper, Ernst Topitsch und einigen andern Entlarvern der „philosophia perennis” erhalten. Das stimmt, und ich gebe auch heute noch zu, daß manches davon durchaus bedenkenswert ist. Insbesondere das, was der leider nur Verfassungsjuristen, Staatsrechtlern und Rechtstheoretikern bekannte Hans Kelsen (1881 - 1973) dem Platon am Zeuge geflickt hat, ist nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Dies alles sei zugegeben und auch an dieser Stelle mit Bedacht festgehalten. Aber im Vergleich zu den Augenblicken der Verwandlung, die dem hingerissenen „Phaidon”-Leser widerfuhr, hat solche Kritik plötzlich weniger Gewicht als früher. Eingangs bewunderte er vor allem die dialektische Wendigkeit des unermüdlichen Debatters Sokrates, der seine halb pythagoreisch, halb materialistisch infizierten Gesprächsteilnehmer wahrlich „unter-redet”, mit seinen logisch-axiomatischen Netzen und feingesponnenen Unterscheidungen niederringt Alsbald hörte diese Art von Bewunderung zwar nicht auf, doch wurde sie übertroffen von einem tiefer greifenden Erstaunen, jenem Erstaunen, das Sokrates selbst in einem anderen Dialog als Ursprung des Philosophierens bezeichnet hat.