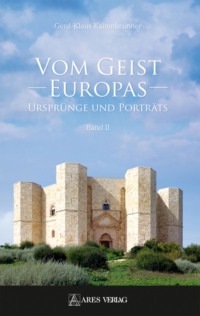Kitabı oku: «Vom Geist Europas», sayfa 3
Staunend begann der die „Phaidon”-Übersetzung von Barbara Zehnpfennig Lesende aufzuhorchen und zu horchen und nochmals zu horchen. Er lauschte dem Sokrates, während abendliches Sonnenlicht auf den Bergen rings um Athen lag. Luther soll gesagt haben, er würde auch dann noch ein Bäumchen pflanzen, wenn in der nächsten Stunde die Welt unterginge. Nun, Sokrates hatte einmal freimütig bekannt (horribile dictu!), daß ihm Bäume nicht sehr viel zu sagen hätten. Er pflanzte stattdessen Gedankenkeime in die Intelligenz Athens, vor allem aber jätete er kräftig das Unkraut der Gedankenlosigkeit aus. Bildung bestand für ihn nicht darin, möglichst viel zu wissen. Bildung heißt zuallererst: zu wissen, wovon man selber spricht und was man ständig stillschweigend voraussetzt, ohne es bewiesen zu haben, vielleicht auch ohne es jemals zu können.
Wunderbar sind die im Zusammenhang damit dargelegten Gedanken über die geistverderbende „Misologie” — was im Griechischen sowohl Rede- und Wortfeindschaft als auch Sinn- und Vernunftfeindschaft bedeutet. Wer dieser Geisteskrankheit, die jede sachbezogene Erörterung von vornherein verhindert, soweit wie möglich entgehen will, muß sich an Sokrates’ von ihm selbst bis zum letzten Atemzug vorgelebte Lebensregel halten: Bevor du den „logoi” — den Worten und Sinngehalten — Widersprüche unterstellst, suche diese in dir; wenn dir etwas unverständlich erscheint, dann sage nicht voreilig, daß es absurd sei, sondern gib vorerst einmal deinem eigenen Unverstand die Schuld. Wer dies einmal sich zu Herzen genommen hat, wird kaum behaupten wollen, daß das — von wenigen Schriften abgesehen — bei Platon durchgängig von Sokrates geübte Verfahren dialogischer Wahrheitssuche bloß ein artistischer Kniff sei. Sokratische Dialogik erscheint dann nicht als etwas Äußerliches, Zufälliges und Formales, sondern als Wesenszug der Philosophie dieses seltsamen Mannes, der — ähnlich wie Buddha, Pythagoras und Jesus — nur mündlich gelehrt, aber kein einziges Buch geschrieben hat. Das dialogische Vorgehen, in dem ein Menschlich-Allgemeines sich bis zu hellster Weißglut läutert, bringt Hölderlins schöner Vers auf die kürzeste Formel: „Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander.” Sokrates, der, wie Christus und Dionysos, bei Hölderlin immer wieder anwesend ist, manchmal namentlich ungenannt, aber bildkräftig beschworen:
Die ewigen Götter sind
Voll Lebens allzeit; bis in den Tod
Kann aber ein Mensch auch
Im Gedächtnis doch das Beste behalten,
Und dann erlebt er das Höchste.
Nur hat ein jeder sein Maß.
Denn schwer ist zu tragen
Das Unglück, aber schwerer das Glück.
Ein Weiser aber vermocht es
Vom Mittag bis in die Mitternacht,
Und bis der Morgen erglänzte,
Beim Gastmahl helle zu bleiben.
Diesem Sokrates horchte ich zu, wie einer Stimme, die zu mir spricht Mit einem Male verstand ich, was das skandalöse Wort bedeuten könne, daß die rechten Philosophen „nichts anderes betreiben als zu sterben.” Ich ahnte, was Sokrates wohl meint, wenn er, mythische Bilder aufgreifend, von den Läuterungsverfahren in der Unterwelt und von den „reinen Wohnungen” der Seligen spricht. Und unversehens kam mir wieder der Titel eines Buches von Herbert Keßler in den Sinn, das er dem in Bammental bei Heidelberg lebenden Betriebswirtschaftslehrer und Ordnungstheoretiker Walter Thoms in sokratischer Verbundenheit gewidmet hat: „Das schöne Wagnis” … Von diesem spricht nämlich der das irdische Leben halb feierlich, halb ironisch verabschiedende Sokrates. Nachdem er von Tempeln erzählt hat, in denen statt der Götterbilder wirkliche Gottheiten gegenwärtig, und von „schöneren Wohnungen”, die nach dem Tode den wahren Philosophen zugedacht seien, fügt er hinzu: „Schon um dessentwillen muß man alles tun, um an Trefflichkeit und Vernunft im Leben Anteil zu haben. Denn schön ist der Preis und die Hoffnung groß. Allerdings fest zu behaupten, daß sich das so verhält, wie ich es vorgetragen habe, gehört sich nicht für einen vernünftigen Menschen. Daß es jedoch diese oder eine ähnliche Bewandtnis haben muß mit unseren Seelen und ihren Wohnungen, da doch die Seele offenbar todlos ist, das scheint sich mir zu gehören und wert zu wagen, daß man glaube, es verhalte sich so — denn schön ist das Wagnis; und man muß sich damit wie mit Beschwörungen selbst heilen …”
Es ist auch ein schönes Wagnis, den uralten und immer wieder neuen, durch kundige Übersetzung erfrischend verjüngten, aber nirgendwo billig aktualisierten „Phaidon” zu lesen. Einer von dem hellenistischen Dichter Kallimachos festgehaltenen Legende zufolge hat sich einer der allerersten Leser dieses Platonischen Dialogs das Leben genommen, indem er ausrief: „Sonne, leb wohl!” Nun, er hat offenbar des Sokrates eigene Warnung überlesen, daß man nicht davonlaufen solle, da wir Menschen nicht uns selbst gehören, sondern den Göttern. Gewiß, Philosophie ist Sterbenlernen, Einübung in die ars moriendi, wie Sokrates mehrmals herausfordernd erklärt, wobei man ihn sich freilich nicht griesgrämig, sondern lächelnd vorstellen muß. Philosophie ist Sterbenlernen, das richtige Leben aber eines der Philosophie. Das bedeutet aber keineswegs Vorbereitung auf den Selbstmord als zerebraler Dauerauftrag. Es bedeutet auch nicht „Sein zum Tode” im Stil Martin Heideggers oder Weltflucht nach Art einer gnostizistisch verdrehten Asketik. Eher darf man dabei schon an „Euthanasie” im ursprünglichen und schuldlosen Wortverstand denken: an leichten Tod, der dankbar, gelassen oder auch neugierig empfangen wird, nachdem für den Grabstein zwei Inschriften erdacht worden sind — für die Vorderseite: „Einmal und nie wieder!”, für die Rückseite: „Nun geht’s erst richtig los!” Sowenig das apollinische Gebot „Erkenne dich selbst!” eine Aufforderung zu hypochondrischem auf der Lauer Liegen vor der Höhle des eigenen Befindens enthält, sowenig ist platonisch vermittelte Sokratik morbide Verliebtheit in den Tod. Sie ist, wie keinem genauen Leser entgehen kann, weniger eine abgesonderte Lehre mit genau festgesetzten Inhalten, denn eine kritische Methode, bereits angebotene Erklärungsversuche durch vernünftige Unterredung zu prüfen, zu ordnen und zu begründen. Und Philosophie als Einübung ins Sterben ist dann bloß eine drastische Formel für das, was die unaufgebbare Voraussetzung geistiger Kultur ist. Sie ist der Inbegriff eines von triebhaftem Zwang losgelösten, zur zuchtvollen Beherrschung (nicht Ausrottung) der unteren Mächte fähigen Lebens. Sie ist tätige Kontemplation, asketische Humanität, Aufbruch ins Wesentliche oder, wie man noch zu Goethes Zeit zu sagen wagte, die Bestimmung des Menschen, sofern er sich nicht damit begnügen will (und er kann es eigentlich gar nicht), bloß eine zoologische Spezies zu sein.
Sokrates, wie ihn Platons „Phaidon” zeichnet, verkörpert zum ersten Male in der uns bekannten Geschichte ein Menschentum, das einerseits vom heiligen Ernst unablässiger Wahrheitssuche, andrerseits von einer bis zuletzt sieghaften Heiterkeit erfüllt ist — wobei diese als zarteste und zugleich unbezwingbare Blüte philosophischer Anstrengung erscheint. Freudigen Ausdruck findet in ihr die lebensgeprüfte Erfahrung dessen, der jenseits der Angst steht, weil er einer gründenden Wahrheit gewiß ist, die, auch wenn das Schlimmste geschieht, von keiner Bosheit und Lüge getrübt zu werden vermag. Der in dieser Wahrheit gründende Märtyrer darf sagen: „Morior, ergo sum”, „Ich sterbe, also bin ich” — denn das, was sterben kann, ist gar nicht das im Gleichnis des „Ich” gemeinte Eine, Unversehrbare und Ewige. Was absterbend vergeht, ist nicht „Ich” und bin ich nicht. Tod bedeutet nicht Untergang, sondern Freilegung des ideenhaften Prinzips in uns. Wer den „Phaidon” aufmerksam liest, wird sich davon überzeugen können, daß Philosophieren in sokratisch-platonischem Stil, entgegen modernistischen Vorurteilen, nicht das geringste mit Weltverachtung, Leibfeindschaft und Todesdienst zu tun hat. Es nimmt allerdings, unabhängig von konfessioneller Bindung, das biblische Wort sehr ernst, das Luther so übersetzt hat: „Und was nutz hette der Mensch / ob er die gantze Welt gewünne / Und verlüre sich selbs / oder beschediget sich selbs?” (Lukas 9, 25) Solche Übereinstimmung gibt zu denken, wie bereits im vorangehenden angedeutet. Auch wenn es eine neuere Theologie nicht wahrhaben will, halte ich daran fest, daß Christentum und Platonismus, ungeachtet der verschiedenen Ebenen, nicht bloß durch einen absonderlichen Zufall jahrhundertelang Verbündete waren. Dies gilt keineswegs nur für die von griechisch-byzantinischem Geisteserbe durchsäuerte Welt der Ostkirche, sondern auch für den römisch-germanisch-keltisch geprägten „Westen”. Das beweisen Augustinus, Boethius, Johannes Scotus Eriugena, Anselm von Canterbury (der aus Aosta stammt), Pico della Mirandola, Leibniz, Novalis, Friedrich Schlegel, Maine de Biran, Othmar Spann, Amadeo Silva-Tarouca, Louis Lavelle, Michele Federico Sciacca und viele andere.
Doch kehren wir zurück zu Sokrates’ Testament „Phaidon”, diesem Buch, dem das Vorrecht zukommt, in uns zu lesen, uns zu prüfen und — im glücklichsten Falle — uns zu guten Lesern zu bilden! Man kann oft hören, daß Philosophie wirklichkeitsfremd sei. Doch dies trifft nur in oberflächlichstem Sinne zu. Ist das menschliche Herz, weil es tief unter unserer Haut schlägt, deshalb ein lebensferner und überflüssiger Körperteil? Dem durch „Phaidon”-Lektüre zum besinnlichen, zum andächtigdankbaren Leser gewordenen Zeitgenossen wird die Antwort nicht schwerfallen: Platons Philosophie ist mitsamt ihrem sokratischen Herzen keine überlebte Philosophie des Todes, sondern eine lebenbildende Philosophie des Lebens, welche Schlußfolgerung auch die „Phaidon”-Herausgeberin Barbara Zehnpfennig zieht: „Denn die Suche nach der Erkenntnis der Form ist nicht Verachtung des Stoffs; sie ist Ausdruck des Willens, den Stoff zu verstehen. Das Streben nach Vernunft ist nicht Verachtung des Körpers; es ist Ausdruck des Willens, mit dem Körper und dem Körperlichen vernünftig umzugehen. Vernunft ist aber das Transcendens schlechthin, die Ewigkeit in der Zeit. So ist das vernünftige Dasein … ein ‚Sein zum Leben’, das das Leben nicht vom Tod, sondern den Tod vom Leben her versteht.”
(1991)
Cicero
Staatsmann, Humanist und Repräsentant altrömischer Religiosität
I.
Ich komme aus anderen Zeiten Und hoffe in andre zu gehn.
Franz Grillparzer
Marcus Tullius Cicero lebte von 106 bis 43 vor Christus. Er war Advokat, Quästor, Ädil, Prätor, Konsul und Statthalter in der im Südosten Kleinasiens gelegenen römischen Provinz Kilikien. Durch eine Reihe aufsehenerregender Prozesse, in denen er bald als Ankläger, bald als Verteidiger auftrat, erlangte er schon früh den Ruf eines überragenden Juristen und Meisters der öffentlichen Rede. Berühmt wurde er durch sein Vorgehen gegen Catilina und dessen Mitverschwörer, deren Putschversuch er schonungslos enthüllte und, ausgestattet mit allen Mitteln der Staatsgewalt, niederschlug und ahndete. Obwohl er zeitweilig der erste Mann in Rom war und im Laufe seiner politischen Karriere zu den höchsten Ämtern aufstieg, kam bereits im Altertum die staatsmännische Tätigkeit, für die Cicero selbst am meisten Anerkennung erheischte, am schlechtesten weg. Die Unterdrückung der Catilinarier in seinem Konsulatsjahr, die er für das bedeutendste Ereignis seit der Gründung Roms hielt, trug ihm alsbald die Ächtung und Verbannung aus der Hauptstadt ein. Auch nachdem ihm wieder die Rückkehr aus dem Exil erlaubt worden war, blieb er, der als „Vater des Vaterlandes” in die Geschichte einzugehen den Ehrgeiz hatte, auf Jahre hinaus erzwungenermaßen ein politisch einflußloser, ein kaltgestellter Mann.
In der Politik gilt einzig und allein der Erfolg. Cicero aber stand so gut wie immer auf der „falschen” Seite, wenn er sich politisch engagierte. Er verpaßte den „Zug des Zeitalters”, in dem Catilina eine folgenlose Episode war, während Cäsars Stern sich im Aufstieg befand und die Umwandlung der von Bürgerkriegen erschütterten aristokratisch-konservativen Republik zu einer imperialen Einmannherrschaft mit populistischer Fassade unverkennbare Fortschritte machte. Als Mitglied des Ritterstandes galt er der den Senat beherrschenden Nobilität als bloßer „homo novus”, als unebenbürtiger Emporkömmling. Da auch Cäsar und Crassus bei dem Umsturzversuch Catilinas ihre Hände im Spiel gehabt hatten, kam ihnen Ciceros Demaskierung der Hochverräter ungelegen. Als dann Cäsars Bündnis mit Pompejus zerbrach, schlug sich Cicero, nach einem gescheiterten Vermittlungsversuch zwischen den ehemaligen Triumvirn, auf die Seite des Pompejus, der in der Schlacht bei Pharsalos besiegt wurde. Von Cäsar nach einem Jahr begnadigt, widersetzte er sich dessen Diktatur und hegte zugleich die Illussion, als sein kritischer Berater und doppelzüngiger Lobredner das Schlimmste verhüten, das heißt: Cäsar auf den republikanischen Tugendpfad zurückbringen zu können. Als er schließlich enttäuscht einsehen mußte, daß dieses Unterfangen vergebliche Liebesmüh war, weil Cäsar sogar daranging, nach der Königswürde zu greifen und sich vergotten zu lassen, näherte sich Cicero, um es vorsichtig zu formulieren, der anticäsaristischen Fronde seines Freundes Brutus. Wenngleich er nicht in die Attentatspläne eingeweiht war, weil die Verschwörer dem Redner und Anwalt nicht genügend Mut, Entschlossenheit und Ausdauer zutrauten, so läßt sich eine gewisse intellektuelle Mittäterschaft Ciceros an den Iden des März kaum leugnen. Abermals hatte der für die Wiederherstellung der überlieferten republikanisch-senatorischen Ordnung sich stark machende Politiker auf das falsche Pferd gesetzt. Zwar wurde Cäsar ermordet, aber nicht Brutus und Cassius traten an seine Stelle, sondern vorderhand das zweite Triumvirat der Cäsar-Anhänger Antonius, Lepidus und Octavian und schließlich Octavian allein, der spätere Kaiser Augustus, unter dessen Herrschaft, wie bekannt, Jesus zu Bethlehem geboren wurde.
Immer wieder schlug sich Cicero auf die falsche, die hinterher unterlegene Seite. Bis zuletzt gehörte er zur Partei der Blamierten und Besiegten, zu den, um es modern zu sagen, rückwärtsgewandten und restaurativ eingestellten Konservativen oder sogar Reaktionären, die den Gang der neuen Zeit nicht begreifen können oder wollen. Einem obsoleten, geschichtlich überholten und untergangsreifen Staatsideal anhängend, das in Ciceros Fall allerdings gerade nicht die Monarchie, sondern die Republik war, blieb ihm keine Mißgunst, Niederlage und Demütigung erspart. Nachdem er sich mit seinen (am Vorbild von Demosthenes’ Philippika ausgerichteten) Kampfreden gegen Marcus Antonius als Feind der neuen Machthaber bloßgestellt hatte und endlich auch seine Versuche, sich mit dem jungen Octavian zu verständigen, endgültig gescheitert waren, blieb Cicero nichts übrig, als wieder einmal den Rückzug auf eines seiner Landgüter anzutreten, deren berühmtestes Tusculanum in der Nähe des heutigen Städtchens Frascati war.
Hier gedachte er, wie schon in früheren erzwungenen politischen Mußepausen, seine philosophisch-literarischen Neigungen zu pflegen, um wenigstens als Schriftsteller auf die öffentliche Meinung einwirken zu können, auf die er als geächteter und zum Rückzug gezwungener Magistrat keinen unmittelbaren Einfluß mehr hatte. Vielleicht träumte der über Sechzigjährige auch davon, fern vom Lärm der Hauptstadt an einem idyllischen Zufluchtsort sein Leben als musischer Privatmann beschließen zu dürfen. Doch sogar die Erfüllung dieses Wunsches nach einem ungestörten Asyl blieb Cicero versagt, ähnlich wie schon früher seine Ehen mit Terentia und der erheblich jüngeren Publilia in Brüche gegangen waren und er den Tod seiner ebenso gebildeten wie zartsinnigen Lieblingstochter Tullia zu betrauern hatte. Als Augustus, Lepidus und Antonius daran gingen, eine Säuberung zu inszenieren, der alle Mitschuldigen an Cäsars Tod zum Opfer fallen sollten, beharrte, entgegen dem versöhnlicher gestimmten Augustus, der Triumvir Antonius darauf, daß Ciceros Name auf die Proskriptionsliste gesetzt werde. Die Hatz auf politisch mißliebige Gegner mit Sondertribunalen, Denunziantentum und Büttelwesen, mit Beschlagnahme des Vermögens, Erklärung zur Unperson und brutaler Liquidierung ohne Umschweife, wie sie bereits Sulla massiv betrieben hatte, war damit ein weiteres Mal eröffnet. Der lästige Cicero sollte aus dem Weg geräumt werden. Er galt als krimineller Dissident, Regimekritiker und unheilbar diskreditierter Anhänger des dem Tode geweihten altrepublikanischen „Systems”. Sein Bruder und Neffe — beide flüchtig — waren im Zuge des sich flächenbrandartig ausdehnenden mörderischen Terrors von oben bereits durch gedungene Häscher niedergemetzelt worden. Sippenhaftung, Lynchjustiz und zur unbeschönigten organisierten Rache herabgekommene Staatsbehörden standen auf der Tagesordnung.
In der Politik gibt es, wie man sieht, seit den alten Römern und vielleicht schon seit Hammurapi nichts Neues unter der Sonne. Dies gilt im Guten wie im Bösen. Haben wir nach mehr als zweitausend Jahren, die seither verflossen sind, andere grundsätzlich mögliche Staatsverfassungen zur Verfügung als bereits Aristoteles mit seiner Dreizahl von Monarchie, Aristokratie und Demokratie, denen die je arteigenen Verfallsformen Autokratie (Tyrannis), Oligarchie und Ochlokratie (Pöbelherrschaft) oder Anarchie entsprechen? Alles schon dagewesen. Das Repertoire ausdenkbarer und ausführbarer Modelle herrschaftlich geordneten menschlichen Miteinanderlebens ist offenbar überaus beschränkt. Sogar die Utopien, die so ehrgeizig sind, den Bereich paradigmatischer Staats- und Gesellschaftsformen auszudehnen, sind in der Ausmalung alternativer Muster monoton. Wer zwei oder höchstens drei gelesen hat, kennt alle. Ob Morus, Campanella oder Andreae, ob Morelly, Cabet oder Fourier, ob Bellamy, Morris oder Marcuse — eine gleicht der andern mit langweiliger Regelmäßigkeit. Ganze Legionen utopischer Entwürfe wiederholen bloß, bewußt oder unbewußt, das fade Schema von zwei oder drei Urformen. Auch der umstürzlerischste Neuerer steht unter dem Bann verschwindend weniger Exempel, die er eintönig wiederholt. Sogar der rücksichtsloseste dernier cri ist nichts als ein ausgeleiertes altes Lied, das allenfalls eine Zeitlang vergessen war. Die neuerungssüchtigsten Revolutionäre sind auch nur Repetenten, oft ahnungslose Vollstrecker einer Wiederkehr des Ältesten, das sie abgetan, muffig und ewiggestrig wähnten.
Cicero hat das am eigenen Leibe erfahren. Schon damals war, was Rom erschütterte und seine ehrgeizigen Bestrebungen grausam zuschanden werden ließ, überhaupt nichts Neues. Zweifelsfrei steht fest: Als Politiker zählt Cicero zu den Pechvögeln. Diejenigen Taten, auf die er bisweilen bis zu prahlerisch eitler Ruhmredigkeit am stolzesten war, erwiesen sich als Fiasko. Selbst jene Leistungen, die kurzfristig erfolgreich ausfielen, brachten ihm am Ende wenig ein. Seine edlen Absichten galten nichts. Sogar wenn ihm staatlich etwas vorübergehend gelang, wurde alsbald ein Strick daraus, den seine Gegenspieler ihm drehten. Cicero, dem es als Rhetor vergönnt war, ein lateinischer Demosthenes zu werden, scheiterte kläglich mit seinem Plan, den Rang eines römischen Perikles zu erringen. Er endete als politischer Bankrotteur, dem alles mißlang. Er machte in unüberbietbarer Weise Pleite, weil er nicht nur seine republikanischen Ideale zusammenbrechen sah, sondern auch das Scheitern seiner Staatskunst mit dem eigenen Leben bezahlen mußte. Auch das ist nichts Neues unter der Sonne: Vae Victis!, Wehe den Besiegten!
Das fortschrittsselige neunzehnte Jahrhundert hat daraus geschlossen, daß Cicero früher maßlos überschätzt worden sei. Vor allem in Deutschland wurde von Hegel bis Mommsen der Römer als seichter Versager, ärgerlicher Pfuscher und oberflächlicher Epigone abgekanzelt. Mommsen tat ihm den Schimpf an, ihn einen „Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht” zu nennen, der ein „aus seinen Kreisen verschlagener Feuilletonist” gewesen sei. So wenig Sympathie empfand der große deutsche Historiker, der doch selbst nach der Niederlage der demokratisch-nationalen Revolution von 1848 zu den Verfolgten gehört hatte, für den gescheiterten Verteidiger der römischen Republik gegenüber übermächtigen autokratischen Tendenzen, daß er dessen Gegner Cäsar, den Totengräber der republikanischen Verfassung, zum „demokratischen General” stilisierte, während er Cicero nicht einmal guten Willen bescheinigte.
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem insbesondere die Deutschen in einer seit dem Fall Karthagos beispiellosen Weise zu den Besiegten gehören und, entgegen der inflationären Zunahme sich „Republiken” nennender Staaten, der Sinn für republikanische Freiheit und Würde allenthalben rückgängig ist, kann der auf der Verliererseite placierte Cicero wohl wieder mit etwas mehr Zuneigung oder wenigstens Milde rechnen. Inzwischen haben wir einige historische Lektionen erhalten, die drastisch bezeugen, daß die erfolgreich in den Rang von Weltseelen zu Pferde — so Hegel über Napoleon in einem Brief an Niethammer vom 14. Oktober 1806 — aufgerückten Agenten und Macher großer Politik die Erde in eine planetarische Schädelstätte verwandelt haben. Wir wissen auch, daß in dem, was unterlag, scheiterte und vertilgt wurde, Keime des Besseren enthalten sein können. Obwohl von der zur tellurischen Katastrophe avancierenden Weltgeschichte beiseite geschleudert und zermalmt, verkörpern sie in ihrer hingeopferten Ohmacht einen Einspruch gegen das sich steigernde Grauen. Wir verstehen besser als frühere Generationen den stolzen Ausspruch von Ciceros Zeitgenossen Cato Uticensis, ebenfalls eines Besiegten, der den Untergang der Republik durch Cäsars Sieg mit dem stoisch gefaßten Freitod beantwortete: Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni — wenngleich diese Sentenz, die ein Friedrich Gentz sich zu seinem Lebensgrundsatz zu eigen gemacht hat, einer Gesellschaft, die Fahnenflucht als allgemeines Menschenrecht verkündet, doch wieder so befremdlich oder sogar schockierend klingen muß wie die alten Verse vom Soldaten auf verlorenem Posten:
Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm’ ich gesund nach Haus.
Doch verhalte es sich damit im einzelnen wie immer, so scheint Ciceros Untergang am 7. Dezember 43, zwanzig Jahre nach seinem Triumph über die Verschwörung des Catilina, heute wohl mehr Betroffenheit und Anteilnahme auszulösen als vor wenigen Generationen, die darauf vertrauten, daß Bürgerkrieg, Massenmorde und Rachejustiz zu den Greueln längst überwundener Zeitalter gehörten. Ich zitiere den Bericht des Plutarch:
„Indessen kamen die Mörder schon heran, der Centurio Herennius und der Kriegstribun Popilius, den Cicero einst, als er wegen Vatermordes unter Anklage stand, vor Gericht verteidigt hatte; beide begleitet von ihren Schergen. Da sie die Türen verschlossen fanden, schlugen sie sie ein, und da kein Cicero zu sehen war und die Leute drinnen sagten, sie wüßten nichts, da soll ein junger Mensch, der von Cicero in den höheren Wissenschaften ausgebildet worden war, ein Freigelassener seines Bruders Quintus mit Namen Philologos — der ‚Wortfreund’ —, dem Kriegstribunen verraten haben, daß sein ehemaliger Lehrmeister in einer Sänfte durch dichtgewachsene, schattige Laubengänge zum Meer hinuntergetragen werde. Der Kriegstribun nahm einige Leute mit und rannte herum zum Ausgang, während Herennius im Lauf durch die Laubengänge eilte. Cicero bemerkte sein Kommen, befahl den Trägern, die Sänfte an Ort und Stelle niederzusetzen, und schaute selbst, indem er nach seiner Gewohnheit die linke Hand ans Kinn legte, mit starrem Blick auf die Mörder, von Staub bedeckt, mit ungeschorenem Haar und Bart, das Gesicht von Gram verzehrt, so daß die meisten sich verhüllten, als Herennius ihn abschlachtete. Cicero erhielt den tödlichen Hieb in den Hals, den er aus der Sänfte hervorstreckte, im vierundsechzigsten Lebensjahr. Dann schlugen sie ihm, gemäß Antonius’ Befehl, den Kopf und die Hände ab, mit denen er die Philippischen Reden geschrieben hatte; denn so hatte Cicero seine Reden gegen Antonius betitelt, und sie heißen noch heute so.
Als die abgeschnittenen Teile nach Rom gebracht wurden, war Antonius gerade dabei, Wahlen zu leiten. Kopf und Hände ließ er über den Schiffsschnäbeln auf die Rednerbühne des Forums — der Rostra — aufstecken: ein scheußlicher Anblick für die Römer, die freilich nicht Ciceros Antlitz zu sehen glaubten, sondern ein Abbild der Seele des Antonius.”