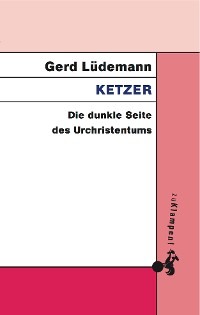Kitabı oku: «Ketzer», sayfa 3
Doch begnügte sich Tertullian nicht mit dem Argument der Prozesseinrede, sondern bemühte sich auch um eine hier nicht weiter darzustellende, äußerst genaue, umfängliche Widerlegung der Monarchianer, Markioniten und der geläufigen Spielarten der Gnosis.26
Karl Holl hat Tertullians antiketzerische Arbeitsweise so beschrieben:
»Für jede Meinung findet er einen Kontrast, um sie lächerlich zu machen. Er hat auch über dieses Mittel freimütig bekannt:›Wenn man da und dort lacht, so wird man damit nur der Sache hier gerecht werden. Manche Dinge sind es wert, auf diese Weise widerlegt zu werden, damit man ihnen nicht durch die ernsthafte Behandlung Verehrung zollt‹.«27
Es ist daher kein Zufall, dass dieser Charakter, als er Montanist war und gegen die römische Kirche kämpfte, die einst von ihm so hoch gepriesenen kirchlichen Liebesfeiern (Apol 39,16 – 21) in den Schmutz zog.28 Und als der römische Bischof Kallist grundsätzlich das Recht des Bischofs festschrieb, Todsündern (d. h. Unzuchtsündern) Vergebung zu gewähren, löste das bei Tertullian scharfen Protest aus.29 Bei seinem Charakter nimmt es nicht wunder, dass Tertullian sich zuletzt sogar von den Montanisten getrennt und eine eigene Sekte gegründet hat.30
III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Irenäus und Tertullian
Während Tertullian die Rechtsgrundlage der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Gnosis bestreitet, akzeptiert Irenäus die Gnostiker als Disputanten über die Schrift, da ihre Bekehrung nicht ausgeschlossen sei. Er schreibt z. B.: »Wir wollen … die Reden des Herrn anführen, ob wir nicht vielleicht durch Christi Lehre einige von ihnen überzeugen … können«. (Haer III 25,7). Irenäus will allein mit der Schrift siegreich sein; Tertullian lehnt das ausdrücklich ab. Bei ihm gibt eine »der Schrift und Exegese übergeordnete Instanz … den Ausschlag. Die Schrift bleibt folglich aus dem Disput, und eine Berufung der Gnostiker auf sie wird nicht zugestanden.«31 Er weigert sich also strikt, zum Zweck der Urteilsfindung mit den Ketzern zusammen auf den Text selbst zurückzugehen.
Doch müssen bei beiden Kirchenvätern gleichfalls außertheologische Gesichtspunkte ins Spiel gebracht werden, die ihnen bei ihrer Polemik die Feder geführt haben mögen. Ohne sie würden wir das, was damals wirklich vorging, nicht verstehen.32
Besonders verdächtig schien Tertullian die weitgehende »Demokratisierung« unter den gnostischen Christen. Er schreibt hierüber:
»Ich will nicht unterlassen, auch von dem Wandel der Häretiker eine Schilderung zu entwerfen, wie locker, wie irdisch, wie niedrig menschlich (sic!) er sei, ohne Würde, ohne Autorität, ohne Kirchenzucht, so ganz ihrem Glauben entsprechend. Vorerst weiß man nicht, wer Katechumene, wer Gläubiger ist, sie treten miteinander ein, sie hören miteinander zu, sie beten miteinander – und der Heide auch mit, wenn er etwa dazukommt; sie werfen ihr Heiliges den Hunden und ihre, wenn auch unechten, Perlen den Säuen hin. Das Preisgeben der Kirchenzucht wollen sie für Einfachheit gehalten wissen, und unsere Sorge für dieselbe nennen sie Augendienerei. Was den Frieden angeht, so halten sie ihn auch unterschiedslos mit allen. Es ist in der Tat auch zwischen ihnen, obwohl sie abweichende Lehren haben, kein Unterschied, da sie sich zur gemeinschaftlichen Bekämpfung der einen Wahrheit verschworen haben. Alle sind aufgeblasen, alle versprechen die Erkenntnis. Die Katechumenen sind schon Vollendete, ehe sie noch Unterricht erhalten haben«. (Praescr 41).
Ein besonderes Ärgernis stellten die ketzerischen Frauen dar. Über sie schreibt er im unmittelbaren Anschluss:
»Und selbst die häretischen Frauen, wie frech und anmaßend sind sie! Sie unterstehen sich zu lehren, zu disputieren, Exorzismen vorzunehmen, Heilungen zu versprechen, vielleicht auch noch zu taufen«. (ebd.).
Ein anderer Punkt, der seinen besonderen Widerstand erregte, war der laxe Umgang der Gnostiker mit Autorität und besonders dem Bischofsamt.33 Darüber schreibt er:
»So ist denn heute der eine Bischof, morgen der andere; heute ist jemand Diakon und morgen Vorleser; heute einer Priester und morgen Laie; denn sie tragen die priesterlichen Verrichtungen auch Laien auf«. (Praescr 41).
Eine solche Vorstellung war auch Irenäus unerträglich, der seit 178 n. Chr. Bischof der Gemeinde von Lyon und Vienne war. Sein striktes Festhalten daran, dass der Vater Jesu Christi und der Schöpfer der Welt identisch seien, mag auch politisch mitbedingt gewesen sein. Die Vorstellung vom Ordnungsgefüge in der Gemeinde und vom Ordnungsgefüge im Himmel entsprachen einander. Wäre im Himmel Raum für einen unbekannten Gott gewesen, hätte das zugleich die Gefahr bedeutet, dass die Gemeinde ins Wanken geraten könnte. Und eine demokratische Kirche, wie sie bei den Ketzern im Ansatz vorhanden war, widerstritt vollends der Vorstellung eines patriarchalischen Gottes.
Und schließlich vertraten beide Ketzerbestreiter mit Nachdruck die Auferstehung des Fleisches, Irenäus sogar in ihrer chiliastischen Variante.34 Das begründeten sie in ausführlichen Exegesen von 1Kor 15 und relativierten dabei vergeblich 1Kor 15,50 (»Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben«)35, um den von ihnen bekämpften gnostischen Paulusschülern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hatte dieses unangenehme Pochen auf der fleischlichen Auferstehung Jesu und der Gläubigen sowie – nicht zu vergessen – der Ungläubigen (zum Verdammungsgericht)36 nicht auch eine politische Dimension? Wurde doch mit ihr eine klerikale Autorität erst geschaffen.
Nun wäre es sicher verfehlt, theologische Grundsätze direkt auf politische Überzeugungen zurückzuführen. Die religiöse Wirklichkeit ist komplizierter, und die Annahme einer direkten Bedingtheit der Theologie durch die Gesellschaft ist zu simpel. Immerhin beleuchtet der Hinweis auf die Konsequenzen der Theologie für die Politik eine Dimension, um die es in dem Streit zwischen Tertullian und Irenäus auf der einen und den gnostischen Ketzern auf der anderen Seite auch ging.
Gleichzeitig sieht man daran, dass und wie die entstehende katholische Kirche ein viel leichteres Auskommen mit dem Staat haben konnte (und umgekehrt) als die alles in Frage stellenden Ketzer, die in ihrer religiösen Suche und Neugierde eine stete Gefahr für das geschlossene System eines Irenäus und Tertullian darstellten.
Kapitel 3:
Wie aus Ketzerbestreitern Ketzer wurden oder: Die Jerusalemer Judenchristen in den ersten beiden Jahrhunderten
Historische Abgrenzungen. Das Problem der Kontinuität
Äußerlich lassen sich zwei Phasen des Jerusalemer Christentums unterscheiden, die Zeit vor dem Jüdischen Krieg im Jahre 70 n. Chr. und die Zeit danach, die den Jerusalemer Christen ein weiteres Verweilen in der jüdischen Metropole kaum mehr erlaubte, weil mit der Zerstörung des Tempels durch Heiden der heilige Ort auf Dauer geschändet worden und so ein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen war.
Wie die Jerusalemer Christen die heilige Stadt der Juden verlassen haben, ist umstritten. Eine dogmatisch motivierte Antwort bietet der Kirchenvater Euseb im 4. Jh. Er schreibt darüber Folgendes in seiner Kirchengeschichte (= KG) III 5,2 f (die entsprechenden Bibelverse, die Euseb im Blick hat, sind in Klammern gesetzt):
(2) »Als nun nach der Himmelfahrt unseres Erlösers (Apg 1,9) die Juden zu dem Verbrechen an dem Erlöser (sc. als Schuldige an seinem Tode: 1Thess 2,15; Mk 15,6 – 15) auch noch die höchst zahlreichen Vergehen an seinen Aposteln begangen hatten, als zunächst Stephanus von ihnen gesteinigt (Apg 7,58 f), sodann nach ihm Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes, enthauptet (Apg 12,2 f) und schließlich Jakobus, welcher nach der Himmelfahrt unseres Erlösers zuerst den bischöflichen Stuhl in Jerusalem erhalten hatte, auf die angegebene Weise beseitigt worden war1, als die übrigen Apostel nach unzähligen Todesgefahren, die man ihnen bereitet hatte, das Judenland verlassen hatten und mit der Kraft Christi, der zu ihnen gesagt hatte: ›Geht hin und lehrt alle Völker in meinem Namen!‹ (Mt 28,19) zur Predigt des Evangeliums zu allen Völkern hinausgezogen waren, (3) als endlich die Kirchengemeinde in Jerusalem in einer Offenbarung, die ihren Führern geworden war, die Weissagung erhalten hatte, noch vor dem Krieg die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Peräas, namens Pella, niederzulassen, und als sodann die Christgläubigen von Jerusalem weggezogen waren, und weil damit gleichsam die heiligen Männer die königliche Hauptstadt der Juden und ganz Judäa völlig geräumt hatten, da brach zuletzt das Strafgericht Gottes über die Juden wegen der vielen Freveltaten, die sie an Christus und seinen Aposteln begangen hatten, herein und vertilgte gänzlich dieses Geschlecht der Gottlosen aus der Menschengeschichte.«
Der übergreifende Zusammenhang ist die dogmatische Aussage, dass die Zerstörung Jerusalems eine Strafe Gottes gegen die vielen »Untaten« der ungläubigen Juden gegen Jesus und seine Apostel war.2 In sie flicht Euseb die auf Überlieferung zurückgehende Einzelnachricht3 ein, dass die Christen vor dem Krieg die Weissagung erhielten, Jerusalem zu verlassen und in Pella Wohnung zu nehmen. Damit ist eine klare Trennung erreicht zwischen den Guten, die bisher eine Katastrophe verhindert haben, und den »Bösewichtern«, die in der Stadt bleiben und jetzt, da die heiligen Männer Jerusalem und überhaupt ganz Judäa verlassen haben, bestraft werden können.
Doch erregt hier wie sonst in der Geschichte ein Bericht von einem derart eindeutigen Verlauf das Misstrauen. Folgende Fragen stellen sich:
1. Wie alt ist und von wem stammt die Überlieferung vom Auszug der Urgemeinde nach Pella? Antwort: Sie dürfte auf Aristo von Pella (= Anfang des 2. Jh.s) zurückgehen (vgl. Euseb, KG IV 6,3 f) und setzt voraus, dass die Gemeinde in Pella geblieben und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist.
2. Gibt es auch konkurrierende Traditionen? Das ist zweifellos der Fall. Der aus Palästina gebürtige Judenchrist Hegesipp verfasste in der zweiten Hälfte des 2. Jh.s ein fünfbändiges Werk »Hypomnemata«. Von ihm sind umfangreiche Fragmente in Eusebs Kirchengeschichte erhalten, in denen Hegesipp klar erkennbar von einer Kontinuität der Jerusalemer Gemeinde ausgeht.
3. Ist es vorstellbar, dass die Gesamtheit der Jerusalemer Gemeinde noch so kurz vor dem Krieg hätte fliehen können? Kaum. Verfechter der Historizität der Pella-Nachricht sind daher auch gezwungen, den Auszug vorzudatieren, z. B. ins Jahr 62, unmittelbar nach der Ermordung des Jakobus.
4. Wenn Pella anerkanntermaßen eine heidnische Stadt war, ist es dann überhaupt denkbar, dass dort eine judenchristliche Gruppe Zuflucht erhalten hätte? Die Frage ist zu verneinen.
An anderer Stelle4 habe ich diese Fragen ausführlicher behandelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Tradition eines Auszugs der Urgemeinde von Jerusalem nach Pella unhistorisch und die Gründungslegende der Pellenser Kirche ist, die sich mit ihr von der Jerusalemer Gemeinde herleitete. Jetzt möchte ich die These insoweit ergänzen, dass unmittelbarer Anlass der Entstehung dieser Überlieferung die Erzählung einzelner Jerusalemer Judenchristen gewesen sein mag, die in der Tat kurz vor dem Krieg Jerusalem verlassen hatten, ebenso wie andere Juden auch (vgl. Josephus, Ant XX, 256/Bell II 279: Ende 64 n. Chr., mit dem Amtsantritt des Gessius Florus, haben Juden Jerusalem verlassen).5 Diese Christen hätten dann später in Pella einen bleibenden Wohnort gefunden.
Jedenfalls bedeutete die Zerstörung des Tempels einen tiefen Einschnitt für die damalige Jerusalemer Gemeinde (und ebenfalls für die »nichtchristlichen« Juden). Ihre Nachfahren lebten in der Zukunft zersplittert an verschiedenen Orten: in Pella, Kokabe, Nazareth und im syrischen Beröa. Ein Teil der Urgemeinde aus Jerusalem sowie Teile des palästinischen Christentums dürften nach Kleinasien übergesiedelt sein (vgl. nur die Töchter des Philippus [Apg 21,8 f], von deren Ephesus- bzw. Hierapolis-Aufenthalt spätere Schriftsteller berichten [Polykrates von Ephesus bei Euseb, KG III 31,3 und Papias von Hierapolis, ebd., III 39,9]). Und schließlich ist die Möglichkeit nicht völlig von der Hand zu weisen, dass judenchristliche Restgruppen Jerusalemer Herkunft nach einiger Zeit wieder in Jerusalem ansässig geworden sind.
Die Nachricht Eusebs (KG IV 5,2), bis zur Niederwerfung der Juden unter Hadrian seien in Jerusalem 15 Bischöfe einander gefolgt und alle von Geburt Hebräer gewesen, sollte man zugunsten der zuletzt angeführten Möglichkeit nicht ins Spiel bringen, denn diese Überlieferung ist aus zwei Gründen anzuzweifeln. Erstens hat angeblich der Nachfolger des Jakobus und zweite Bischof, Symeon, bis ca. 115 n. Chr. den Bischofsthron innegehabt.6 Dann aber ist es unwahrscheinlich, dass in der verbleibenden Zeit bis zum Aufstand unter Hadrian, d. h. in 20 Jahren, 13 Bischöfe regiert haben. Zweitens sagt Euseb im gleichen Atemzug, er habe »über die Jahre der Bischöfe in Jerusalem keine schriftliche Nachricht ausfindig machen können«. (KG IV 5,1). Das macht die ganze Bischofsliste nicht glaubwürdiger. Vermutlich stammt sie überhaupt vom heidenchristlichen Bischof Narzissus, Anfang des 3. Jh.s, oder von seinen Anhängern7, denn für die zweite Periode bis zu ihm führt Euseb in einem Schematismus8 gleichfalls 15 heidenchristliche Bischöfe auf (IV 5,1 – 4; V 12).
Die Leitungsfunktion der Verwandten Jesu. Das Schicksal der Judenchristen
Jakobus, der Herrenbruder, war die Autorität in der späteren Phase der Jerusalemer Gemeinde. Nach seiner Ermordung im Jahre 62 übte ein Vetter Jesu, Symeon, bis zur trajanischen Zeit (= 98 – 117) die Leitung des »Jerusalemer« Gemeindeverbandes aus. Allerdings wird nicht recht deutlich, ob sich sein Sitz in Jerusalem befand. Hegesipp setzt dies zwar voraus (bei Euseb, KG IV 22,4), weil er an der Kontinuität der Amtsinhaber auf dem Jerusalemer Bischofsstuhl interessiert ist9, doch ist das aus allgemeinen historischen Gründen unwahrscheinlich. Wir wissen nur, dass nach der Ermordung des Jakobus zu einem bestimmten Zeitpunkt Symeon sein Nachfolger wurde, und zwar, weil er mit Jesus verwandt war.
Unter Trajan, so berichtet Hegesipp (bei Euseb, KG III 32,3), erlitt Symeon im Alter von 120 Jahren den Märtyrertod. Er muss also in Palästina eine bekannte Gestalt gewesen sein. Das gleiche gilt für die Enkel des Judas, der ein Bruder Jesu war. Sie wurden Hegesipp zufolge (bei Euseb, KG III 20,1 – 6) vor Kaiser Domitian geführt, aber wegen ihrer Harmlosigkeit in Freiheit gesetzt. Am Schluss der Erzählung heißt es:
»Sie aber erhielten nach der Freilassung, da sie Bekenner und Verwandte des Herrn waren, führende Stellungen in der Kirche. Nachdem Frieden geworden war, lebten sie noch bis Trajan«. (20,6).
Und schließlich besitzen wir ein weiteres Zeugnis über das Ansehen der Verwandten Jesu in Palästina, wenn es bei Euseb, KG I 7,14 (im Exzerpt aus Julius Africanus) heißt: »Die Herrenverwandten breiteten sich von den jüdischen Dörfern Nazareth und Kokabe aus über das übrige Land …«10 Man kann es kaum für einen Zufall ansehen, dass die Heimat der Herrenverwandten, Kokabe, und der Ort, wo zahlreiche Judenchristen wohnten, denselben Namen haben.11 Vielmehr deutet das auf eine Vereinigung beider Gruppen hin, die ja ohnehin wahrscheinlich ist, da der Herrenbruder Jakobus die Leitung der (judenchristlichen) Gemeinde Jerusalems innehatte.
Von den anderen (Heiden-)Christen getrennt, waren die Ebioniten und Herrenverwandten auch von den jüdischen Brüdern separiert und gerieten sozusagen zwischen die Stühle der zunehmend heidenchristlich werdenden Kirche und des sich neu formierenden jüdischen Synagogenverbandes.
Durch die Zerstörung Jerusalems hatten auch die jungen heidenchristlichen Kirchen ihren durch Jesus und die Jerusalemer Gemeinde (!) gesetzen Mittelpunkt verloren; ein neuer etablierte sich mit der römischen Gemeinde, die unter Berufung auf Petrus und Paulus (1Clem 5) bald einen Führungsanspruch erhob und ihn innerhalb eines Jahrhunderts auch durchsetzte.
Erst in der zweiten Hälfte des 2. Jh.s entdeckten einzelne Heidenchristen das Heilige Land wieder neu (Bischof Melito von Sardes besuchte um 160 n. Chr. Jerusalem [vgl. Euseb, KG IV 26,14])12, aber da war es für eine Rehabilitierung der Jerusalemer Christen schon zu spät; sie waren zu ebionitischen Ketzern geworden. Auch im Verhältnis zu ihren jüdischen Brüdern ging es ihnen nicht besser. Wenn sie beispielsweise am Synagogengottesdienst teilnehmen wollten, mussten sie fürchten, dass man bei der Rezitation des Achtzehnbittengebetes den Spruch gegen die Häretiker auf sie beziehen würde.13
Teil I: Das Jerusalemer Judenchristentum vor dem Jüdischen Krieg
Ich zeichne im Folgenden die dramatische Vorgeschichte des Jüdischen Kriegs nach.14 Das Auftreten Jesu hatte durch seine Kreuzigung ein Ende gefunden. Die Motive für die Hinrichtung durch den Römer Pilatus lagen darin, dass er Jesus für einen politischen Aufrührer hielt, den es kaltzustellen galt. Die Kreuzesinschrift »Der König der Juden«. (Mk 15,26) zeigt, wie Jesu Wirken als politisches verstanden werden konnte.
Und doch bedurfte es für die Überstellung Jesu durch die jüdische Behörde an die Römer eines besonderen Grundes. Dieser dürfte in Jesu Haltung zum Tempel zu finden sein.15 In den ntl. synoptischen Evangelien steht der Auftritt Jesu im Tempel (Mk 11,15 – 19 parr) in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner späteren Hinrichtung. Wohl ist nicht ohne weiteres klar, was Jesus mit der Aktion – ihre Historizität vorausgesetzt – bewirken wollte.
a) War sie als Tempelreinigung gedacht? Aber wer wird das Vertreiben der Händler und Verkäufer und das Umstoßen der Tische der Geldwechsler und Taubenhändler so auffassen können?
b) War sie als Tempelreform zu deuten? Aber dazu passt nicht, dass sie gar nicht den ganzen Tempel, sondern nur einen kleinen Bezirk betraf.
c) Jesu Aktion im Tempel dürfte eher eine symbolische Handlung sein, die auf etwas anderes hindeutet (vgl. die Zeichenhandlungen der atl. Propheten.16 Jesus versuchte, zeichenhaft den Tempelkult aufzuheben. »Diese Aufhebung aber geschah nicht, um den Tempelkult zu reformieren oder seine (weitere) Profanisierung zu stoppen, sondern um einem ganz neuen Tempel, dem eschatologischen und damit von Gott erwarteten, Platz zu machen.«17
Voraussetzung dieses Verständnisses ist zweierlei: 1) Jesus hat in wörtlichem Sinn das Umstürzen (Mk 11,15) verstanden, das auf den ganzen Tempel zielte; 2) er hat damit die Hoffnung auf einen neuen Tempel verbunden, wie sie sich im Judentum in verschiedenen Ausprägungen findet (Jes 60,13; Mi 4,1 – 2; Hag 2,6 – 9; Tob 14,7; 1Hen 90,28 f).
Ein weiterer Reflex der Tempelkritik Jesu findet sich im Bericht über seinen Prozess. Vgl. Mk 14,58: »Wir haben gehört, dass er gesagt hat: ›Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist‹.« Die jesuanische Herkunft dieses Tempellogions ist sehr wahrscheinlich, umso mehr, als Mk 14,57 es ausdrücklich als Falschzeugnis darstellt (vgl. Apg. 6,14, wohin es – zur Entschärfung? – vom Vf. der Apg transportiert worden ist) und damit der Radikalität der Verkündung Jesu an dieser Stelle die Spitze abbricht. Des weiteren war die jesuanische Erwartung des himmlischen Tempels auch insofern gut verstehbar, als die Jerusalemer Urgemeinde sich mit dem Tempel identifizierte. Ihre Mitglieder hielten sich stets zum jüdischen Heiligtum (Apg 2,46; 3,1 ff; 21,26) und erwarteten hier in Einklang mit Jesus das Ende der Zeiten.
Als Analogie zum Tempelwort Jesu und der Reaktion der jüdischen und römischen Behörden sei auf das Beispiel von Jesus, Sohn des Ananus verwiesen. Über ihn schreibt der jüdische Historiker Josephus in einem bisher nicht ausreichend gewürdigten Bericht18:
»Vier Jahre vor dem Krieg, als die Stadt noch im höchsten Maße Frieden und Wohlstand genoss, kam nämlich ein gewisser Jesus, Sohn des Ananias, ein ungebildeter Mann vom Lande zu dem Fest, bei dem es Sitte ist, dass alle Gott eine Hütte bauen, in das Heiligtum und begann unvermittelt zu rufen:
›Eine Stimme vom Aufgang,
eine Stimme vom Niedergang,
eine Stimme von den vier Winden,
eine Stimme über Jerusalem und den Tempel,
eine Stimme über Bräutigam und Braut,
eine Stimme über das ganze Volk!‹ (vgl. Jer 7,34; 16,9)
So ging er in allen Gassen umher und schrie Tag und Nacht. Einige angesehene Bürger, die sich über das Unglücksgeschrei ärgerten, nahmen ihn fest und misshandelten ihn mit vielen Schlägen. Er aber gab keinen Laut von sich, weder zu seiner Verteidigung noch eigens gegen die, die ihn schlugen, sondern stieß beharrlich weiter dieselben Rufe aus wie zuvor. Da glaubten die Obersten, was ja auch zutraf, dass den Mann eine übermenschliche Macht treibe, und führten ihn zum Statthalter, den die Römer damals eingesetzt hatten. Dort wurde er bis auf die Knochen durch Peitschenhiebe zerfleischt, aber er flehte nicht und weinte auch nicht, sondern mit dem jammervollsten Ton, den er seiner Stimme geben konnte, antwortete er auf jeden Schlag: ›Wehe dir, Jerusalem!‹
Als aber Albinus – denn das war der Statthalter – fragte, wer er sei, woher er komme und weshalb er ein solches Geschrei vollführe, antwortete er darauf nicht das Geringste, sondern fuhr fort, über die Stadt zu klagen und ließ nicht ab, bis Albinus urteilte, dass er wahnsinnig sei, und ihn laufen ließ.
In der Zeit bis zum Kriege aber näherte er sich keinem der Bürger, noch sah man ihn mit jemandem sprechen, sondern Tag für Tag rief er, als ob er ein Gebet eingelernt hätte, seine Klage: ›Wehe, wehe dir, Jerusalem!‹
Er aber fluchte keinem von denen, die ihn schlugen, obwohl es täglich vorkam, noch segnete er die, die ihm Nahrung gaben, – eine einzige Antwort nur hatte er für alle, jenes unselige Rufen.
Am meisten aber schrie er an den Festtagen, und das tat er sieben Jahre und fünf Monate lang ohne Unterbrechung – seine Stimme stumpfte nicht ab, noch wurde er müde, bis er zur Zeit der Belagerung zur Ruhe kam, als er seinen Ruf zur Tat werden sah. Denn als er auf seinem Rundgang von der Mauer herab gellend rief: »und noch einmal wehe der Stadt und dem Volk und dem Tempel!‹, da setzte er zum Schluss hinzu: ›und wehe auch mir!‹, denn ein Stein schnellte aus der Wurfmaschine und traf ihn, so dass er auf der Stelle tot war und, noch jene Weherufe auf den Lippen, seinen Geist aufgab«. (Bell VI 300 – 309).19
Zurück zu Jesus von Nazareth: Seine männliche Jüngerschar, die von Galiläa mit ihm nach Jerusalem zum Passahfest gezogen war, hatte ihn vor bzw. bei der Festnahme fluchtartig verlassen, nach anfänglichem Zögern auch Simon Petrus, der unter den Jüngern Jesu eine Vorrangstellung innehatte. Freundinnen Jesu, die ebenfalls mit ihm von Galiläa nach Jerusalem zum Passahfest gereist waren, hielten dagegen länger bei ihrem Meister aus. Doch konnten auch sie sein Schicksal nicht wenden. Zu ihnen gehörte mit Sicherheit Maria aus dem galiläischen Fischerort Magdala, die von Jesus von einer schweren Krankheit geheilt worden war (Lk 8,2).
Endete der Karfreitag also wie ein großes Rätsel und war damit scheinbar alles zu Ende, so brach nicht lange nach dem Tod Jesu am Kreuz und der Flucht der Jünger nach Galiläa unverhofft ein neuer Frühling an. Wann genau sich das abgespielt hat, werden wir nie wissen. Aber nicht lange nach dem Todesfreitag sah Petrus in einer Vision Jesus lebendig, und dieses Geschehen führte zu einer Kettenreaktion.20 Hatte Petrus Jesus gesehen und gehört, so war damit der Inhalt der Visionen und Auditionen der anderen vorgegeben. Die Kunde verbreitete sich blitzartig, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen, ja, ihn zu sich erhöht hatte und dass dieser demnächst als Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommen werde.
Damit war eine neue Lage geschaffen, und die Jesusbewegung erlebte einen schwungvollen Neuanfang. Jetzt konnten Jesu Freunde noch einmal nach Jerusalem gehen und dort anknüpfen, wo ihr Meister das Werk unvollendet gelassen hatte, und das Volk sowie seine Oberen zur Umkehr rufen.
Vielleicht verstand man die Gegenwart als allerletzte Bußfrist, die Gott gegeben hatte. Der von Jesus selbst ins Leben gerufene Zwölferkreis (Mt 19,28)21 wurde von Petrus mitgerissen und sah ebenfalls Jesus (1Kor 15,5). Und wohl an dem Wochenfest (= Pfingsten), das auf das Todespassah folgte, ereignete sich jene Erscheinung auf einmal vor einer größeren Menge von Menschen, die man mit mehr als 500 angab (1Kor 15,6).
Auch Frauen waren jetzt unter denen, die Jesus sahen. Ja, auf gegnerische Einwände von jüdischer Seite und Fragen nach dem Verbleib des Leichnams Jesu hin wusste man alsbald zu berichten, dass Frauen das Grab leer gefunden hätten, und später, dass Jesus den Frauen am Grab sogar erschienen sei.22
Die Dynamik des Anfangs23 müssen wir uns hochexplosiv vorstellen, um so mehr, wenn eine ekstatische Disposition der von Jesus Zurückgelassenen mit zu berücksichtigen ist (C. Colpe). Am Anfang stand nicht, wie noch Ernst Haenchen in seinem einflussreichen Kommentar zur Apostelgeschichte gemeint hatte, ein pietistisch angehauchter Quietismus24, sondern eine umwerfende Erfahrung, die von Lukas25 eher noch domestiziert worden ist. Es blieb daher auch nicht aus, dass die leiblichen Brüder Jesu in den Strudel mit hineingerissen wurden, nach Jerusalem gingen und Jakobus sogar eine Einzelvision empfing (1Kor 15,7) – jener Jakobus, der zu Lebzeiten Jesu von seinem Bruder nicht viel gehalten hatte (Mk 3,20 f).
Für die genannten Vorgänge ist kaum mehr als ein Jahr anzusetzen. Vieles lief dabei nebeneinander her. Neben der Erfahrung des »Auferstandenen« in Visionen und Auditionen sind folgende Elemente der Entwicklung historisch fassbar:
1. Im Brotbrechen der versammelten Gemeinde wurde alsbald die Gemeinschaft mit dem hingerichteten, nun aber lebendigen Messias Jesus gegenwärtig.
2. Die Erinnerung an Jesu Wirken und sein Wort war unmittelbar gegenwärtig.
3. Die Naherwartung Jesu wurde ungebrochen übernommen, und an die Stelle des von Jesus vorausgesagten neuen Tempels trat die Gemeinde als Tempel, die von den Aposteln als Säulen getragen wurde.
4. Bestimmte Psalmen, wie z. B. Ps 110, wurden recht bald auf den erhöhten Messias-Menschensohn Jesus bezogen.
Ein neues Stadium erreichte die Bewegung, als sich ihr in Jerusalem griechischsprachige Juden anschlossen.26 Das mag bereits an jenem auf das Todespassah folgenden Wochenfest (= Pfingsten) gewesen sein, als sie aus aller Herren Länder in Jerusalem anwesend waren und von Jesus hörten. Auch auf sie wirkte das Tempelwort Jesu elektrisierend, nun aber so, dass daraus eine Gesetzeskritik floss (Apg 6,13). Aus Jerusalem hinausgedrängt, verbreiteten sie die Jesusbotschaft in den Gegenden außerhalb Jerusalems und lenkten die Aufmerksamkeit des Pharisäers Saulus auf sich. Dieser schritt zur Tat, unterdrückte die neue Predigt, bis er ebenfalls von Jesus überwunden wurde, ihn sah und hörte.
Mit diesem Ereignis scheint ein Schlusspunkt des ältesten Osterglaubens erreicht. Ja, für die Jerusalemer Urgemeinde lag die Erscheinung Jesu vor Paulus eigentlich bereits außerhalb der Zeit der Osterereignisse. Die Tradition in 1Kor 15,7 sagt ausdrücklich, Christus sei allen Aposteln erschienen. Wenn Paulus trotzdem eine Christuserscheinung empfangen zu haben behauptet, sich dann aber im Vergleich mit den Uraposteln als »Fehlgeburt«. (1Kor 15,8) bezeichnet, bekräftigt er diese Sicht der Urgemeinde.27
Ekstatische Erfahrungen im Rahmen einer Christusschau kamen in Jerusalem auch noch später vor und setzten sich bei Paulus fort. So berichtet Lukas in Apg 7,55 – 56 unter Benutzung einer sicher auf einen geschichtlichen Kern zurückgehende Tradition (V. 56) von Stephanus28:
»Voll von heiligem Geist blickte er zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sprach: ›Siehe, ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen‹.«29
Und Paulus gibt in 2Kor 12,2 – 4 zum Thema »Schauungen und Offenbarungen«, provoziert durch gegnerische Anwürfe, den Eigenbericht einer Entrückung bzw. einer Himmelsreise:
(2) »Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren – entweder im Leib, ich weiß es nicht, oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass dieser bis zum drittten Himmel entrückt wurde.
(3) Ich kenne diesen Menschen – entweder im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, (4) dass er in das Paradies entrückt wurde.«
Indes gewannen diese Erlebnisse nicht die normative Bedeutung wie die zuvor genannten.
Die erste gemeinsame Erfahrung der Menge in Jerusalem, die mit der Erscheinung Jesu vor den mehr als 500 (1Kor 15,6) identisch sein dürfte, hatte ja eine Art initiatorischen Charakter und steht in ihrer Bedeutung mit der ersten Vision des Petrus in Galiläa auf einer Stufe. So wie nur in dieser die eigentliche Berufung des Petrus erfolgte, so war auch das Pfingstereignis konstitutiv für die Bildung einer neuen Gruppe innerhalb der Jerusalemer Juden. Es verlieh der Jesusgemeinde einen Kraftschub und veränderte ihre Lage gegenüber der vor der Hinrichtung Jesu grundlegend.
Erste Institutionalisierungen und Parteiungen30
Bereits auf die von Petrus in Galiläa betriebene Wiederherstellung des Zwölferkreises treffen die Merkmale einer Institutionalisierung zu, doch hatte diese offenbar einen eschatologisch-symbolischen Charakter und war ganz vom Enthusiasmus geprägt. Denn »sinnvoll war sie nur, wenn wie bei Jesus 12 Stämme Israels bei Anbruch der Gottesherrschaft voll repräsentiert sein sollten«31, was ja eine fast rauschhafte Naherwartung voraussetzte. Hingegen ergab sich nach dem Abflauen der Pfingsterfahrung die Notwendigkeit eines größeren Realitätsbezugs, das Leben ging weiter.