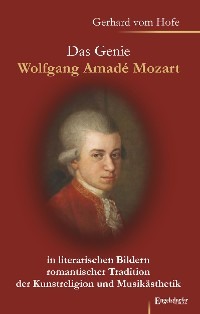Kitabı oku: «Das Genie Wolfgang Amadé Mozart in literarischen Bildern romantischer Tradition der Kunstreligion und Musikästhetik», sayfa 2
Beispielsweise ist vom sechs- und siebenjährigen Wunderknaben und der Wunderwirkung seines Klavier- oder Orgelspiels in den Briefen von der ersten großen Reise nach Wien 1762/63 des Öfteren die Rede: So berichtet der Vater seinem Freund Lorenz Hagenauer in Salzburg: „Hauptsächlich erstaunet alles ob dem Bueben, und ich habe noch niemand gehört, der nicht sagt, daß es unbegreiflich seye.“36 Sogleich nach ihrer Ankunft in Wien (so schreibt Leopold Mozart) habe er Befehl erhalten, an den Kaiserhof zu kommen. Der Ruf des Wunderknaben sei ihnen vorausgeeilt. Aus Wasserburg, wo Leopold seinem Sohn das Pedal der Orgel erklärt, habe Wolfgang dann „stante pede die Probe abgeleget, (...) stehend preambulirt und das pedal dazu getreten, (...) als wenn er schon viele Monate geübt hätte. alles gerüeth in Erstaunen und ist eine neue Gnad Gottes, die mancher nach vieler Mühe erst erhält.“37
Aus Paris im Februar 1764 erfährt Frau Hagenauer vom Vater Mozarts:
„stellen sie sich den Lermen für, den diese Sonaten (gemeint sind vier Klaviersonaten, die der Knabe gerade komponiert hat; d.Vf.) in der Welt machen werden, wann am Titlblat (sic!) stehet, daß es ein Werk eines Kindes von 7 Jahren ist (...).“ Ich „kann Ihnen sagen (...), daß Gott täglich neue Wunder an diesem Kinde wirket“.38
Und dann folgt eine für den Vater Leopold typische Bemerkung, die seine pädagogische Strategie verrät, die er mit den für ein Kind schließlich höchst anstrengenden, eigentlich unzumutbaren Reisen verfolgt:
„bis wir: wenn Gott will: nach Hause kommen, ist er (d.h. Wolfgang; d.Vf.) im Stande Hofdienste zu verrichten. Er accompagniert wirk: allerzeit bey öffent: Concerten. Er transponirt so gar à prima vista die Arien beym accompagniren; und aller Orten legt man ihm bald Ital: bald französ: Stücke vor, die er vom blatt=weg (sic!) spielet.“39
Aus London 1764 berichtet Leopold, Wolfgang habe dem König Stücke von Bach, Abel und Händel vom Blatt „weggespielt“, er habe die Königin bei einer Arie begleitet und über einem Bass die schönste Melodie gespielt, „so, daß alles in das äusserste Erstaunen gerieth.“
Was Wolfgang jetzt könne, das übersteige alle Einbildungskraft.40 Und eine letzte Briefstelle sei angeführt. Aus München im November 1766 rechtfertigt Leopold wieder einmal seine Erziehungsmethode gegenüber Lorenz Hagenauer:
„Gott (...) hat meinen Kindern (die Tochter Nannerl also eingeschlossen; d.Vf.) solche Talente gegeben, die, ohne an die Schuldigkeit eines Vatters zu gedenken, mich reitzen würde, alles der guten Erziehung derselben aufzuopfern. jeder Augenblick, den ich verliehre, ist auf ewig verlohren. und wenn ich jemahls gewust habe, wie kostbar die Zeit für die Jugend ist, so weis ich es itzt. Sie wissen daß meine Kinder zur arbeit gewohnt sind: (...) sie wissen auch selbst wie viel meine Kinder, sonderlich der Wolfgangerl zu lernen hat.“41
Hier spricht der christlich denkende Aufklärer, dem bewusst ist, dass es mit dem Genie des Wunderknaben allein nicht getan ist. Und Leopold Mozart leitet aus dem ihm und der Welt von Gott gesandten Wunder die geradezu missionarische Verpflichtung ab, das ihm mit Wolfgang anvertraute Gottesgeschenk zu hüten, es durch sorgsame Belehrung in seiner Entwicklung zu fördern – und es der Welt zu demonstrieren. Hier verrät sich ein christlich religiöses Motiv für die großen strapaziösen Reisen durch Europa, das sich übrigens für den Vater mit dem profanen Aspekt des Ruhm- und Gelderwerbs, einer ganz praktisch und ökonomisch motivierten Bildungsreise zum Zwecke der „Vermarktung“ des Wunderknaben mühelos zu verbinden schien.42 Ein Brief aus Rom vom April 1770, ein Zeugnis der ersten Italienreise, die nicht mehr nur privat arrangierte Konzerte zumeist in Adelshäusern anstrebte, sondern bewusst mit dem Versuch unternommen wurde, für Mozart einen Produktionsvertrag für die italienische Oper abzuschließen, bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass nunmehr Wolfgangs mit Fleiß erworbenes handwerkliches Können und sein ungemein rasches Fortschreiten in der „Compositionswissenschaft“ der Hauptgrund für die allerorts spürbare Bewunderung ist (und der Ruf des Wunderkindes allein nicht mehr zieht): „ie tiefer wir in Italien kamen, ie mehr wuchs die verwunderung. der Wolfg. bleibt mit seiner Wissenschaft auch nicht stehen, sondern wächst von tage zu tage, so, daß die grösten kenner und Meister nicht worte genug finden ihre Bewunderung auszudrücken (...).“ 43
Schon während der großen Westeuropa-Reise der Jahre 1763 bis 1765, stärker ausgeprägt freilich dann später in den Jahren der Italienreisen 1771-1773 und in denen der „Orientierung“ 1777 – 178144, hier besonders in der Mannheimer und Pariser Zeit, tritt Mozarts musikalische Welterkundung, das forcierte Lernen und Arbeiten, das Sich-Vertraut machen mit den verschiedenen zeitgemäßen Stilrichtungen der Musik in den europäischen Zentren in den Vordergrund und gewinnt als das heimliche pädagogische Konzept Leopolds und als Hauptzweck der Reisen immer mehr an Bedeutung. Die Erinnerungen an die ersten Auftritte des Wunderkinds in der Fremde verblassen mehr und mehr. Bald bricht die Zeit der professionellen Bewährung des außerordentlichen Talents an. Der junge Komponist wird zunehmend selbstbewusster. Er weiß sich zum „Kapellmeister“ geboren, und er thematisiert in seinem Brief vom 11. September 1778 aus Paris an seinen Vater sein Selbstbewusstsein als ein „Mensch von superieuren Talent“, „welches ich mir selbst, ohne gottlos zu seyn, nicht absprechen kan.“45
Und in demselben Brief heißt es weiter:
„ich darf und kann mein Talent im Componiren, welches mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat, / ich darf ohne hochmuth so sagen / denn ich fühle es nun mehr als jemals nicht so vergraben.“46
Wie der Vater beruft auch der Sohn das biblische Gleichnis vom Talentwucher und leitet daraus die religiöse Selbstverpflichtung ab, seine göttliche Berufung zum Komponisten als seine Lebensbestimmung zu verwirklichen. Das Klavier sei eigentlich nur seine „sehr starcke nebensach“, das Komponieren sei dagegen seine „einzige freüde und Paßion“.47
Die Tätigkeit des Unterrichtens, worauf Mozart noch während seiner Wiener Jahre ohne eine höfische Position angewiesen war, galt ihm eher als eine Last und ein „notwendiges Übel“.48 Den zuletzt zitierten Briefzeugnissen, die Mozarts Selbsteinschätzung seiner ungewöhnlichen Gaben demonstrieren, möchte ich wenigstens eine historisch verbürgte Äußerung über das Wunderkind Mozart zur Seite stellen, die nicht nur die andere Optik der zeitgenössischen Öffentlichkeit repräsentiert, sondern die auch deshalb besonders interessant ist, weil sie das Urteil eines eher skeptischen Aufklärers darstellt. Ein Freund Diderots, der Diplomat und Schriftsteller Baron Melchior von Grimm, übrigens ein wichtiger Mittelsmann der Mozarts in Paris, verbindet mit seinem Ausdruck der irritierten, aber grenzenlosen Bewunderung zugleich den vielleicht für die Zeit charakteristischen Versuch einer rationalen Klärung der Wirkung eines für ihn sprichwörtlich unbegreiflichen Wunders.
Grimm schreibt in seiner Kritischen Korrespondenz am 1.12.1763:
„Wahre Wunder sind so selten, daß man davon spricht, wenn man einmal eins erlebt. Ein Kapellmeister aus Salzburg mit Namen Mozart ist hier (i.e. in Paris; d.Vf.) kürzlich mit zwei Kindern von allerliebstem Anblick eingetroffen. Seine Tochter spielt hinreißend Klavier; (...) ihr Bruder, der im nächsten Februar sieben Jahr alt wird, ist ein so ungewöhnliches Wunderkind, daß man kaum glauben kann, was man mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört.“ (...)
„geradezu unglaublich ist es, ihn eine Stunde lang aus dem Kopfe spielen und sich der Eingebung seines Genies und einer Menge entzückender Einfälle überlassen zu sehen, die er zudem geschmackvoll und geordnet folgen zu lassen weiß.“ (...) „Mühelos liest er alle Noten, die man ihm vorlegt; er komponiert mit wunderbarer Leichtigkeit, ohne zum Klavier zu gehen und seine Akkorde suchen zu müssen.“ (...)
„Dieses Kind wird mich bestimmt noch närrisch machen, wenn ich es öfters höre; es zeigt mir, wie schwer es ist, sich vor Tollheit zu hüten, wenn man Wunder erlebt. Daß der heilige Paulus nach seiner seltsamen Vision den Kopf verlor, setzt mich nicht mehr in Erstaunen.“49
Überschaut man die angeführten lebensgeschichtlichen und historisch-authentischen Briefzeugnisse hinsichtlich ihrer Rede vom Wunderkind Mozart, so fällt auf, dass sie mit ihren Versuchen einer rationalen Klärung der Wirkung des Wunderbaren durchaus eine metaphysische Erklärung in Betracht ziehen. Was den phänomenalen Effekt der öffentlichen Auftritte des jungen Mozart angeht, die dadurch ausgelöste Bewunderung, ja Irritation, so hätte der zuvor schon einmal zitierte Thomas Bernhard hier vielleicht (wie in seinem Roman Der Untergeher im Hinblick auf den phänomenalen Pianisten Glenn Gould) überspitzt von einer (freilich bei Mozart nicht bloß) „klavieristischen Weltverblüffung“ gesprochen.50
Aber von einer romantischen Interpretation, die auf eine Verherrlichung und Verklärung des göttlichen Genies Mozarts und seiner apollinischen Erscheinung im Lichte Raffaels und einer durch ihn historisch vorbereiteten Kunstreligion abzielt, kann weder in den historischen Zeugnissen der Selbstdeutung noch in den zeitgenössischen Dokumenten des 18. Jahrhunderts schon die Rede sein. Auch von einer klassischen Idealisierung des begnadeten Subjekts und von einer Mythisierung des großen Komponisten Mozart sehen die gerade angeführten Dokumente (noch) ab. Das unterscheidet gerade deren Profil von den erst nach Mozarts Tod proklamierten Anschauungen, die im Wesentlichen unter der Voraussetzung romantischer Ideen und eines säkularen kunstfrommen Denkens entstanden sind und die frühe Rezeptionsphase Mozarts mit ihrer Favorisierung der Vokal- und Kirchenmusik geprägt haben. Erst dieser hauptsächlich durch Rochlitz und die Romantik begründeten Tradition einer Sakralisierung der Kunst (die maßgeblich auf Wackenroder und Tiecks Publikationen sowie publikumswirksam dann auf E.T.A. Hoffmann zurückgehen) verdanken sich die ästhetisch wie psychologisch folgenreichen Tendenzen des Mozart-Bildes, welche noch heute ihre Wirkung zeigen. Darüber hinaus wird die hauptsächlich durch E. T. A. Hoffmann richtungweisende Bestimmung und fortwährende Wirkung der romantischen Musikästhetik künftig die Mozart-Darstellungen maßgeblich beeinflussen. In Mörikes Mozarts Bild leuchtet paradigmatisch noch eine Kombination beider Traditionen auf: die einer eher klassischen und spielerischen Wiederaufnahme des mythologisch begründeten apollinischen Genies – und die des Fortlebens einer Tradition typisch romantischer Musikästhetik.
Kapitel 2
Göttlich – menschlicher Amadeus. Literarische Mozart – Bilder im Horizont des romantischen Kunst- und Geniebegriffs *
Die Klage über unzulängliche Biographien in Kreisen der Kenner, Verehrer und Liebhaber begleitet wie ein Ostinato die Wirkungsgeschichte Mozarts seit den ersten Versuchen einer Gesamtdarstellung. Eine für das 19. Jahrhundert typische Äußerung dieser Art stammt von dem literarisch wie musikalisch gebildeten Pfarrer Wilhelm Hartlaub. In einem Brief vom 8. Juni 1847 an seinen Freund, den Dichter Eduard Mörike, berichtet er über seine Lektüre der gerade in deutscher Übersetzung erschienenen Mozart-Biographie des Russen Alexander Ulibischeff1: Diese Lebensgeschichte sei „ordentlich geschrieben und besser als ich dachte, bietet jedoch nichts Besonderes dar. Ich glaube auch gar nicht, daß man eine wahrhaft genußreiche Biographie von Mozart machen kann, ja ein Fragment Dichtung aus seinem Leben, wie Du einmal im Sinn hattest, würde tausendmal befriedigender sein. Die Lebensereignisse, Verhinderungen, Reisen, die Zeitnachrichten, sodann die Züge seines Charakters – in welchem Mißverhältnis steht das alles zu der unendlichen Größe des Künstlers!“ 2
Hartlaubs Aufnahme der (historisch gesehen) letzten vorwissenschaftlichen Mozart – Biographie (vor Otto Jahns großer Arbeit aus dem Jahr 1856) bezeugt Respekt. Doch sie verbirgt nicht die Enttäuschung. Und die höflich – verhaltene Kritik verbindet sich mit einer ins Grundsätzliche gewendeten Überlegung, die den beklagten Mangel relativiert. Ulibischeffs Unternehmen verdient Beachtung, das Unbefriedigende seiner Mozart – Darstellung erweist sich als erkanntes Problem der literarischen Gattung Biographie überhaupt, nicht als subjektive, also dem Autor anzulastende Schwäche. Natürlich dient die Kritik als willkommener Anlass, dem Freund Mörike ein längst geplantes Vorhaben in Erinnerung zu rufen und ihn erneut zu motivieren, ein literarisches „Lebensbild“ Mozarts in Gestalt einer Künstlernovelle (wie sie das 19. Jahrhundert liebte und die Biedermeierzeit im besonderen pflegte) zu verwirklichen – als Alternative zu den offenbar von vornherein fragwürdigen Versuchen biographischer Darstellung. Hartlaubs indirekter Appell leitet sich aus dem eingesehenen Mangel bisheriger Mozart – Biographien (nach denen Schlichtegrolls3, Niemtscheks4 und Nissens5 nun also auch Ulibischeffs) her. Und nicht nur das; die Notwendigkeit eines „poetischen Fragments“ aus Mozarts Leben, ja die Legitimität eines dichterischen Versuchs – diesen Gedanken legt die zitierte Briefstelle nahe – scheint sich aus diesem Umstand zu begründen. Dass nun ausgerechnet Ulibischeff als Beispiel für die von Hartlaub reklamierten Mängel der Biographik geltend gemacht wird, mag aufs Konto des Zufalls zu schreiben sein; ein wenig befremdlich bleibt es doch. Denn der Mangel an “Besonderem“ dürfte dem russischen Mozart – Enthusiasten kaum anzulasten sein. Immerhin versucht Ulibischeff seinen Anspruch einer „philosophischen Biographie“6 Mozarts mit einem ebenso sensiblen wie übrigens typisch romantischen Konzept zu verwirklichen, indem er Leben und Wirken Mozarts als göttliche Sendung in einer paradoxalen Einheit von Wunder und logischer Konsequenz (Mozart als „Abschluss der abendländischen Tonkunst“)7 zu begründen trachtet. Der russische Mozart – Kenner übersieht nicht die Widersprüche zwischen dem genialen Universalkomponisten und dem unerklärlich bleibenden Menschen, aber die Beobachtungen der bei Mozart im „höchsten Grade“ vereinigten Eigenschaften des Genies führen doch zu einem charakteristisch romantischen Bild, welches eine verborgene Einheit von Lebens – und Werkgeschichte andeutet. Romantischer Optik verdankt sich die Vorstellung des Bürgers einer idealen Welt, welcher sein Inneres hinter Masken verbirgt und seine Musikwerke als „tugendhafte Handlungen“ zu verstehen gibt.8 Mozarts Kompromisslosigkeit als Künstler, seine Verachtung der Weltklugheit, ja seine „ungemeine Gleichgültigkeit gegen das Positive“ 9 prädisponieren ihn zum Opfer der Gesellschaft. Ulibischeff zitiert die Topik romantischer Künstlerauffassungen.
Insofern verwundert Hartlaubs Kritik, die doch gerade den offenbar auch hier nicht vermittelten Widerspruch von Charakter, Künstlerexistenz und Werk einklagt. Auch der kritisierte Biograph sieht das große Problem, das zum Ärgernis aller Mozart – Liebhaber geworden ist: die offensichtliche Diskrepanz zwischen Person, Künstlergenie und Werk.10 Mozarts Charakter lässt sich schwer in Einklang bringen mit der „unendlichen Größe des Künstlers“. Mozart, der Komponist: ein „Göttlicher“ – aber Mozart, der Mensch, wie er in den Selbstzeugnissen und im Urteil seiner Zeitgenossen erscheint: ein allzu menschlich Schwacher, Unscheinbarer, Problematischer, dessen kindlich-kindischer Habitus mit seinem musikalischen Genie schlechterdings nicht zusammenstimmen will. Der Bericht einer Augenzeugin kann hier als signifikantes Beispiel dienen. In ihren Memoiren schreibt die Wiener Schriftstellerin Caroline Pichler, Mozart habe in seinem persönlichen Umgang „beinahe keinerlei Art von Geistesbildung, von wissenschaftlicher oder höherer Richtung“ gezeigt. Er habe eher unseriös gewirkt: mit seiner „alltägliche(n) Sinnesart“, mit „platte(n) Scherze(n)“.11 Wie sollte man die verborgenen Tiefen seiner musikalischen Phantasiewelten damit in Verbindung bringen? Die vielbewunderten Schöpfungen des Genies Mozart harmonieren nicht mit Erscheinung und Habitus seiner Person. Doch es ist nicht dieser Widerspruch von Künstlerleben und Kunstwerken, von Schöpfer und genialen Produkten allein, der die Biographen vor kaum zu bewältigende Probleme stellt; die Widersprüche zwischen Leben und Werk Mozarts potenzieren sich durch das offensichtliche Auseinanderfallen von „äußerer Biographie“ und sprachlich äußerst spärlich dokumentierter tiefer Innerlichkeit Mozarts.
Was die äußere Lebensgeschichte betrifft, so lässt sie sich doch geradezu als prototypisch romantischer „Lebensroman“12 lesen; ja der Biograph könnte sich beinahe keinen interessanteren Gegenstand wünschen. Mozarts Lebenssituationen, vornehmlich die Reisen des Wunderkindes, seine Auftritte als Virtuose an den europäischen Höfen und in den verschiedenen Metropolen (Wien – München – Paris), sein viel bewundertes Wirken als Komponist in Italien oder in London: dies zu beschreiben sollte nichts „Besonderes“ versprechen? Hans Joachim Kreutzer betont mit Recht, Mozarts Leben sei die Topik einer romantischen Künstlervita eingeschrieben. Eigenartigerweise präfiguriert sein Leben die „wesentlichen Charakteristika eines Künstlerromans“.13 Auch die „Auffassung vom Künstlerschicksal, wie es die Romantik E.T.A. Hoffmann’scher Prägung dem 19. Jahrhundert überlieferte“14, lässt sich darin entdecken. Dem poetischen Blick dürften zentrale, Mozarts Biographie strukturierende Motive nicht entgehen. Man denke nur an den Motivkomplex des göttlichen Wunderkindes (mit den Vorstellungen von Frühreife, vorzeitiger Vollendung und Naivität verbunden); oder an das Motiv der „Bildungsreise“ ins gelobte Land der Musik (Italien). Zu entfalten wären das Motiv des patriotischen Künstlers Mozart (in Verbindung mit dem der Rivalitäten) oder das romantische Motiv des Fremdlings in dieser Welt, des Konflikts mit der Gesellschaft und des Ringens mit der Not; schließlich das Motiv der Verelendung und des Leidens, des Opfers und der Krankheit als Stigma des genialen Künstlers (eine Motivreihe, die mit den bekannten und wirkungsreichen Legenden verknüpft ist, die sich um den späten Mozart und seine Todesumstände gebildet haben).
Mit diesem Kanon poetisch-romantischer Lebensmotive gab es für die Biographik wie auch für die ausgesprochen literarischen Mozartdarstellungen durchaus ergiebige Quellen und Deutungsschemata. Die dichterischen Lebensbilder konnten sich überdies aus einem reichen Anekdotenschatz nähren, nachdem schon 1798 Friedrich Rochlitz seine Sammlung in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung veröffentlicht15 und Nissen in seiner Biographie eine erweiterte Kollektion vorgelegt hatte. Dem Biographen wie dem Dichter standen schließlich (wenn auch keineswegs vollständig) Selbstzeugnisse und zeitgenössische Mitteilungen über den Komponisten zur Verfügung. Nicht zu vergessen ist der seit Schlichtegrolls Nekrolog sich auswachsende Legendenkomplex. Es gab also reichlich Stoff für literarische Lebensbilder. Und vor allem Anekdoten und Legenden arbeiteten poetischer Darstellung schon dadurch zu, dass sie selber literarisch gestaltet waren.
Gleichwohl blieb offenbar das Wichtigste noch zu leisten. Mit allen noch so aufregenden, vielleicht sogar sensationellen Nachrichten aus Mozarts äußerem Leben ließ sich die psychologische Neugier noch nicht befriedigen. Es blieb die unbeantwortete Frage nach dem Geheimnis des Menschen Mozart, der ein derartig großes, ja „göttliches“ Werk hervorgebracht. Es blieb die Frage nach einer verborgenen Einheit der Person des Schöpfers mit seinem genialen Werk, und verbunden damit die Suche nach einer Erklärung der widersprüchlichen Existenz Mozarts. Denn das vor Augen liegende Interessante und Spektakuläre Mozartscher Vita trübt den Blick ins Innere dieses einzigartigen Menschen. Der innere Zusammenhang von Leben und Kunst, Genie und Werk, das wahre Zentrum von Mozarts Künstlerexistenz wollte sich in den Biographien nicht entdecken lassen. Desiderat blieb eine innere Lebensgeschichte16; erst sie könnte die Lebensmotive zu einem einheitlichen Bild fügen und also eine „genußreiche“ Biographie ermöglichen.
Darin aber besteht das Hauptinteresse poetischer Mozart-Bilder, die psychologischen Fragen nachgehen und ästhetischen Ansprüchen Rechnung zu tragen versuchen. Der Dichter – auf diese Hoffnung gründet sich eben Wilhelm Hartlaubs eingangs zitierter Brief mit seinem indirekten Appell an Mörike – vermag vielleicht dem Mangel der Mozart-Biographen zu begegnen, indem er ein auf ästhetische Gesetze der Einheit und Geschlossenheit verpflichtetes Lebensbild imaginiert und der Logik einer inneren Geschichte, einer Seelengeschichte Mozarts nachspürt. Literarische Lebensbilder bleiben freilich mit ihrer entscheidenden Frage nach dem archimedischen Punkt in Mozarts genialer Künstlerexistenz immer nur „Suchbilder“. Das unterscheidet sie gerade von Anekdoten, vor allem aber von den Legenden, die denn doch Objektivität vortäuschen, Mutmaßung und Spekulation als Faktum ausgeben, bloß um der Verklärung des Wunderbaren und letztlich Unfassbaren willen. Hier diktiert das Wunschdenken die Aussage, prägt die Tendenz der Anpassung an normative Begriffe vom Genie selbst um den Preis gewaltsamer Umdeutungen des faktisch Gesicherten das Bild des tragischen und romantisch verklärten Genies. Seriöse poetische Mozart-Bilder dagegen (von der Trivialliteratur hier einmal abgesehen) respektieren Grenzen. Sie reden im Modus des „Als ob“, also im Konditional. Sie borgen Motive der Legenden und Anekdoten, ohne doch eindeutig Erklärungen des rätselhaft Bleibenden zu intendieren oder unkritischer Verherrlichung zu verfallen. Das Bewusstsein der Fiktion und des begrenzenden Rahmens unterscheidet den ernst zu nehmenden Dichter eines Mozart-Bildes vom Legendenerzähler. Und die Legitimität literarischer Mozart-Bilder entscheidet sich an der Respektierung dieser Grenzfrage.
*****
Für das auch bei Hartlaub artikulierte Befremden, das sich angesichts des Widerspruchs von Person und Werk bei Mozart einstellt, gibt es eine historische Erklärung. Trotz der Fülle romantischer Lebensmotive, welche seine äußere Lebensgeschichte auszeichnet, fügt sich Mozart dennoch überhaupt nicht ins idealisierende Bild vom großen Genie, das seit den Geniekonzepten des 18. Jahrhunderts tradiert und durch die idealistischen und romantischen Vorstellungen als verpflichtendes Erbe für das 19. Jahrhundert vermittelt worden ist.17 Mozart geht nicht nur der geistig intellektuelle Habitus eines künstlerischen Genies ab. Man vermisst vor allem die Selbstaussprache seiner Innerlichkeit, die Selbstreflexion seiner schöpferischen Subjektivität. Auch der Gestus des Heroischen ist ihm gänzlich fremd. Im Unterschied zu Beethoven, mit dem man Mozart seit E.T.A. Hoffmann18 immer wieder verglichen hat, der dem normativen Bild vom romantischen Genie vollkommen zu entsprechen scheint; aber auch im Gegensatz zu anderen großen Musikerpersönlichkeiten wie etwas Robert Schumann oder Richard Wagner (um beim 19. Jahrhundert zu bleiben) gibt es bei Mozart nur wenig Anzeichen für eine selbstmächtige Subjektivität: kaum Spuren einer Selbstreflexion und einer problematisierenden Selbstthematisierung der Kunst und der Künstlerexistenz. Und auch Indizien für Mozarts Leiden am Widerspruch von Kunst und Leben lassen sich kaum finden. Mozart scheint sein Leben in anderen Kategorien zu haben als seine schöpferische Produktion. Die Sphären seiner herrlichen Musik und seines Alltagslebens scheinen unvermittelt in einem Nebeneinander zu liegen.
Zudem ergänzen keine programmatischen oder theoretischen Schriften seine Kompositionen; geschweige denn, dass Mozart sich gedrängt sähe, seine Werke philosophisch oder ästhetisch zu rechtfertigen. Und was seine Kompositionsweise betrifft, so scheint ihm alles mühelos zu gelingen, ja die „Ideen“ scheinen ihm nur so zuzufliegen. Man findet keine Spuren des zähen Ringens um ein Werk.19 Nicht dass er kein Bewusstsein seines außerordentlichen Talents gehabt hätte. Die Briefe bezeugen mehrfach und eindrücklich sein Ehrgefühl und den ausgeprägten Stolz auf seine ungewöhnlichen Leistungen. Überhaupt legte er großen Wert darauf, auf Grund seiner musikalischen Arbeiten, nicht jedoch dank seiner Position anerkannt zu werden. In einem Brief an den Vater vom 11. September 1778 aus Paris etwa gibt er ohne Pathos zu verstehen, dass er sich mit seinem „superieuren Talent, welches ich mir selbst, ohne gottlos zu seyn, nicht absprechen kann“20, ungerecht behandelt fühlt. Andere Briefe zeigen, dass Mozart sogar das neutestamentliche Gleichnis beruft, welches den „Talentwucher“ lehrt. Aus Mannheim schreibt er wieder an den Vater: „ich darf und kann mein Talent im Componiren, welches mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat, ich darf ohne hochmuth so sagen, denn ich fühle nur mehr als jemals, nicht so vergraben.“21
Nobert Elias hat in seinem Mozart-Buch die Selbstzeugnisse dieser Thematik systematisiert und als Signatur von Mozarts bürgerlichem Selbstbewusstsein interpretiert.22 Niemals verbindet sich indessen mit solchen Selbstäußerungen ein heroischer Gestus oder die Pose des von der Welt unverstandenen und verkannten Genies. Das ausgesprochen elitäre Selbstbewusstsein einer Ausnahme-Existenz geht damit nie einher. Das romantische Klischee vom ironisch lächelnd sich über seine philiströse Mitwelt erhebenden Künstler passt nicht zu Mozart.
Vor allem aber lässt er sich nicht in die Reihe der großen Passionsgeschichten romantischer Künstler seit Wackenroders „Berglinger“ einordnen, also der zumeist literarischen Künstlerviten, die das Leiden an der Welt und an der nicht mehr gelingenden Vermittlung der empfundenen musikalischen Ideen thematisieren und einen am prinzipiellen Widerspruch von Kunst und Leben zerbrechenden Menschen darstellen. Wahrscheinlich hat auch Mozart gelitten, aber er redet darüber fast nie, vielleicht weil ihm die Sprache dazu fehlt. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, wie Wolfgang Hildesheimer, Goethe zitierend, vermutet, dass ihm kein Gott zu sagen gab, was er leide.23
Die wenigen Zeichen von Resignation und Bewusstsein der Todesnähe in den Briefen deutet Hildesheimer als Stigma von Mozarts unfassbarem Genie, welches im Grunde innerlich einsam bleibt und sich, unter „Druck“ schaffend, selbst verzehrt.24 Dem modernen Biographen gilt die Einzigartigkeit von Mozarts Genie als eine inkommensurable Größe. Zu diesem Phänomen gehört, dass ihm die Mitteilsamkeit fehlt. Mozart – so Hildesheimer – habe sich niemals in seine Mitwelt projiziert.25 Wenn er gelegentlich über sein Metier spricht – und das ist selten genug –, dann betreffen seine Äußerungen Fragen der Theater- oder Aufführungspraxis, nie jedoch grundsätzliche musiktheoretische oder gar kunstmetaphysische Probleme. Bezeugt ist Mozarts unbestechliche Einsicht in wirkungspsychologische Zusammenhänge; nicht minder sein Realismus, seine oft nüchterne Einschätzung seiner musikalischen Wirkungsmöglichkeiten und nicht zuletzt sein Pragmatismus: „wenn mich der kayser will, so soll er mich bezahlen – denn die Ehre allein, beym kayser zu seyn, ist mir nicht hinlänglich. – wenn mir der kayser 1000 fl. giebt, und ein graf aber 2000. – so mache ich dem kayser mein kompliment und gehe zum grafen. – versteht sich auf sicher.“ 26
Zu den wenigen Briefen, die den Vorhang seines Inneren ein wenig öffnen und die vielleicht noch am ehesten mit dem romantischen Genieverständnis vermittelbar erscheinen, zählt der letzte Brief Mozart an seinen Vater vom 4. April 1787. Dies Selbstzeugnis aus der Entstehungszeit der Oper Don Giovanni gilt manchen Mozartforschern als Schlüssel für die Deutung dieses Werks als Selbstobjektivierung des Vater-Sohn-Konflikts. Noch der Amadeus – Film gewinnt daraus ein Argument für die Konzentration auf das Problem der bis zum Tode währenden Auseinandersetzung mit dem Vater:
diesen augenblick höre ich eine Nachricht, die mich sehr niederschlägt – um so mehr als ich aus ihrem letzten Vermuthen konnte, daß sie sich gottlob recht wohl befinden; – Nun höre aber, daß sie wirklich krank seyen! wie sehnlich ich einer Tröstenden Nachricht von ihnen selbst entgegen sehe, brauche ich ihnen doch wohl nicht zu sagen; und ich hoffe es auch gewis – obwohlen ich es mir zur gewohnheit gemacht habe mir immer in allen Dingen das schlimmste vorzustellen – da der Tod /: genau zu nemmen: / der wahre Endzweck unsers lebens ist, so habe ich mich seit ein Paar Jahren mit diesem wahren, besten freunde des Menschen so bekannt gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel beruhigendes und tröstendes! und ich danke meinem gott, daß er mir das glück gegönnt hat mir die gelegenheit /: sie verstehen mich:/ zu verschaffen, ihn als den schlüssel zu unserer wahren Glückseeligkeit kennen zu lernen. – ich lege mich nie zu bette ohne zu bedenken, daß ich vielleicht /: so Jung als ich bin:/ den anderen Tag nicht mehr seyn werde- 27
Dieser aus dem Rahmen der anderen Vaterbriefe herausfallende Trostbrief gilt vielen als einzigartiger ‚Beweis‘ für Mozarts Selbstobjektivierung und für seine Vertrautheit mit dem Todesgedanken. Ja er könnte als ein versöhnlich stimmendes Zeichen für seine doch „durchgehende Innerlichkeit“ gelesen werden. Gegen Hildesheimers Zweifel an der Echtheit dieses Briefes28 wendet Robbins Landon ein, hier sei ein authentisches Zeugnis für Mozarts „tiefe Verbundenheit mit den freimaurerischen Lehren vom Tod“ zu erkennen. Mozart spiele auf den „symbolische(n) Übergang vom Tod zum Leben in der freimaurerischen Zeremonie“ an 29.
Ein später Brief an Constanze vom 7. Juli 1791 lässt vielleicht noch deutlicher ins Innere Mozarts schauen, wenn hier der Komponist einer „unbestimmten Trauer“ (Hildesheimer)30 Ausdruck gibt. Auch lässt sich dieser Brief als Zeugnis für Mozarts „Erschöpfung“ lesen:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.