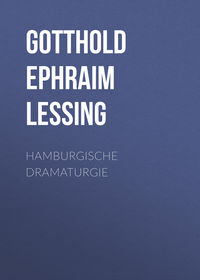Kitabı oku: «Hamburgische Dramaturgie», sayfa 33
Siebenundneunzigstes Stueck Den 5. April 1768
Diese Aufloesung, genau betrachtet, duerfte wohl nicht in allen Stuecken befriedigend sein. Denn zugegeben, dass fremde Sitten der Absicht der Komoedie nicht so gut entsprechen, als einheimische: so bleibt noch immer die Frage, ob die einheimischen Sitten nicht auch zur Absicht der Tragoedie ein besseres Verhaeltnis haben, als fremde? Diese Frage ist wenigstens durch die Schwierigkeit, einen einheimischen Vorfall ohne allzumerkliche und anstoessige Veraenderungen fuer die Buehne bequem zu machen, nicht beantwortet. Freilich erfodern einheimische Sitten auch einheimische Vorfaelle: wenn denn aber nur mit jenen die Tragoedie am leichtesten und gewissesten ihren Zweck erreichte, so muesste es ja doch wohl besser sein, sich ueber alle Schwierigkeiten, welche sich bei Behandlung dieser finden, wegzusetzen als in Absicht des Wesentlichsten zu kurz zu fallen, welches ohnstreitig der Zweck ist. Auch werden nicht alle einheimische Vorfaelle so merklicher und anstoessiger Veraenderungen beduerfen; und die deren beduerfen, ist man ja nicht verbunden zu bearbeiten. Aristoteles hat schon angemerkt, dass es gar wohl Begebenheiten geben kann und gibt, die sich vollkommen so ereignet haben, als sie der Dichter braucht. Da dergleichen aber nur selten sind, so hat er auch schon entschieden, dass sich der Dichter um den wenigern Teil seiner Zuschauer, der von den wahren Umstaenden vielleicht unterrichtet ist, lieber nicht bekuemmern, als seiner Pflicht minder Genuege leisten muesse.
Der Vorteil, den die einheimischen Sitten in der Komoedie haben, beruhet auf der innigen Bekanntschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu noetigen Beschreibungen und Winke ueberhoben; er kann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln lassen, ohne uns diese Sitten selbst erst langweilig zu schildern. Einheimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit und befoerdern bei dem Zuschauer die Illusion.
Warum sollte nun der tragische Dichter sich dieses wichtigen doppelten Vorteils begeben? Auch er hat Ursache, sich die Arbeit so viel als moeglich zu erleichtern, seine Kraefte nicht an Nebenzwecke zu verschwenden, sondern sie ganz fuer den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm koemmt auf die Illusion des Zuschauers alles an.—Man wird vielleicht hierauf antworten, dass die Tragoedie der Sitten nicht gross beduerfe; dass sie ihrer ganz und gar entuebriget sein koenne. Aber sonach braucht sie auch keine fremde Sitten; und von dem wenigen, was sie von Sitten haben und zeigen will, wird es doch immer besser sein, wenn es von einheimischen Sitten hergenommen ist, als von fremden.
Die Griechen wenigstens haben nie andere als ihre eigene Sitten, nicht bloss in der Komoedie, sondern auch in der Tragoedie, zum Grunde gelegt. Ja sie haben fremden Voelkern, aus deren Geschichte sie den Stoff ihrer Tragoedie etwa einmal entlehnten, lieber ihre eigenen griechischen Sitten leihen, als die Wirkungen der Buehne durch unverstaendliche barbarische Sitten entkraeften wollen. Auf das Kostuem, welches unsern tragischen Dichtern so aengstlich empfohlen wird, hielten sie wenig oder nichts. Der Beweis hiervon koennen vornehmlich die "Perser" des Aeschylus sein: und die Ursache, warum sie sich so wenig an das Kostuem binden zu duerfen glaubten, ist aus der Absicht der Tragoedie leicht zu folgern.
Doch ich gerate zu weit in denjenigen Teil des Problems, der mich itzt gerade am wenigsten angeht. Zwar indem ich behaupte, dass einheimische Sitten auch in der Tragoedie zutraeglicher sein wuerden, als fremde: so setze ich schon als unstreitig voraus, dass sie es wenigstens in der Komoedie sind. Und sind sie das, glaube ich wenigstens, dass sie es sind: so kann ich auch die Veraenderungen, welche Herr Romanus in Absicht derselben mit dem Stuecke des Terenz gemacht hat, ueberhaupt nicht anders als billigen.
Er hatte recht, eine Fabel, in welche so besondere griechische und roemische Sitten so innig verwebet sind, umzuschaffen. Das Beispiel erhaelt seine Kraft nur von seiner innern Wahrscheinlichkeit, die jeder Mensch nach dem beurteilet, was ihm selbst am gewoehnlichsten ist. Alle Anwendung faellt weg, wo wir uns erst mit Muehe in fremde Umstaende versetzen muessen. Aber es ist auch keine leichte Sache mit einer solchen Umschaffung. Je vollkommener die Fabel ist, desto weniger laesst sich der geringste Teil veraendern, ohne das Ganze zu zerruetten. Und schlimm! wenn man sich sodann nur mit Flicken begnuegt, ohne im eigentlichen Verstande umzuschaffen.
Das Stueck heisst "Die Brueder", und dieses bei dem Terenz aus einem doppelten Grunde. Denn nicht allein die beiden Alten, Micio und Demea, sondern auch die beiden jungen Leute, Aeschinus und Ktesipho, sind Brueder. Demea ist dieser beider Vater; Micio hat den einen, den Aeschinus, nur an Sohnes Statt angenommen. Nun begreif' ich nicht, warum unserm Verfasser diese Adoption missfallen. Ich weiss nicht anders, als dass die Adoption auch unter uns, auch noch itzt gebraeuchlich und vollkommen auf dem naemlichen Fuss gebraeuchlich ist, wie sie es bei den Roemern war. Demohngeachtet ist er davon abgegangen: bei ihm sind nur die zwei Alten Brueder, und jeder hat einen leiblichen Sohn, den er nach seiner Art erziehet. Aber desto besser! wird man vielleicht sagen. So sind denn auch die zwei Alten wirkliche Vaeter; und das Stueck ist wirklich eine Schule der Vaeter, d.i. solcher, denen die Natur die vaeterliche Pflicht aufgelegt, nicht solcher, die sie freiwillig zwar uebernommen, die sich ihrer aber schwerlich weiter unterziehen, als es mit ihrer eignen Gemaechlichkeit bestehen kann.
Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt!
Sehr wohl! Nur schade, dass durch Aufloesung dieses einzigen Knoten, welcher bei dem Terenz den Aeschinus und Ktesipho unter sich, und beide mit dem Demea, ihrem Vater, verbindet, die ganze Maschine auseinander faellt, und aus einem allgemeinen Interesse zwei ganz verschiedene entstehen, die bloss die Konvenienz des Dichters, und keineswegs ihre eigene Natur zusammenhaelt!
Denn ist Aeschinus nicht bloss der angenommene, sondern der leibliche Sohn des Micio, was hat Demea sich viel um ihn zu bekuemmern? Der Sohn eines Bruders geht mich so nahe nicht an, als mein eigener. Wenn ich finde, dass jemand meinen eigenen Sohn verziehet, geschaehe es auch in der besten Absicht von der Welt, so habe ich recht, diesem gutherzigen Verfuehrer mit aller der Heftigkeit zu begegnen, mit welcher, beim Terenz, Demea dem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ist, wenn es der eigene Sohn des Verziehers ist, was kann ich mehr, was darf ich mehr, als dass ich diesen Verzieher warne, und wenn er mein Bruder ist, ihn oefters und ernstlich warne? Unser Verfasser setzt den Demea aus dem Verhaeltnisse, in welchem er bei dem Terenz stehet, aber er laesst ihm die naemliche Ungestuemheit, zu welcher ihn doch nur jenes Verhaeltnis berechtigen konnte. Ja bei ihm schimpfet und tobet Demea noch weit aerger, als bei dem Terenz. Er will aus der Haut fahren, "dass er an seines Bruders Kinde Schimpf und Schande erleben muss". Wenn ihm nun aber dieser antwortete: "Du bist nicht klug, mein lieber Bruder, wenn du glaubest, du koenntest an meinem Kinde Schimpf und Schande erleben. Wenn mein Sohn ein Bube ist und bleibt, so wird, wie das Unglueck, also auch der Schimpf nur meine sein. Du magst es mit deinem Eifer wohl gut meinen; aber er geht zu weit; er beleidiget mich. Falls du mich nur immer so aergern wil1st, so komm mir lieber nicht ueber die Schwelle! usw." Wenn Micio, sage ich, dieses antwortete: nicht wahr, so waere die Komoedie auf einmal aus? Oder koennte Micio etwa nicht so antworten? Ja, muesste er wohl eigentlich nicht so antworten?
Wieviel schicklicher eifert Demea beim Terenz. Dieser Aeschinus, den er ein so liederliches Leben zu fuehren glaubt, ist noch immer sein Sohn, ob ihn gleich der Bruder an Kindes Statt angenommen. Und dennoch bestehet der roemische Micio weit mehr auf seinem Rechte als der deutsche. Du hast mir, sagt er, deinen Sohn einmal ueberlassen; bekuemmere dich um den, der dir noch uebrig ist;
—nam ambos curare; propemodum Reposcere illum est, quem dedisti—
Diese versteckte Drohung, ihm seinen Sohn zurueckzugeben, ist es auch, die ihn zum Schweigen bringt; und doch kann Micio nicht verlangen, dass sie alle vaeterliche Empfindungen bei ihm unterdruecken soll. Es muss den Micio zwar verdriessen, dass Demea auch in der Folge nicht aufhoert, ihm immer die naemlichen Vorwuerfe zu machen: aber er kann es dem Vater doch auch nicht verdenken, wenn er seinen Sohn nicht gaenzlich will verderben lassen. Kurz, der Demea des Terenz ist ein Mann, der fuer das Wohl dessen besorgt ist, fuer den ihm die Natur zu sorgen aufgab; er tut es zwar auf die unrechte Weise, aber die Weise macht den Grund nicht schlimmer. Der Demea unsers Verfassers hingegen ist ein beschwerlicher Zaenker, der sich aus Verwandtschaft zu allen Grobheiten berechtiget glaubt, die Micio auf keine Weise an dem blossen Bruder dulden muesste.
Achtundneunzigstes Stueck Den 8. April 1768
Ebenso schielend und falsch wird, durch Aufhebung der doppelten Bruederschaft, auch das Verhaeltnis der beiden jungen Leute. Ich verdenke es dem deutschen Aeschinus, dass er159 "vielmals an den Torheiten des Ktesipho Anteil nehmen zu muessen geglaubt, um ihn, als seinen Vetter, der Gefahr und oeffentlichen Schande zu entreissen". Was Vetter? Und schickt es sich wohl fuer den leiblichen Vater, ihm darauf zu antworten: "Ich billige deine hierbei bezeugte Sorgfalt und Vorsicht; ich verwehre dir es auch inskuenftige nicht?" Was verwehrt der Vater dem Sohne nicht? An den Torheiten eines ungezogenen Vetters Anteil zu nehmen? Wahrlich, das sollte er ihm verwehren. "Suche deinen Vetter", muesste er ihm hoechstens sagen, "soviel moeglich von Torheiten abzuhalten: wenn du aber findest, dass er durchaus darauf besteht, so entziehe dich ihm; denn dein guter Name muss dir wertet sein, als seiner."
Nur dem leiblichen Bruder verzeihen wir, hierin weiter zu gehen. Nur an leiblichen Bruedern kann es uns freuen, wenn einer von dem andern ruehmet:
–Illius opera nunc vivo! Festivum caput, Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:
Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit.
Denn der bruederlichen Liebe wollen wir von der Klugheit keine Grenzen gesetzt wissen. Zwar ist es wahr, dass unser Verfasser seinem Aeschinus die Torheit ueberhaupt zu ersparen gewusst hat, die der Aeschinus des Terenz fuer seinen Bruder begehet. Eine gewaltsame Entfuehrung hat er in eine kleine Schlaegerei verwandelt, an welcher sein wohlgezogner Juengling weiter keinen Teil hat, als dass er sie gern verhindern wollen. Aber gleichwohl laesst er diesen wohlgezognen Juengling fuer einen ungezognen Vetter noch viel zuviel tun. Denn muesste es jener wohl auf irgendeine Weise gestatten, dass dieser ein Kreatuerchen, wie Citalise ist, zu ihm in das Haus braechte? in das Haus seines Vaters? unter die Augen seiner tugendhaften Geliebten? Es ist nicht der verfuehrerische Damis, diese Pest fuer junge Leute,160 dessentwegen der deutsche Aeschinus seinem liederlichen Vetter die Niederlage bei sich erlaubt: es ist die blosse Konvenienz des Dichters.
Wie vortrefflich haengt alles das bei dem Terenz zusammen! Wie richtig und notwendig ist da auch die geringste Kleinigkeit motivieret! Aeschinus nimmt einem Sklavenhaendler ein Maedchen mit Gewalt aus dem Hause, in das sich sein Bruder verliebt hat. Aber er tut das, weniger um der Neigung seines Bruders zu willfahren, als um einem groessern Uebel vorzubauen. Der Sklavenhaendler will mit diesem Maedchen unverzueglich auf einen auswaertigen Markt: und der Bruder will dem Maedchen nach; will lieber sein Vaterland verlassen, als den Gegenstand seiner Liebe aus den Augen verlieren.161 Noch erfaehrt Aeschinus zu rechter Zeit diesen Entschluss. Was soll er tun? Er bemaechtiget sich in der Geschwindigkeit des Maedchens und bringt sie in das Haus seines Oheims, um diesem guetigen Manne den ganzen Handel zu entdecken. Denn das Maedchen ist zwar entfuehrt, aber sie muss ihrem Eigentuemer doch bezahlt werden. Micio bezahlt sie auch ohne Anstand und freuet sich nicht sowohl ueber die Tat der jungen Leute, als ueber die bruederliche Liebe, welche er zum Grunde siehet, und ueber das Vertrauen, welches sie auf ihn dabei setzen wollen. Das Groesste ist geschehen; warum sollte er nicht noch eine Kleinigkeit hinzufuegen, ihnen einen vollkommen vergnuegten Tag zu machen?
–Argentum adnumeravit illico:
Dedit praeterea in sumptum dimidium minae.
Hat er dem Ktesipho das Maedchen gekauft, warum soll er ihm nicht verstatten, sich in seinem Hause mit ihr zu vergnuegen? Da ist nach den alten Sitten nichts, was im geringsten der Tugend und Ehrbarkeit widerspraeche.
Aber nicht so in unsern "Bruedern"! Das Haus des guetigen Vaters wird auf das ungeziemendste gemissbraucht. Anfangs ohne sein Wissen, und endlich gar mit seiner Genehmigung. Citalise ist eine weit unanstaendigere Person, als selbst jene Psaltria; und unser Ktesipho will sie gar heiraten. Wenn das der Terenzische Ktesipho mit seiner Psaltria vorgehabt haette, so wuerde sich der Terenzische Micio sicherlich ganz anders dabei genommen haben. Er wuerde Citalisen die Tuere gewiesen und mit dem Vater die kraeftigsten Mittel verabredet haben, einen sich so straeflich emanzipierenden Burschen im Zaume zu halten.
Ueberhaupt ist der deutsche Ktesipho von Anfang viel zu verderbt geschildert, und auch hierin ist unser Verfasser von seinem Muster abgegangen. Die Stelle erweckt mir immer Grausen, wo er sich mit seinem Vetter ueber seinen Vater unterhaelt.
"Leander. Aber wie reimt sich das mit der Ehrfurcht, mit der Liebe, die du deinem Vater schuldig bist?
Lykast. Ehrfurcht? Liebe? hm! die wird er wohl nicht von mir verlangen.
Leander. Er sollte sie nicht verlangen?
Lykast. Nein, gewiss nicht. Ich habe meinen Vater gar nicht lieb.
Ich muesste es luegen, wenn ich es sagen wollte.
Leander. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkst nicht, was du sagst. Denjenigen nicht lieben, der dir das Leben gegeben hat! So sprichst du itzt, da du ihn noch leben siehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich dich fragen.
Lykast. Hm! Ich weiss nun eben nicht, was da geschehen wuerde. Auf allen Fall wuerde ich wohl auch so gar unrecht nicht tun. Denn ich glaube, er wuerde es auch nicht besser machen. Er spricht ja fast taeglich zu mir: 'Wenn ich dich nur los waere! wenn du nur weg waerest!' Heisst das Liebe? Kannst du verlangen, dass ich ihn wieder lieben soll?"
Auch die strengste Zucht muesste ein Kind zu so unnatuerlichen Gesinnungen nicht verleiten. Das Herz, das ihrer, aus irgendeiner Ursache, faehig ist, verdienst nicht anders als sklavisch gehalten zu werden. Wenn wir uns des ausschweifenden Sohnes gegen den strengen Vater annehmen sollen: so muessen jenes Ausschweifungen kein grundboeses Herz verraten; es muessen nichts als Ausschweifungen des Temperaments, jugendliche Unbedachtsamkeiten, Torheiten des Kitzels und Mutwillens sein. Nach diesem Grundsatze haben Menander und Terenz ihren Ktesipho geschildert. So streng ihn sein Vater haelt, so entfaehrt ihm doch nie das geringste boese Wort gegen denselben. Das einzige, was man so nennen koennte, macht er auf die vortrefflichste Weise wieder gut. Er moechte seiner Liebe gern wenigstens ein paar Tage ruhig geniessen; er freuet sich, dass der Vater wieder hinaus auf das Land, an seine Arbeit ist; und wuenscht, dass er sich damit so abmatten,—so abmatten moege, dass er ganze drei Tage nicht aus dem Bette koenne. Ein rascher Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusatze:
—utinam quidem Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim, Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Quod cum salute ejus fiat! Nur muesste es ihm weiter nicht schaden!—So recht! so recht, liebenswuerdiger Juengling! Immer geh, wohin dich Freunde und Liebe rufen! Fuer dich druecken wir gern ein Auge zu! Das Boese, das du begehst, wird nicht sehr boese sein! Du hast einen strengern Aufseher in dir, als selbst dein Vater ist!—Und so sind mehrere Zuege in der Szene, aus der diese Stelle genommen ist. Der deutsche Ktesipho ist ein abgefeimter Bube, dem Luegen und Betrug sehr gelaeufig sind: der roemische hingegen ist in der aeussersten Verwirrung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Vater rechtfertigen koennte.
Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam? SY. Nil ne in mentem venit? CT. Nunquam quicquam.
SY. Tanto nequior.
Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? CT. Sunt, quid postea?
SY. Hisce opera ut data sit? CT. Quae non data sit? Non potest fieri!
Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Juengling sucht einen Vorwand; und der schalkische Knecht schlaegt ihm eine Luege vor. Eine Luege! Nein, das geht nicht: non potest fieri!
Neunundneunzigstes Stueck Den 12. April 1768
Sonach hatte Terenz auch nicht noetig, uns seinen Ktesipho am Ende des Stuecks beschaemt, und durch die Beschaemung auf dem Wege der Besserung, zu zeigen. Wohl aber musste dieses unser Verfasser tun. Nur fuerchte ich, dass der Zuschauer die kriechende Reue und die furchtsam Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht fuer sehr aufrichtig halten kann. Ebensowenig als die Gemuetsaenderung seines Vaters. Beider Umkehrung ist so wenig in ihrem Charakter gegruendet, dass man das Beduerfnis des Dichters, sein Stueck schliessen zu muessen, und die Verlegenheit, es auf eine bessere Art zu schliessen, ein wenig zu sehr darin empfindet.—Ich weiss ueberhaupt nicht, woher so viele komische Dichter die Regel genommen haben, dass der Boese notwendig am Ende des Stuecks entweder bestraft werden oder sich bessern muesse. In der Tragoedie moechte diese Regel noch eher gelten; sie kann uns da mit dem Schicksale versoehnen und Murren in Mitleid kehren. Aber in der Komoedie, denke ich, hilft sie nicht allein nichts, sondern sie verdirbt vielmehr vieles. Wenigstens macht sie immer den Ausgang schielend und kalt und einfoermig. Wenn die verschiednen Charaktere, welche ich in eine Handlung verbinde, nur diese Handlung zu Ende bringen, warum sollen sie nicht bleiben, wie sie waren? Aber freilich muss die Handlung sodann in etwas mehr, als in einer blossen Kollision der Charaktere bestehen. Diese kann allerdings nicht anders, als durch Nachgebung und Veraenderung des einen Teiles dieser Charaktere geendet werden; und ein Stueck, das wenig oder nichts mehr hat als sie, naehert sich nicht sowohl seinem Ziele, sondern schlaeft vielmehr nach und nach ein. Wenn hingegen jene Kollision, die Handlung mag sich ihrem Ende naehern soviel als sie will, dennoch gleich stark fortdauert: so begreift man leicht, dass das Ende ebenso lebhaft und unterhaltend sein kann, als die Mitte nur immer war. Und das ist gerade der Unterschied, der sich zwischen dem letzten Akte des Terenz und dem letzten unsers Verfassers befindet. Sobald wir in diesem hoeren, dass der strenge Vater hinter die Wahrheit gekommen: so koennen wir uns das uebrige alles an den Fingern abzaehlen; denn es ist der fuenfte Akt. Er wird anfangs poltern und toben; bald darauf wird er sich besaenftigen lassen, wird sein Unrecht erkennen und so werden wollen, dass er nie wieder zu einer solchen Komoedie den Stoff geben kann: desgleichen wird der ungeratene Sohn kommen, wird abbitten, wird sich zu bessern versprechen; kurz, alles wird ein Herz und eine Seele werden. Den hingegen will ich sehen, der in dem fuenften Akte des Terenz die Wendungen des Dichters erraten kann! Die Intrige ist laengst zu Ende, aber das fortwaehrende Spiel der Charaktere laesst es uns kaum bemerken, dass sie zu Ende ist. Keiner veraendert sich; sondern jeder schleift nur dem andern ebensoviel ab, als noetig ist, ihn gegen den Nachteil des Exzesses zu verwahren. Der freigebige Micio wird durch das Manoever des geizigen Demea dahin gebracht, dass er selbst das Uebermass in seinem Bezeigen erkennst, und fragt:
Quod proluvium? quae istaec subita est largitas?
So wie umgekehrt der strenge Demea durch das Manoever des nachsichtsvollen Micio endlich erkennet, dass es nicht genug ist, nur immer zu tadeln und zu bestrafen, sondern es auch gut sei, obsecundare in loco.—
Noch eine einzige Kleinigkeit will ich erinnern, in welcher unser Verfasser sich, gleichfalls zu seinem eigenen Nachteile, von seinem Muster entfernt hat.
Terenz sagt es selbst, dass er in die "Brueder" des Menanders eine Episode aus einem Stuecke des Diphilus uebertragen, und so seine "Brueder" zusammengesetzt habe. Diese Episode ist die gewaltsame Entfuehrung der Psaltria durch den Aeschinus: und das Stueck des Diphilus hiess: "Die miteinander Sterbenden".
Synapothnescontes Diphili comoedia est—
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula—
–eum hic locum sumpsit sibi
In Adelphos—
Nach diesen beiden Umstaenden zu urteilen, mochte Diphilus ein Paar Verliebte aufgefuehret haben, die fest entschlossen waren, lieber miteinander zu sterben, als sich trennen zu lassen: und wer weiss, was geschehen waere, wenn sich gleichfalls nicht ein Freund ins Mittel geschlagen und das Maedchen fuer den Liebhaber mit Gewalt entfuehrt haette? Den Entschluss, miteinander zu sterben, hat Terenz in den blossen Entschluss des Liebhabers, dem Maedchen nachzufliehen und Vater und Vaterland um sie zu verlassen, gemildert. Donatus sagt dieses ausdruecklich: Menander mori illum voluisse fingit, Terentius fugere. Aber sollte es in dieser Note des Donatus nicht Diphilus anstatt Menander heissen? Ganz gewiss; wie Peter Nannius dieses schon angemerkt hat.162 Denn der Dichter, wie wir gesehen, sagt es ja selbst, dass er diese ganze Episode von der Entfuehrung nicht aus dem Menander, sondern aus dem Diphilus entlehnet habe; und das Stueck des Diphilus hatte von dem Sterben sogar seinen Titel.
Indes muss freilich, anstatt dieser von dem Diphilus entlehnten Entfuehrung, in dem Stuecke des Menanders eine andere Intrige gewesen sein, an der Aeschinus gleicherweise fuer den Ktesipho Anteil nahm, und wodurch er sich bei seiner Geliebten in eben den Verdacht brachte, der am Ende ihre Verbindung so gluecklich beschleunigte. Worin diese eigentlich bestanden, duerfte schwer zu erraten sein. Sie mag aber bestanden haben, worin sie will: so wird sie doch gewiss ebensowohl gleich vor dem Stuecke vorhergegangen sein, als die vom Terenz dafuer gebrauchte Entfuehrung. Denn auch sie muss es gewesen sein, wovon man noch ueberall sprach, als Demea in die Stadt kam; auch sie muss die Gelegenheit und der Stoff gewesen sein, worueber Demea gleich anfangs mit seinem Bruder den Streit beginnet, in welchem sich beider Gemuetsarten so vortrefflich entwickeln.
—Nam illa, quae antehac facta sunt
Omitto: modo quid designavit?—
Fores effregit, atque in aedes irruit
Alienas—
–clamant omnes, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixere? in ore est omni populo—
Nun habe ich schon gesagt, dass unser Verfasser diese gewaltsame Entfuehrung in eine kleine Schlaegerei verwandelt hat. Er mag auch seine guten Ursachen dazu gehabt haben; wenn er nur diese Schlaegerei selbst nicht so spaet haette geschehen lassen. Auch sie sollte und muesste das sein, was den strengen Vater aufbringt. So aber ist er schon aufgebracht, ehe sie geschieht, und man weiss gar nicht worueber? Er tritt auf und zankt, ohne den geringsten Anlass. Er sagt zwar: "Alle Leute reden von der schlechten Auffuehrung deines Sohnes; ich darf nur einmal den Fuss in die Stadt setzen, so hoere ich mein blaues Wunder." Aber was denn die Leute eben itzt reden; worin das blaue Wunder bestanden, das er eben itzt gehoert und worueber er ausdruecklich mit seinem Bruder zu zanken koemmt, das hoeren wir nicht und koennen es auch aus dem Stuecke nicht erraten. Kurz, unser Verfasser haette den Umstand, der den Demea in Harnisch bringt, zwar veraendern koennen, aber er haette ihn nicht versetzen muessen! Wenigstens, wenn er ihn versetzen wollen, haette er den Demea im ersten Akte seine Unzufriedenheit mit der Erziehungsart seines Bruders nur nach und nach muessen aeussern, nicht aber auf einmal damit herausplatzen lassen.—
Moechten wenigstens nur diejenigen Stuecke des Menanders auf uns gekommen sein, welche Terenz genutzet hat! Ich kann mir nichts Unterrichtenderes denken, als eine Vergleichung dieser griechischen Originale mit den lateinischen Kopien sein wuerde.
Denn gewiss ist es, dass Terenz kein blosser sklavischer Uebersetzer gewesen. Auch da, wo er den Faden des Menandrischen Stueckes voellig beibehalten, hat er sich noch manchen kleinen Zusatz, manche Verstaerkung oder Schwaechung eines und des andern Zuges erlaubt; wie uns deren verschiedne Donatus in seinen Scholien angezeigt. Nur schade, dass sich Donatus immer so kurz und oefters so dunkel darueber ausdrueckt (weil zu seiner Zeit die Stuecke des Menanders noch selbst in jedermanns Haenden waren), dass es schwer wird, ueber den Wert oder Unwert solcher Terenzischen Kuensteleien etwas Zuverlaessiges zu sagen. In den "Bruedern" findet sich hiervon ein sehr merkwuerdiges Exempel.
Ae. Hoc mihi dolet, nos paene sero scisse: et paene in eum locum
Rediisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier.
Ct. Pudebat. Ae. Ah, stultitia est istaec; non pudor, tam ob
parvulam
Rem paene e patria: turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant.
1. Erster Aufz., 6. Auftr.