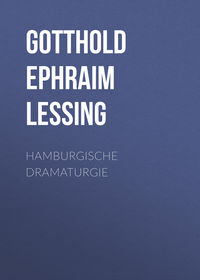Kitabı oku: «Hamburgische Dramaturgie», sayfa 8
Einundzwanzigstes Stueck Den 10. Julius 1767
Den sechsundzwanzigsten Abend (freitags, den 29. Mal) ward "Die Muetterschule" des Nivelle de la Chaussee aufgefuehret.
Es ist die Geschichte einer Mutter, die fuer ihre parteiische Zaertlichkeit gegen einen nichtswuerdigen schmeichlerischen Sohn die verdiente Kraenkung erhaelt. Marivaux hat auch ein Stueck unter diesem Titel. Aber bei ihm ist es die Geschichte einer Mutter, die ihre Tochter, um ein recht gutes, gehorsames Kind an ihr zu haben, in aller Einfalt erziehet, ohne alle Welt und Erfahrung laesst: und wie geht es damit? Wie man leicht erraten kann. Das liebe Maedchen hat ein empfindliches Herz; sie weiss keiner Gefahr auszuweichen, weil sie keine Gefahr kennet; sie verliebt sich in den ersten in den besten, ohne Mama darum zu fragen, und Mama mag dem Himmel danken, dass es noch so gut ablaeuft. In jener Schule gibt es eine Menge ernsthafte Betrachtungen anzustellen; in dieser setzt es mehr zu lachen. Die eine ist der Pendant der andern; und ich glaube, es muesste fuer Kenner ein Vergnuegen mehr sein, beide an einem Abende hintereinander besuchen zu koennen. Sie haben hierzu auch alle aeusserliche Schicklichkeit; das erste Stueck ist von fuenf Akten, das andere von einem.
Den siebenundzwanzigsten Abend (montags, den 1. Junius) ward die "Nanine" des Herrn von Voltaire gespielt.
Nanine? fragten sogenannte Kunstrichter, als dieses Lustspiel im Jahre 1749 zuerst erschien. Was ist das fuer ein Titel? Was denkt man dabei?—Nicht mehr und nicht weniger, als man bei einem Titel denken soll. Ein Titel muss kein Kuechenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalte verraet, desto besser ist er. Dichter und Zuschauer finden ihre Rechnung dabei, und die Alten haben ihren Komoedien selten andere, als nichtsbedeutende Titel gegeben. Ich kenne kaum drei oder viere, die den Hauptcharakter anzeigten oder etwas von der Intrige verrieten. Hierunter gehoeret des Plautus "Miles gloriosus". Wie koemmt es, dass man noch nicht angemerket, dass dieser Titel dem Plautus nur zur Haelfte gehoeren kann. Plautus nannte sein Stueck bloss Gloriosus; so wie er ein anderes "Truculentus" ueberschrieb. Miles muss der Zusatz eines Grammatikers sein. Es ist wahr, der Prahler, den Plautus schildert, ist ein Soldat; aber seine Prahlereien beziehen sich nicht bloss auf seinen Stand und seine kriegerische Taten. Er ist in dem Punkte der Liebe ebenso grosssprecherisch; er ruehmt sich nicht allein der tapferste, sondern auch der schoenste und liebenswuerdigste Mann zu sein. Beides kann in dem Worte Gloriosus liegen; aber sobald man Miles hinzufuegt, wird das gloriosus nur auf das erstere eingeschraenkt. Vielleicht hat den Grammatiker, der diesen Zusatz machte, eine Stelle des Cicero12 verfuehrt; aber hier haette ihm Plautus selbst mehr als Cicero gelten sollen. Plautus selbst sagt:
ALAZON Graece huic nomen est Comoediae
Id nos latine GLORIOSUM dicimus—
und in der Stelle des Cicero ist es noch gar nicht ausgemacht, dass eben das Stueck des Plautus gemeinet sei. Der Charakter eines grosssprecherischen Soldaten kam in mehrern Stuecken vor. Cicero kann ebensowohl auf den Thraso des Terenz gezielet haben.—Doch dieses beilaeufig. Ich erinnere mich, meine Meinung von den Titeln der Komoedien ueberhaupt schon einmal geaeussert zu haben. Es koennte sein, dass die Sache so unbedeutend nicht waere. Mancher Stuemper hat zu einem schoenen Titel eine schlechte Komoedie gemacht; und bloss des schoenen Titels wegen. Ich moechte doch lieber eine gute Komoedie mit einem schlechten Titel. Wenn man nachfragt, was fuer Charaktere bereits bearbeitet worden, so wird kaum einer zu erdenken sein, nach welchem, besonders die Franzosen, nicht schon ein Stueck genannt haetten. Der ist laengst dagewesen! ruft man. Der auch schon! Dieser wuerde vom Moliere, jener vom Destouches entlehnet sein! Entlehnet? Das koemmt aus den schoenen Titeln. Was fuer ein Eigentumsrecht erhaelt ein Dichter auf einen gewissen Charakter dadurch, dass er seinen Titel davon hergenommen? Wenn er ihn stillschweigend gebraucht haette, so wuerde ich ihn wiederum stillschweigend brauchen duerfen, und niemand wuerde mich darueber zum Nachahmer machen. Aber so wage es einer einmal, und mache z.E. einen neuen Misanthropen. Wenn er auch keinen Zug von dem Moliereschen nimmt, so wird sein Misanthrop doch immer nur eine Kopie heissen. Genug, dass Moliere den Namen zuerst gebraucht hat. Jener hat unrecht, dass er funfzig Jahr spaeter lebet; und dass die Sprache fuer die unendlichen Varietaeten des menschlichen Gemuets nicht auch unendliche Benennungen hat.
Wenn der Titel "Nanine" nichts sagt, so sagt der andere Titel desto mehr: "Nanine, oder das besiegte Vorurteil". Und warum soll ein Stueck nicht zwei Titel haben? Haben wir Menschen doch auch zwei, drei Namen. Die Namen sind der Unterscheidung wegen; und mit zwei Namen ist die Verwechselung schwerer, als mit einem. Wegen des zweiten Titels scheinet der Herr von Voltaire noch nicht recht einig mit sich gewesen zu sein. In der naemlichen Ausgabe seiner Werke heisst er auf einem Blatte "Das besiegte Vorurteil"; und auf dem andern "Der Mann ohne Vorurteil". Doch beides ist nicht weit auseinander. Es ist von dem Vorurteile, dass zu einer vernuenftigen Ehe die Gleichheit der Geburt und des Standes erforderlich sei, die Rede. Kurz, die Geschichte der Nanine ist die Geschichte der Pamela. Ohne Zweifel wollte der Herr von Voltaire den Namen Pamela nicht brauchen, weil schon einige Jahre vorher ein paar Stuecke unter diesem Namen erschienen waren, und eben kein grosses Glueck gemacht hatten. Die "Pamela" des Boissy und des de la Chaussee sind auch ziemlich kahle Stuecke; und Voltaire brauchte eben nicht Voltaire zu sein, etwas weit Besseres zu machen.
"Nanine" gehoert unter die ruehrenden Lustspiele. Es hat aber auch sehr viel laecherliche Szenen, und nur insofern, als die laecherlichen Szenen mit den ruehrenden abwechseln, will Voltaire diese in der Komoedie geduldet wissen. Eine ganz ernsthafte Komoedie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal laechelt, wo man nur immer weinen moechte, ist ihm ein Ungeheuer. Hingegen findet er den Uebergang von dem Ruehrenden zum Laecherlichen und von dem Laecherlichen zum Ruehrenden sehr natuerlich. Das menschliche Leben ist nichts als eine bestaendige Kette solcher Uebergaenge, und die Komoedie soll ein Spiegel des menschlichen Lebens sein. "Was ist gewoehnlicher", sagt er, "als dass in dem naemlichen Hause der zornige Vater poltert, die verliebte Tochter seufzet, der Sohn sich ueber beide aufhaelt und jeder Anverwandte bei der naemlichen Szene etwas anders empfindet? Man verspottet in einer Stube sehr oft, was in der Stube nebenan aeusserst bewegt; und nicht selten hat ebendieselbe Person in ebenderselben Viertelstunde ueber ebendieselbe Sache gelacht und geweinet. Eine sehr ehrwuerdige Matrone sass bei einer von ihren Toechtern, die gefaehrlich krank lag, am Bette, und die ganze Familie stand um ihr herum. Sie wollte in Traenen zerfliessen, sie rang die Haende und rief: 'O Gott, lass mir, lass mir dieses Kind, nur dieses; magst du mir doch alle die andern dafuer nehmen!' Hier trat ein Mann, der eine von ihren uebrigen Toechtern geheiratet hatte, naeher zu ihr hinzu, zupfte sie bei dem Aermel und fragte: 'Madame, auch die Schwiegersoehne?' Das kalte Blut, der komische Ton, mit denen er diese Worte aussprach, machten einen solchen Eindruck auf die betruebte Dame, dass sie in vollem Gelaechter herauslaufen musste; alles folgte ihr und lachte; die Kranke selbst, als sie es hoerte, waere vor Lachen fast erstickt."
"Homer", sagt er an einem andern Orte, "laesst sogar die Goetter, indem sie das Schicksal der Welt entscheiden, ueber den possierlichen Anstand des Vulkans lachen. Hektor lacht ueber die Furcht seines kleinen Sohnes, indem Andromacha die heissesten Traenen vergiesst. Es trifft sich wohl, dass mitten unter den Greueln einer Schlacht, mitten in den Schrecken einer Feuersbrunst oder sonst eines traurigen Verhaengnisses, ein Einfall, eine ungefaehre Posse, trotz aller Beaengstigung, trotz alles Mitleids das unbaendigste Lachen erregt. Man befahl in der Schlacht bei Speyern einem Regimente, dass es keinen Pardon geben sollte. Ein deutscher Offizier bat darum, und der Franzose, den er darum bat, antwortete: 'Bitten Sie, mein Herr, was Sie wollen, nur das Leben nicht; damit kann ich unmoeglich dienen!' Diese Naivetaet ging sogleich von Mund zu Munde; man lachte und metzelte. Wie viel eher wird nicht in der Komoedie das Lachen auf ruehrende Empfindungen folgen koennen? Bewegt uns nicht Alkmene? Macht uns nicht Sosias zu lachen? Welche elende und eitle Arbeit, wider die Erfahrung streiten zu wollen."
Sehr wohl! Aber streitet nicht auch der Herr von Voltaire wider die Erfahrung, wenn er die ganz ernsthafte Komoedie fuer eine ebenso fehlerhafte als langweilige Gattung erklaeret? Vielleicht damals, als er es schrieb, noch nicht. Damals war noch keine "Cenie", noch kein "Hausvater" vorhanden; und vieles muss das Genie erst wirklich machen, wenn wir es fuer moeglich erkennen sollen.
Zweiundzwanzigstes Stueck Den 14. Julius 1767
Den achtundzwanzigsten Abend (dienstags, den 2. Junius) ward der "Advokat Patelin" wiederholt, und mit der "Kranken Frau" des Herrn Gellert beschlossen.
Ohnstreitig ist unter allen unsern komischen Schriftstellern Herr Gellert derjenige, dessen Stuecke das meiste urspruenglich Deutsche haben. Es sind wahre Familiengemaelde, in denen man sogleich zu Hause ist; jeder Zuschauer glaubt, einen Vetter, einen Schwager, ein Muehmchen aus seiner eigenen Verwandtschaft darin zu erkennen. Sie beweisen zugleich, dass es an Originalnarren bei uns gar nicht mangelt, und dass nur die Augen ein wenig selten sind, denen sie sich in ihrem wahren Lichte zeigen. Unsere Torheiten sind bemerkbarer, als bemerkt; im gemeinen Leben sehen wir ueber viele aus Gutherzigkeit hinweg; und in der Nachahmung haben sich unsere Virtuosen an eine allzu flache Manier gewoehnet. Sie machen sie aehnlich, aber nicht hervorspringend. Sie treffen; aber da sie ihren Gegenstand nicht vorteilhaft genug zu beleuchten gewusst, so mangelt dem Bilde die Rundung, das Koerperliche; wir sehen nur immer eine Seite, an der wir uns bald satt gesehen, und deren allzu schneidende Aussenlinien uns gleich an die Taeuschung erinnern, wenn wir in Gedanken um die uebrigen Seiten herumgehen wollen. Die Narren sind in der ganzen Welt platt und frostig und ekel; wann sie belustigen sollen, muss ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muss sie nicht in ihrer Alltagskleidung, in der schmutzigen Nachlaessigkeit auf das Theater bringen, in der sie innerhalb ihren vier Pfaehlen herumtraeumen. Sie muessen nichts von der engen Sphaere kuemmerlicher Umstaende verraten, aus der sich ein jeder gern herausarbeiten will. Er muss sie aufputzen; er muss ihnen Witz und Verstand leihen, das Armselige ihrer Torheiten bemaenteln zu koennen; er muss ihnen den Ehrgeiz geben, damit glaenzen zu wollen.
"Ich weiss gar nicht", sagte eine von meinen Bekanntinnen, "was das fuer ein Paar zusammen ist, dieser Herr Stephan und diese Frau Stephan! Herr Stephan ist ein reicher Mann und ein guter Mann. Gleichwohl muss seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Andrienne so viel Umstaende machen! Wir sind freilich sehr oft um ein Nichts krank; aber doch um ein so gar grosses Nichts nicht. Eine neue Andrienne! Kann sie nicht hinschicken, und ausnehmen lassen, und machen lassen? Der Mann wird ja wohl bezahlen; und er muss ja wohl."
"Ganz gewiss!" sagte eine andere. "Aber ich habe noch etwas zu erinnern. Der Dichter schrieb zu den Zeiten unserer Muetter. Eine Andrienne! Welche Schneidersfrau traegt denn noch eine Andrienne? Es ist nicht erlaubt, dass die Aktrice hier dem guten Manne nicht ein wenig nachgeholfen! Konnte sie nicht Roberonde, Benedictine, Respectueuse"—(ich habe die andern Namen vergessen, ich wuerde sie auch nicht zu schreiben wissen)—"dafuer sagen! Mich in einer Andrienne zu denken; das allein koennte mich krank machen. Wenn es der neueste Stoff ist, wornach Madame Stephan lechzet, so muss es auch die neueste Tracht sein. Wie koennen wir es sonst wahrscheinlich finden, dass sie darueber krank geworden?"
"Und ich", sagte eine dritte (es war die gelehrteste), "finde es sehr unanstaendig, dass die Stephan ein Kleid anzieht, das nicht auf ihren Leib gemacht worden. Aber man sieht wohl, was den Verfasser zu dieser—wie soll ich es nennen?—Verkennung unserer Delikatesse gezwungen hat. Die Einheit der Zeit! Das Kleid musste fertig sein; die Stephan sollte es noch anziehen; und in vierundzwanzig Stunden wird nicht immer ein Kleid fertig. Ja, er durfte sich nicht einmal zu einem kleinen Nachspiele vierundzwanzig Stunden gar wohl erlauben. Denn Aristoteles sagt"—Hier ward meine Kunstrichterin unterbrochen.
Den neunundzwanzigsten Abend (mittewochs, den 3. Junius) ward nach der "Melanide" des de la Chaussee "Der Mann nach der Uhr, oder der ordentliche Mann" gespielet.
Der Verfasser dieses Stuecks ist Herr Hippel, in Danzig. Es ist reich an drolligen Einfaellen; nur schade, dass ein jeder, sobald er den Titel hoert, alle diese Einfaelle voraussieht. National ist es auch genug; oder vielmehr provinzial. Und dieses koennte leicht das andere Extremum werden, in das unsere komischen Dichter verfielen, wenn sie wahre deutsche Sitten schildern wollten. Ich fuerchte, dass jeder die armseligen Gewohnheiten des Winkels, in dem er geboren worden, fuer die eigentlichen Sitten des gemeinschaftlichen Vaterlandes halten duerfte. Wem aber liegt daran, zu erfahren, wievielmal im Jahre man da oder dort gruenen Kohl isst?
Ein Lustspiel kann einen doppelten Titel haben; doch versteht sich, dass jeder etwas anders sagen muss. Hier ist das nicht; "Der Mann nach der Uhr", oder "Der ordentliche Mann" sagen ziemlich das naemliche; ausser dass das erste ohngefaehr die Karikatur von dem andern ist.
Den dreissigsten Abend (donnerstags, den 4. Junius) ward der "Graf von Essex", vom Thomas Corneille, auf gefuehrt. Dieses Trauerspiel ist fast das einzige, welches sich aus der betraechtlichen Anzahl der Stuecke des juengern Corneille auf dem Theater erhalten hat. Und ich glaube, es wird auf den deutschen Buehnen noch oefterer wiederholt, als auf den franzoesischen. Es ist vom Jahre 1678, nachdem vierzig Jahre vorher bereits Calprenede die naemliche Geschichte bearbeitet hatte.
"Es ist gewiss", schreibt Corneille, "dass der Graf von Essex bei der Koenigin Elisabeth in besondern Gnaden gestanden. Er war von Natur sehr stolz. Die Dienste, die er England geleistet hatte, bliesen ihn noch mehr auf. Seine Feinde beschuldigten ihn eines Verstaendnisses mit dem Grafen von Tyrone, den die Rebellen in Irland zu ihrem Haupte erwaehlet hatten. Der Verdacht, der dieserwegen auf ihm blieb, brachte ihn um das Kommando der Armee. Er ward erbittert, kam nach London, wiegelte das Volk auf, ward in Verhaft gezogen, verurteilt, und nachdem er durchaus nicht um Gnade bitten wollen, den 25. Februar 1601 enthauptet. So viel hat mir die Historie an die Hand gegeben. Wenn man mir aber zur Last legt, dass ich sie in einem wichtigen Stuecke verfaelscht haette, weil ich mich des Vorfalles mit dem Ringe nicht bedienet, den die Koenigin dem Grafen zum Unterpfande ihrer unfehlbaren Begnadigung, falls er sich jemals eines Staatsverbrechens schuldig machen sollte, gegeben habe: so muss mich dieses sehr befremden. Ich bin versichert, dass dieser Ring eine Erfindung des Calprenede ist, wenigstens habe ich in keinem Geschichtschreiber das geringste davon gelesen."
Allerdings stand es Corneillen frei, diesen Umstand mit dem Ringe zu nutzen oder nicht zu nutzen; aber darin ging er zu weit, dass er ihn fuer eine poetische Erfindung erklaerte. Seine historische Richtigkeit ist neuerlich fast ausser Zweifel gesetzt worden; und die bedaechtlichsten, skeptischsten Geschichtschreiber, Hume und Robertson, haben ihn in ihre Werke aufgenommen.
Wenn Robertson in seiner Geschichte von Schottland von der Schwermut redet, in welche Elisabeth vor ihrem Tode verfiel, so sagt er: "Die gemeinste Meinung damaliger Zeit, und vielleicht die wahrscheinlichste war diese, dass dieses Uebel aus einer betruebten Reue wegen des Grafen von Essex entstanden sei. Sie hatte eine ganz ausserordentliche Achtung fuer das Andenken dieses ungluecklichen Herrn; und wiewohl sie oft ueber seine Hartnaeckigkeit klagte, so nannte sie doch seinen Namen selten ohne Traenen. Kurz vorher hatte sich ein Vorfall zugetragen, der ihre Neigung mit neuer Zaertlichkeit belebte und ihre Betruebnis noch mehr vergaellte. Die Graefin von Nottingham, die auf ihrem Todbette lag, wuenschte die Koenigin zu sehen und ihr ein Geheimnis zu offenbaren, dessen Verhehlung sie nicht ruhig wuerde sterben lassen. Wie die Koenigin in ihr Zimmer kam, sagte ihr die Graefin, Essex habe, nachdem ihm das Todesurteil gesprochen worden, gewuenscht, die Koenigin um Vergebung zu bitten, und zwar auf die Art, die Ihro Majestaet ihm ehemals selbst vorgeschrieben. Er habe ihr naemlich den Ring zuschicken wollen, den sie ihm, zur Zeit der Huld, mit der Versicherung geschenkt, dass, wenn er ihr denselben, bei einem etwanigen Ungluecke, als ein Zeichen senden wuerde, er sich ihrer voelligen Gnaden wiederum versichert halten sollte. Lady Scroop sei die Person, durch welche er ihn habe uebersenden wollen; durch ein Versehen aber sei er nicht in der Lady Scroop, sondern in ihre Haende geraten. Sie habe ihrem Gemahl die Sache erzaehlt (er war einer von den unversoehnlichsten Feinden des Essex), und der habe ihr verboten, den Ring weder der Koenigin zu geben noch dem Grafen zurueckzusenden. Wie die Graefin der Koenigin ihr Geheimnis entdeckt hatte, bat sie dieselbe um Vergebung; allein Elisabeth, die nunmehr sowohl die Bosheit der Feinde des Grafen, als ihre eigene Ungerechtigkeit einsahe, dass sie ihn im Verdacht eines unbaendigen Eigensinnes gehabt, antwortete: 'Gott mag Euch vergeben; ich kann es nimmermehr!' Sie verliess das Zimmer in grosser Entsetzung, und von dem Augenblicke an sanken ihre Lebensgeister gaenzlich. Sie nahm weder Speise noch Trank zu sich; sie verweigerte sich allen Arzeneien; sie kam in kein Bette; sie blieb zehn Tage und zehn Naechte auf einem Polster, ohne ein Wort zu sprechen, in Gedanken sitzen; einen Finger im Munde, mit offenen, auf die Erde geschlagenen Augen; bis sie endlich, von innerlicher Angst der Seelen und von so langem Fasten ganz entkraeftet, den Geist aufgab."
Dreiundzwanzigstes Stueck Den 17. Julius 1767
Der Herr von Voltaire hat den "Essex" auf eine sonderbare Weise kritisiert. Ich moechte nicht gegen ihn behaupten, dass "Essex" ein vorzueglich gutes Stueck sei; aber das ist leicht zu erweisen, dass viele von den Fehlern, die er daran tadelt, teils sich nicht darin finden, teils unerhebliche Kleinigkeiten sind, die seinerseits eben nicht den richtigsten und wuerdigsten Begriff von der Tragoedie voraussetzen.
Es gehoert mit unter die Schwachheiten des Herrn von Voltaire, dass er ein sehr profunder Historikus sein will. Er schwang sich also auch bei dem "Essex" auf dieses sein Streitross und tummelte es gewaltig herum. Schade nur, dass alle die Taten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht wert sind, den er erregt.
Thomas Corneille hat ihm von der englischen Geschichte nur wenig gewusst; und zum Gluecke fuer den Dichter war das damalige Publikum noch unwissender. "Itzt", sagt er, "kennen wir die Koenigin Elisabeth und den Grafen Essex besser; itzt wuerden einem Dichter dergleichen grobe Verstossungen wider die historische Wahrheit schaerfer aufgemutzet werden".
Und welches sind denn diese Verstossungen? Voltaire hat ausgerechnet, dass die Koenigin damals, als sie dem Grafen den Prozess machen liess, achtundsechzig Jahr alt war. "Es waere also laecherlich", sagt er, "wenn man sich einbilden wollte, dass die Liebe den geringsten Anteil an dieser Begebenheit koenne gehabt haben." Warum das? Geschieht nichts Laecherliches in der Welt? Sich etwas Laecherliches als geschehen denken, ist das so laecherlich? "Nachdem das Urteil ueber den Essex abgegeben war", sagt Hume, "fand sich die Koenigin in der aeussersten Unruhe und in der grausamsten Ungewissheit. Rache und Zuneigung, Stolz und Mitleiden, Sorge fuer ihre eigene Sicherheit und Bekuemmernis um das Leben ihres Lieblings stritten unaufhoerlich in ihr: und vielleicht, dass sie in diesem quaelenden Zustande mehr zu beklagen war, als Essex selbst. Sie unterzeichnete und widerrufte den Befehl zu seiner Hinrichtung einmal ueber das andere; itzt war sie fast entschlossen, ihn dem Tode zu ueberliefern; den Augenblick darauf erwachte ihre Zaertlichkeit aufs neue, und er sollte leben. Die Feinde des Grafen liessen sie nicht aus den Augen; sie stellten ihr vor, dass er selbst den Tod wuensche, dass er selbst erklaeret habe, wie sie doch anders keine Ruhe vor ihm haben wuerde. Wahrscheinlicherweise tat diese Aeusserung von Reue und Achtung fuer die Sicherheit der Koenigin, die der Graf sonach lieber durch seinen Tod befestigen wollte, eine ganz andere Wirkung, als sich seine Feinde davon versprochen hatten. Sie fachte das Feuer einer alten Leidenschaft, die sie so lange fuer den ungluecklichen Gefangnen genaehret hatte, wieder an. Was aber dennoch ihr Herz gegen ihn verhaertete, war die vermeintliche Halsstarrigkeit, durchaus nicht um Gnade zu bitten. Sie versahe sich dieses Schrittes von ihm alle Stunden, und nur aus Verdruss, dass er nicht erfolgen wollte, liess sie dem Rechte endlich seinen Lauf."
Warum sollte Elisabeth nicht noch in ihrem achtundsechzigsten Jahre geliebt haben, sie, die sich so gern lieben liess? Sie, der es so sehr schmeichelte, wenn man ihre Schoenheit ruehmte? Sie, die es so wohl aufnahm, wenn man ihre Kette zu tragen schien? Die Welt muss in diesem Stuecke keine eitlere Frau jemals gesehen haben. Ihre Hoeflinge stellten sich daher alle in sie verliebt und bedienten sich gegen Ihro Majestaet, mit allem Anscheine des Ernstes, des Stils der laecherlichsten Galanterie. Als Raleigh in Ungnade fiel, schrieb er an seinen Freund Cecil einen Brief, ohne Zweifel damit er ihn weisen sollte, in welchem ihm die Koenigin eine Venus, eine Diane, und ich weiss nicht was, war. Gleichwohl war diese Goettin damals schon sechzig Jahr alt. Fuenf Jahr darauf fuehrte Heinrich Union, ihr Abgesandter in Frankreich, die naemliche Sprache mit ihr. Kurz, Corneille ist hinlaenglich berechtiget gewesen, ihr alle die verliebte Schwachheit beizulegen, durch die er das zaertliche Weib mit der stolzen Koenigin in einen so interessanten Streit bringet.
Ebensowenig hat er den Charakter des Essex verstellet oder verfaelschet. "Essex", sagt Voltaire, "war der Held gar nicht, zu dem ihn Corneille macht: er hat nie etwas Merkwuerdiges getan." Aber wenn er es nicht war, so glaubte er es doch zu sein. Die Vernichtung der spanischen Flotte, die Eroberung von Cadix, an der ihm Voltaire wenig oder gar kein Teil laesst, hielt er so sehr fuer sein Werk, dass er es durchaus nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringste Ehre davon anmasste. Er erbot sich, es mit dem Degen in der Hand gegen den Grafen von Nottingham, unter dem er kommandiert hatte, gegen seinen Sohn, gegen jeden von seinen Anverwandten zu beweisen, dass sie ihm allein zugehoere.
Corneille laesst den Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh, vom Cecil, vom Cobhan, sehr veraechtlich sprechen. Auch das will Voltaire nicht gutheissen. "Es ist nicht erlaubt", sagt er, "eine so neue Geschichte so groeblich zu verfaelschen, und Maenner von so vornehmer Geburt, von so grossen Verdiensten, so unwuerdig zu misshandeln. "Aber hier koemmt es ja gar nicht darauf an, was diese Maenner waren, sondern wofuer sie Essex hielt; und Essex war auf seine eigene Verdienste stolz genug, um ihnen ganz und gar keine einzuraeumen.
Wenn Corneille den Essex sagen laesst, dass es nur an seinem Willen gemangelt, den Thron selbst zu besteigen, so laesst er ihn freilich etwas sagen, was noch weit von der Wahrheit entfernt war. Aber Voltaire haette darum doch nicht ausrufen muessen. "Wie? Essex auf dem Throne? mit was fuer Recht? unter was fuer Vorwande? wie waere das moeglich gewesen?" Denn Voltaire haette sich erinnern sollen, dass Essex von muetterlicher Seite aus dem koeniglichen Hause abstammte, und dass es wirklich Anhaenger von ihm gegeben, die unbesonnen genug waren, ihn mit unter diejenigen zu zaehlen, die Ansprueche auf die Krone machen koennten. Als er daher mit dem Koenige Jakob von Schottland in geheime Unterhandlung trat, liess er es das erste sein, ihn zu versichern, dass er selbst dergleichen ehrgeizige Gedanken nie gehabt habe. Was er hier von sich ablehnte, ist nicht viel weniger, als was ihn Corneille voraussetzen laesst.
Indem also Voltaire durch das ganze Stueck nichts als historische Unrichtigkeiten findet, begeht er selbst nicht geringe. Ueber eine hat sich Walpole13 schon lustig gemacht. Wenn naemlich Voltaire die erstern Lieblinge der Koenigin Elisabeth nennen will, so nennt er den Robert Dudley und den Grafen von Leicester. Er wusste nicht, dass beide nur eine Person waren, und dass man mit eben dem Rechte den Poeten Arouet und den Kammerherrn von Voltaire zu zwei verschiedenen Personen machen koennte. Ebenso unverzeihlich ist das Hysteronproteron, in welches er mit der Ohrfeige verfaellt, die die Koenigin dem Essex gab. Es ist falsch, dass er sie nach seiner ungluecklichen Expedition in Irland bekam; er hatte sie lange vorher bekommen; und es ist so wenig wahr, dass er damals den Zorn der Koenigin durch die geringste Erniedrigung zu besaenftigen gesucht, dass er vielmehr auf die lebhafteste und edelste Art muendlich und schriftlich seine Empfindlichkeit darueber ausliess. Er tat zu seiner Begnadigung auch nicht wieder den ersten Schritt; die Koenigin musste ihn tun.
Aber was geht mich hier die historische Unwissenheit des Herrn von Voltaire an? Ebensowenig als ihn die historische Unwissenheit des Corneille haette angehen sollen. Und eigentlich will ich mich auch nur dieser gegen ihn annehmen.
Die ganze Tragoedie des Corneille sei ein Roman: wenn er ruehrend ist, wird er dadurch weniger ruehrend, weil der Dichter sich wahrer Namen bedienet hat?
Weswegen waehlt der tragische Dichter wahre Namen? Nimmt er seine Charaktere aus diesen Namen; oder nimmt er diese Namen, weil die Charaktere, welche ihnen die Geschichte beilegt, mit den Charakteren, die er in Handlung zu zeigen sich vorgenommen, mehr oder weniger Gleichheit haben? Ich rede nicht von der Art, wie die meisten Trauerspiele vielleicht entstanden sind, sondern wie sie eigentlich entstehen sollten. Oder, mich mit der gewoehnlichen Praxi der Dichter uebereinstimmender auszudruecken: sind es die blossen Fakta, die Umstaende der Zeit und des Ortes, oder sind es die Charaktere der Personen, durch welche die Fakta wirklich geworden, warum der Dichter lieber diese als eine andere Begebenheit waehlet? Wenn es die Charaktere sind, so ist die Frage gleich entschieden, wie weit der Dichter von der historischen Wahrheit abgehen koenne? In allem, was die Charaktere nicht betrifft, soweit er will. Nur die Charaktere sind ihm heilig; diese zu verstaerken, diese in ihrem besten Lichte zu zeigen, ist alles, was er von dem Seinigen dabei hinzutun darf; die geringste wesentliche Veraenderung wuerde die Ursache aufheben, warum sie diese und nicht andere Namen fuehren; und nichts ist anstoessiger, als wovon wir uns keine Ursache geben koennen.