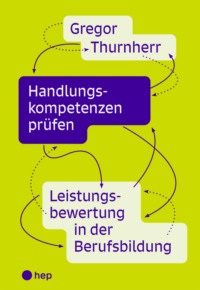Kitabı oku: «Handlungskompetenzen prüfen (E-Book)», sayfa 4
1.4 Anforderungsniveau (Leistungskriterien, Leistungsziele)
Für formale Abschlüsse (z.B. eidg. Fähigkeitszeugnis, eidg. Fachausweis, eidg. Diplom) legen entsprechende Grundlagendokumente (Bildungspläne, Wegleitungen, [Rahmen-]Lehrpläne etc.) fest, was Lernende beziehungsweise Berufsleute können müssen, um als handlungskompetent zu gelten. In der Regel definieren und formulieren diese Grundlagendokumente die verlangten Handlungskompetenzen. Ein Beispiel einer Handlungskompetenz aus der Elektrobranche: «Stromlaufschemas aus Lichtinstallationen nach einschlägigen Normen zeichnen». Die Formulierungen und Definitionen von Handlungskompetenzen geben häufig keinen Hinweis darauf, in welcher Qualität beziehungsweise auf welchem Niveau die Handlungskompetenz erfüllt werden soll. Für die Gestaltung der entsprechenden Ausbildung und die Beurteilung der Kompetenzerreichung ist eine verbindliche Grundlage beziehungsweise Vorgabe wichtig.
Grundlagendokumente in der Berufsbildung beschreiben deshalb sogenannte Leistungsziele (berufliche Grundbildung: Bildungsplan) oder Leistungskriterien (höhere Berufsbildung: Wegleitung) (vgl. SBFI 2018a, 2018b). Sie orientieren sich an der beruflichen Praxis (Ausrichtung an Arbeitsprozessen, Arbeitssituationen, Tätigkeiten, Resultaten, erstellten Produkten o.Ä.) und konkretisieren die Anforderungen an die Handlungskompetenzen. Die Leistungsziele beziehungsweise -kriterien ermöglichen eine Überprüfung beziehungsweise Messung der Kompetenzerreichung. Um bewertbar zu sein, müssen Handlungskompetenzen beobachtet und überprüft werden können. Demnach geben Leistungsziele beziehungsweise -kriterien vor, was Kandidatinnen und Kandidaten in Prüfungen oder in Qualifikationsverfahren erfüllen und leisten müssen. In Grundlagendokumenten zur beruflichen Grundbildung sind diese Leistungsziele den drei Lernorten (Ausbildungsbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeschrieben. Sie dienen dort unter anderem als Vorgabe, auf welchem Niveau die Handlungskompetenzen bei den Lernenden ausgebildet werden sollen.
Leistungskriterien beziehungsweise Leistungsziele bilden die Grundlage für die Ausgestaltung der Ausbildung sowie der formalen Prüfungs- beziehungsweise Qualifikationsverfahren. Die Ausbildenden sowie die Prüfenden erhalten dadurch eine Orientierung, auf welchem Anspruchsniveau sie ausbilden beziehungsweise auf welchem Niveau sie prüfen sollen.
1.5 Kompetenzerreichung, Performanz und Grenzen der Prüfbarkeit
Kompetenzen sind Potenziale oder Dispositionen einer Person, Aufgabenstellungen und Situationen zu bewältigen (siehe Abschnitt 1.1). Sie sind nicht direkt beobachtbar. Diese Voraussetzung stellt eine Grundproblematik beim Prüfen und Beurteilen dar. Da Kompetenzen unmittelbar mit Handlungen verbunden sind, können sie über das Handeln (Handlungskompetenz) sichtbar gemacht werden (vgl. Kaufhold 2006). Allerdings muss das in Prüfungen gezeigte Verhalten nicht unbedingt den Verhaltensmöglichkeiten entsprechen. Salopp gesagt: «Die geprüfte Person könnte mehr!» Oder andersherum: «Das in der Prüfung Gezeigte liegt zufälligerweise über den eigentlichen Verhältnissen.» Auch hier salopp: «Die geprüfte Person kann ihr Können nicht unter Beweis stellen oder stellt mehr unter Beweis, als sie eigentlich beherrscht.» Dies kann mit der Prüfungsanlage, mit der aktuellen Leistungsfähigkeit der Kandidatin oder des Kandidaten (Tagesform) oder mit zufälligen Einflussfaktoren zusammenhängen.
Performanz bezeichnet das Verhalten in einer Situation und ist direkt beobachtbar. Kompetenz hingegen lässt sich nicht einfach beobachten; sie liegt jedoch der Performanz zugrunde (vgl. Walzik 2012). Das lässt sich mit dem Bild eines Eisbergs vergleichen (siehe Abbildung 4). Die Spitze des Eisbergs über der Wasseroberfläche ist beobachtbar (Performanz). Der Teil des Eisbergs im Wasser bleibt dem Auge verborgen (Kompetenz).
 Abbildung 4:
Abbildung 4:
Eisbergmodell (vgl. Walzik 2012, S. 23, angepasste Darstellung)
Deshalb ist es problematisch, von der Performanz auf die Kompetenz zu schließen. Walzik (2012) gibt dazu ein anschauliches Beispiel. Wenn jemand auf die Frage «Was gibt 2 x 3 + 1?» mit «7» antwortet, wissen wir nicht, ob die Person auch tatsächlich die Regel Punktrechnung vor Strichrechnung angewendet hat oder einfach von links nach rechts gerechnet hat. Fragen wir aber «Was gibt 1 + 2 x 3?» und erhalten die Antwort «7», so bekommen wir einen Hinweis darauf, dass die Regel Punktrechnung vor Strichrechnung eingehalten wurde.
Euler (2011) formuliert die These, dass kompetenzorientierte Prüfungen ein Ideal darstellen, dem man sich annähern, aber welches man nicht vollständig erreichen kann. Dies hängt einerseits mit der Komplexität von Kompetenzen und andererseits mit prüfungsökonomischen Gründen zusammen. Die begrenzte Zeit für Prüfungen und deren Beurteilung sowie die eingeschränkte Kapazität von Prüfungspersonal setzen Grenzen. So ist die «perfekte» handlungskompetenzorientierte Prüfung eine hilfreiche Vision für die Weiterentwicklung von Prüfungstheorie und -praxis. Dieser können wir uns annähern, sie aber nur in wenigen Fällen vollständig erreichen.
Eine weitere Einschränkung in der Beurteilung von Kompetenzen ist die Möglichkeit, praxisnahe Situationen zu schaffen. Dies stellt in vielen Bereichen keine große Schwierigkeit dar oder lässt sich häufig gut simulieren. Es gibt aber Kompetenzen und insbesondere die Kompetenzdimension «Wollen», die schwierig zu simulieren und zu überprüfen sind. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob ein Fachangestellter Gesundheit mit einer dementen Patientin allein in einer realen Pflegesituation konfrontiert ist und seine Kompetenz beweisen muss oder ob er die Pflegehandlung an einer Kollegin oder Schauspielerin vor Prüfungsexperten vollziehen soll.
1.6 Arbeitssituationen
Berufliches Handeln findet in Arbeitssituationen beziehungsweise Handlungssituationen statt. Sie stellen Herausforderungen, Problemstellungen oder Aufgaben dar, die von der handelnden Person bewältigt werden sollen. Sie sind an Rahmenbedingungen (Kontext) wie Zeit, Raum und sozialen Austausch gebunden. Damit Berufspersonen Arbeits- oder Handlungssituationen bewältigen können, sind von ihnen Handlungskompetenzen gefordert. Im Prozess zur Definition von bildungs- und prüfungsrelevanten Handlungskompetenzen und damit Lerninhalten werden häufig typische Arbeitssituationen bestimmt und beschrieben. Von diesen werden dann die Handlungskompetenzen abgeleitet, die in der Ausbildung zu erarbeiten sind.
Die Beschreibung von Arbeitssituationen umfasst die bestehenden Rahmenbedingungen (Kontext), die auszuführenden Tätigkeiten sowie Normen und Vorgaben, die bei der Bewältigung beachtet werden müssen. Sie beinhaltet folgende Elemente:
Person (wer?)
konkrete Tätigkeiten (macht was?)
Umfeld und Raum (wo?)
zeitlicher Rahmen (wann? wie lange?)
Umgang mit Ressourcen (womit?)
Interaktion (mit wem?)
Verantwortungsbereich (wofür?)
Der Verein berufliche Grundbildung (VBAO 2020) liefert ein Beispiel einer Handlungssituation aus dem Bildungsplan für den Beruf Augenoptikerin/Augenoptiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, das alle Anforderungen erfüllt:
«Handlungskompetenz: Kundinnen und Kunden im Augenoptikbetrieb empfangen und betreuen
Ein Kunde betritt das Augenoptikgeschäft [Raum, Umfeld]. Die Augenoptikerin EFZ [Person] begrüßt ihn freundlich und erkundigt sich nach seinem Wunsch [Tätigkeit]. Der Kunde möchte eine Sonnenbrille mit korrigierten Gläsern kaufen. Die Augenoptikerin EFZ führt ihn an einen Beratungstisch [Interaktion mit Kunde]. Sie sorgt dafür, dass sich der Kunde willkommen fühlt [Verantwortungsbereich; Umgang mit Ressourcen]. Nach der Beratung und dem Verkauf einer Sonnenbrille verabschiedet sie ihn angemessen [zeitlicher Rahmen; Abschluss Tätigkeit].»
(VBAO 2020, Seite 10)
2 Prüfungskonzeption
Prüfungen planen, erstellen, durchführen und auswerten verlangt eine sorgfältige Konzeption. Es muss klar sein, welche Handlungskompetenzen in welchem Umfang von wem zu welcher Zeit an welchem Ort und in welcher Form zu prüfen sind. Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen bei der Konzeption von Prüfungen und Themen, die dabei zu berücksichtigen sind. In diesem Kapitel werden nach einführenden Gedanken zum Sinn von Prüfungen und der Kompetenzorientierung Grundlagen zur Prüfungserstellung und Formen von Prüfungen vorgestellt. Weitere Schwerpunkte bilden die Bewertung sowie der Einsatz von Hilfsmitteln.
2.1 Warum prüfen?
Am Schluss einer Ausbildung oder einer Ausbildungssequenz gibt es eine Prüfung. Dabei zeigen die Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie die verlangten Handlungskompetenzen in genügendem Maße erfüllen.
Dieses Verständnis von beruflicher Qualifikation und Lernstandbeurteilung ist weit verbreitet und in diesem Sinne im schweizerischen Berufsbildungsgesetz (BBG) verankert. So dürfen zum Beispiel nur Inhaberinnen und Inhaber eines Abschlusses festgelegte Titel tragen (Art. 36 BBG2). Und um titelrelevante Abschlüsse zu erhalten, sind entsprechende Fachprüfungen oder Qualifikationsverfahren zu bestehen (z.B. Art. 433 und 444 BBG). Diese bilden in der Regel den formalen Abschluss einer Ausbildung, die häufig schwerpunktmäßig in Schulen stattfindet. In der höheren Berufsbildung können eidgenössische Prüfungen ohne Besuch von entsprechenden Vorbereitungskursen an Schulen abgelegt werden. Wer die Zulassungsbedingungen erfüllt, kann die Prüfung absolvieren. In der Praxis besuchen allerdings die meisten Kandidatinnen und Kandidaten Vorbereitungskurse für eidgenössische Prüfungen in der höheren Berufsbildung an spezialisierten Ausbildungsinstitutionen.
In der beruflichen Grundbildung und in den Lernorten Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse führen die Verantwortlichen je nach Ausrichtung und Aufgabe regelmäßig Prüfungen durch. Diese bilden in der Regel den Abschluss eines Themas, eines Ausbildungsschwerpunktes oder eines Fachkurses.
Es ist somit grundlegendes Element der Berufsbildung, den Lernstand zu definierten Prüfungszeitpunkten auf seinen Erfüllungsgrad hin zu überprüfen und zu beurteilen. Diese Zeitpunkte sind häufig in relativ starren Bildungs- und Lehrplänen definiert, die wenig Spielraum für die Ausbildenden offenlassen. Nicht berücksichtigt sind bei solchen schulisch orientierten Lehrgängen, die häufig an festgelegten Präsenztagen stattfinden, individuelle Wege der Handlungskompetenzentwicklung sowie die personenspezifische Geschwindigkeit des Lernens. So werden leistungsstarke Kandidatinnen und Kandidaten oder solche mit viel Erfahrung und Vorwissen gleichzeitig mit solchen geprüft, für die der angeleitete Lernprozess länger als formal definiert dauern sollte.
Eine Prüfung kann im besten Fall eine Messung des aktuellen Handlungskompetenzstands sein. Sie misst die Performanz zu einem bestimmten und für alle Kandidatinnen und Kandidaten eines Ausbildungsgangs zum gleichen, oftmals lange im Voraus definierten Zeitpunkt. Dies steht im Widerspruch zum Verständnis und der Berücksichtigung von individuellen Lernprozessen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf unterschiedliche Art ablaufen. Passender wären Handlungskompetenzmessungen, die sich am individuellen Lernprozess orientieren und zu flexiblen Zeitpunkten erfolgen. Auf dieses Lern- und Prüfungsverständnis ist die aktuelle formale Ausbildungslandschaft nicht ausgerichtet. Häufig stehen rechtliche, organisatorische und ökonomische Argumente dieser vorwiegend pädagogischen Betrachtung entgegen. Was spricht denn für Prüfungen? Walzik (2012) führt folgende Gründe auf:
Feedback für Lernende
Feedback für Ausbildende
Lernen fördern
Leistungsbestätigung
Vorbereitung auf Stress
Vergleichbarkeit, Selektion und Qualitätssicherung
Motivation
Daraus lassen sich drei Funktionen von Prüfungen ableiten (vgl. AfH Uni ZH 2006): Diagnose, Prognose und Eignung (Selektion).
Prüfungen können Hinweise zur Entwicklung von Lernenden geben. Diese Erwartung verbindet sich beispielsweise mit Aufnahmeprüfungen an weiterführenden Schulen, die eine Prognose liefern sollen, ob jemand die Ausbildung, zum Beispiel das Gymnasium, erfolgreich absolvieren wird. Dabei dienen sie als Instrument zur Auswahl beziehungsweise als Grenzwert zwischen «genügt den Anforderungen» und «genügt den Anforderungen nicht» [Selektion]. Neben diesen prognostischen und selektiven Komponenten schaffen Prüfungen idealerweise Vergleichsmöglichkeiten und überprüfen den (verlangten) Stand der Handlungskompetenzentwicklung [Diagnose]. Sie geben Lernenden und Ausbildenden Hinweise zum Stand des individuellen Lernprozesses. Zudem können sie sowohl motivierend und lernfördernd als auch gegenteilig wirken. So übernehmen Prüfungen häufig die Rolle einer Lebensschule. Kandidatinnen und Kandidaten lernen, hartnäckig, ausdauernd, fleißig, fokussiert und zielstrebig zu sein. Sie halten Druck aus und bereiten sich so auf spätere Anforderungen und Situationen vor, in denen sie sich beweisen oder unter Zeitdruck hohe Erwartungen erfüllen müssen.
2.2 Handlungskompetenzorientiert prüfen
Das Prüfen von Fachwissen lässt sich mit den weit verbreiteten Methoden wie mündliche und schriftliche Abfragen von Definitionen, Merkmalen, Aspekten etc. durchführen. Dazu eignen sich beispielsweise offene und geschlossene Fragen sowie Multiple- oder Single-Choice-Aufgaben. Bei handlungskompetenzorientierten Prüfungen rücken das Bewältigen von Arbeitssituationen und somit berufsbezogene Handlungen, das Anwenden von Fertigkeiten sowie das Einhalten von definierten Prozessen ins Zentrum des Interesses. Traditionelle Prüfungsformen, wie sie sich für das Prüfen von reinem Fachwissen eignen, stoßen bei der Prüfung von Handlungskompetenzen an Grenzen (vgl. Euler 2011). Sie eignen sich nur bedingt. So müssen Prüfungsmethoden und Aufgabenstellungen entwickelt und praktisch eingesetzt werden, die Rückschlüsse auf die drei Kompetenzdimensionen (Wissen, Können, Wollen, siehe Abschnitt 1.1.3) ermöglichen. Handlungskompetenzorientierte Prüfungen sind umfassender im Sinne von mehrdimensionaler als konventionelle Prüfungen für Faktenwissen. Gute handlungskompetenzorientierte Prüfungen weisen eine hohe Orientierung an der beruflichen Realität sowie mehrere, vielfältige Aufgabenstellungen und Prüfungsmethoden auf. Prüfungen oder Qualifikationsverfahren im Umfeld der Berufspraxis sowie Sprachprüfungen können diesen hohen Ansprüchen weitgehend genügen, wobei auch sie lediglich die Performanz und nicht die vollständigen Handlungskompetenzen prüfen können (siehe Abschnitt 1.5). In Kapitel 3 wird vertieft auf geeignete Prüfungsmethoden eingegangen.
2.3 Grundlagen zur Prüfungserstellung
Bei der Konzeption und Erstellung von Prüfungen sind folgende klassische Qualitätsstandards zu beachten (vgl. Metzger & Nüesch 2004). Eine gute Prüfung ist:
gültig
zuverlässig
chancengerecht
ökonomisch
Gültig oder valide ist eine Prüfung, wenn sie das beurteilt, was auch tatsächlich verlangt wird beziehungsweise geprüft werden soll. Sie orientiert sich an übergeordneten Dokumenten wie zum Beispiel (Rahmen-)Lehrplänen, Wegleitungen, Bildungsplänen. Die Prüfungsaufgaben sind auf die verlangten, repräsentativen und zu beurteilenden Handlungskompetenzen ausgerichtet.
Was mit Gültigkeit gemeint ist, verdeutlicht das folgende Beispiel: Mathematische Berechnungsaufgaben in Form von Textaufgaben bergen die Gefahr, nicht valide zu sein. Eine komplizierte und unübersichtlich formulierte Situationsbeschreibung prüft zu weiten Teilen die Lese-, Verständnis- und Textanalysekompetenz der Geprüften und nicht wie vielleicht gewünscht die Berechnungskompetenz.
Zuverlässig, reliabel oder objektiv ist eine Prüfung, wenn keine Messfehler oder Verfälschungen auftreten. Es besteht der idealisierte Anspruch, dass verschiedene Prüfende bei der Prüfungsdurchführung die gezeigten Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten gleich bewerten. Bei mündlichen Prüfungen ist es unmöglich, eine vollständig objektive Beurteilung durch verschiedene Prüfende sicherzustellen. Es müssen darum möglichst eindeutig beurteilbare (operationalisierte) Kriterien für Leistungsmerkmale geschaffen werden. Dies erhöht die Vergleichbarkeit. Aber auch bei schriftlichen Prüfungen mit exakten Resultaten (z.B. Berechnungsaufgaben) kann es zu Verzerrungen in der Bewertung kommen, besonders wenn für die Korrigierenden keine verbindlichen Vorgaben zur Vergabe von Teilpunkten für Teillösungen, dem Umgang mit Folgefehlern und Lösungsschritten bestehen oder sich die Korrigierenden nicht peinlichst genau an die Bewertungsvorgaben halten.
Chancengerechte Prüfungen bieten allen Kandidatinnen und Kandidaten gleichwertige, also vergleichbare Bedingungen. Dienlich ist dafür eine möglichst hohe Transparenz im Hinblick auf die zu prüfenden Handlungskompetenzen, den Ablauf der Prüfung sowie die beteiligten Prüfenden. Dazu gehört der bewusste Umgang mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie Zeitpunkt und Örtlichkeit. Es ist zu beachten, ob und wie sich Kandidatinnen und Kandidaten zu absolvierten beziehungsweise bevorstehenden Prüfungen austauschen können. Damit sind zum Beispiel bei größeren, länger dauernden Prüfungen Pausengespräche oder Diskussionsmöglichkeiten nach beziehungsweise vor Prüfungsteilen gemeint.
Zu berücksichtigen ist bei der Prüfungskonzeption der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen. Menschen mit einer anerkannten Behinderung haben gemäß Behindertengleichstellungsgesetz5 (Art. 2 Abs. 5 lit. b) Anspruch auf angepasste Prüfungsverfahren. Es sind Maßnahmen verlangt, um Benachteiligungen in Prüfungen zu beseitigen und somit die Chancengleichheit zu gewährleisten (vgl. SBFI 2013).
Ökonomisch ist eine Prüfung, wenn der Nutzen des Prüfungsergebnisses den Aufwand für Durchführung und Bewertung rechtfertigt. Der Gesamtaufwand seitens der Durchführenden soll vertretbar beziehungsweise möglichst optimiert sein. Für Kandidatinnen und Kandidaten sollen der Vorbereitungsaufwand und das Absolvieren der Prüfung zumutbar sein. Dies schließt physische, psychische sowie finanzielle, materialbezogene und geografische Aspekte ein. Handlungskompetenzorientierte Prüfungen generieren bei einer konsequenten Ausrichtung auf die berufliche Praxis häufig Mehraufwand im Hinblick auf Organisation, Finanzierung, Infrastruktur und Bewertungsverfahren. So sollten Aufgaben gestellt, Situationen geschaffen beziehungsweise simuliert werden, wie sie in der Praxis vorkommen. Das kann deutlich aufwendiger sein als die Entwicklung von einfachen schriftlichen Prüfungen.
Es ist ein sehr hoher Anspruch, dass eine Prüfung die vier Kriterien (gültig, zuverlässig, chancengerecht, ökonomisch) gleichzeitig und maximal erfüllt. Die Anzahl der Kandidatinnen und Experten, die räumliche und materielle Infrastruktur, gegenseitige Sympathie und Antipathie von Prüfenden und Geprüften beeinflussen die Durchführung. Aus diesen Gründen besteht die Herausforderung darin, ein Optimum zu finden und diese vier Kriterien einer guten Prüfung ideal abzustimmen. Dies kann je nach Rahmenbedingungen und Zielen beziehungsweise Funktionen der Prüfung sehr unterschiedlich gewichtet erfolgen (vgl. Walzik 2012).
2.4 Vorgaben, Unterricht und Prüfung
Prüfungsinhalte beziehungsweise die geprüften Handlungskompetenzen orientieren sich zwingend an Vorgaben in Grundlagendokumenten, zum Beispiel in Bildungsplänen, (Rahmen-)Lehrplänen, Wegleitungen. Im Ausbildungskontext prüfen Prüfungen idealerweise, was inhaltlich in Lehr- und Lerneinheiten, zum Beispiel im Unterricht, erarbeitet wurde. Deshalb ist ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Vorgaben und zu erreichenden, definierten Handlungskompetenzen, Lehr- und Lernaktivitäten sowie Leistungsbeurteilungen anzustreben. Alles aus einem Guss! Man spricht dabei auch von Constructive Alignment (CA) (vgl. Biggs 2003).
Ziele, Lehr- und Lernaktivitäten und Leistungsbeurteilungen bilden eine Trias für das Erreichen von Handlungskompetenzen. Sie beeinflussen sich gegenseitig (siehe Abbildung 5).
 Abbildung 5:
Abbildung 5:
Trias Ziele – Lehr-, Lernaktivitäten – Leistungsbeurteilung
Das Konzept des CA stellt folgende Anforderungen an eine gute Ausbildung und damit verbunden an das Beurteilungsverfahren:
Zu erreichende Handlungskompetenzen [Ziele] sind im Voraus definiert.
Lehr- und Lernaktivitäten sind auf das Erreichen der Handlungskompetenzen ausgerichtet.
Leistungsbeurteilung beinhaltet die im Voraus definierten Handlungskompetenzen.
Für die Gestaltung von Prüfungen ist demnach die Orientierung an den in Referenzdokumenten vorgegebenen und zu erreichenden Handlungskompetenzen zentral. Auch die eigentliche Ausbildung in Form von theoretischen, praktischen, angeleiteten und selbst gesteuerten Lehr- und Lernaktivitäten hat sich an diesen Zielen auszurichten. Was selbstverständlich klingen mag, ist in der Praxis nicht immer gegeben. Häufig werden in Ausbildungseinheiten Inhalte und Fertigkeiten gelehrt und erworben, die sich nicht an den verbindlichen Vorgaben in Referenzdokumenten orientieren. Das wäre unter Umständen sinnvoll, wenn zum Beispiel definierte Handlungskompetenzen und Inhalte nicht mehr aktuell oder für die Bewältigung von Arbeitssituationen, die sich ebenfalls verändert haben, nicht mehr nötig sind. Allerdings ist ein fehlender Bezug zu Referenzdokumenten problematisch, wenn in Prüfungen Handlungskompetenzen beurteilt werden, die keinen Bezug zu Vorgaben in Grundlagendokumenten haben. Ein Beispiel aus der Praxis ist die Bewertung von Präsentationen beziehungsweise Präsentationstechniken im Rahmen von mündlichen Prüfungen, obwohl diese in den Grundlagendokumenten nicht als zu beurteilende Handlungskompetenzen definiert sind. Dadurch wird die Durchführung der Prüfung anfällig für erfolgreiche Rekursverfahren. Kandidatinnen und Kandidaten können erfolgreich gegen die Beurteilung ihrer Präsentation rekurrieren, wenn diese nicht als zu beurteilendes Element der Prüfung vorgesehen ist.
Stellen Verantwortliche fest, dass die zu erreichenden Handlungskompetenzen und Inhalte in den Referenzdokumenten nicht mehr aktuell sind, empfiehlt es sich, eine Revision der Referenzdokumente anzugehen und nicht die Prüfungen ohne entsprechende Grundlagen inhaltlich neu auszurichten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.