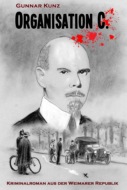Kitabı oku: «Aufmarsch der Republikfeinde», sayfa 2
»Jetzt erzählen Sie mal: Wie war das heute? Sie kamen, um sauberzumachen?«
»Wie jeden Donnerstag. Zuerst bin ich in die Küche. Habe abgewaschen, geputzt. Dann kam der Salon dran. Die ganze Zeit hing er da, und ich habe es nicht gewusst!« Ihre Hände zitterten.
»Schließlich haben Sie das Büro betreten«, half Gregor.
»Am Schluss. Das Büro mache ich immer am Schluss. Und da … da …«
Die ältere Frau an Ihrer Seite reichte ihr ein Glas Wasser. »Trink, Hilde, dann geht es dir besser.«
Gehorsam trank Frau Debus.
»Was haben Sie getan, als Sie Ihren Bruder fanden?«
»Ich habe … Ich dachte … Vielleicht lebte er ja noch, deshalb … Ich habe ihn abgeschnitten und –«
»Wie genau?«
»Was?«
»Beschreiben Sie bitte genau, was Sie getan haben. Sie sahen Ihren Bruder hängen, wollten ihn retten, und dann?«
»Der Tisch. Ich habe den Tisch rangeschoben. Und bin raufgestiegen – nein, erst habe ich nach etwas gesucht, womit ich den Strick durchschneiden konnte. Das Einzige, was ich fand, war der Brieföffner, aber damit klappte es nicht. Es war furchtbar. Ich habe gesägt und gesägt … Dann bin ich wieder runter vom Tisch und in die Küche, um ein Messer zu holen, damit habe ich es schließlich geschafft. Aber er … Leopold, er war schon kalt.« Frau Debus erschauerte.
Diana versuchte, sich darüber klar zu werden, wie die Frau zu ihrem Bruder stand. Einerseits hatte sie verweinte Augen und war sichtlich erschüttert. Andererseits machten ihre Aussagen und die Art, in der sie hervorgebracht wurden, nicht gerade den Eindruck einer innigen Beziehung.
»Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung?«, erkundigte sich Gregor.
Hilde Debus nickte.
»Stand die Tür offen, als Sie kamen?«
»Nein.«
»Haben Sie sich an den Fenstern zu schaffen gemacht?«
»Wie meinen Sie das?«
»Eines geschlossen, zum Beispiel?«
»Nein.«
»Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Fehlt etwas, ist etwas nicht an seinem Platz?«
Sie zuckte die Achseln. »Und wenn, kriege sicher ich wieder die Schuld dafür.«
»Die Frau Ihres Bruders – wissen Sie, wo sie sich zur Zeit aufhält?«
»Bei ihren Eltern, glaube ich. In Kyritz.«
»Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt lebend gesehen?«
»Vor ein paar Wochen. Da musste ich abends noch in der Fabrik saubermachen, weil etwas ausgelaufen war, obwohl ich doch eigentlich zu einem Geburtstag wollte. Aber auf mich nimmt ja sowieso keiner Rücksicht.«
»Hatten Sie den Eindruck, dass er besorgt war? So besorgt, dass er möglicherweise mit dem Gedanken an einen Selbstmord spielte?«
»Er hat sich immer Sorgen gemacht. Das war nicht ungewöhnlich.«
»Glauben Sie, dass sich Ihr Bruder umgebracht hat?«
»Was soll es sonst gewesen sein?«
»Es kam für Sie also nicht aus heiterem Himmel?«
»Der Firma geht es schlecht, soviel ich weiß. Davon abgesehen …« Frau Debus zögerte.
»Ja?«
»Es war nicht das erste Mal. Vor einem Jahr hat er es schon mal versucht. Sie sagen alle, es war eine Fischvergiftung. Aber ich bin sicher, dass er sich schon damals umbringen wollte.«
»Warum?«
»Weil die Firma in der Krise steckt. Und weil Leopold in seiner Ehe nicht glücklich war.«
»Nein?«
»Die beiden passten überhaupt nicht zusammen. Karoline ist eine kalte Frau. Auch eine von denen, die mich verachten.«
Fischvergiftung, dachte Diana. Wenn es in der Ehe kriselte, wäre es auch denkbar, dass seine Frau ihn damals zu vergiften versucht und sich jetzt einer erfolgreicheren Methode bedient hatte. Ehegatten waren immer die wahrscheinlichsten Kandidaten, wenn man in einem Mordfall Ausschau nach dem Täter hielt.
Gregor schien ähnlich zu denken, denn er hakte nach: »Wie war das damals mit der Fischvergiftung?«
»Er hat sich erbrochen, war ganz bleich und zitterte, hieß es. Sie haben ihm den Magen ausgepumpt.«
»Wer hat das Essen zubereitet?«
»Seine Frau natürlich. Oh, ich verstehe. Nein, da sind Sie auf dem Holzweg. Sie ist keine angenehme Person, aber sie hatte keinen Grund, ihm etwas anzutun. Nur mich kann sie nicht leiden.«
»Ich hatte bei Ihren Worten den Eindruck, dass die Ehe nicht gut lief.«
»Schon. Sie und mein Bruder hatten nicht viel gemein. Aber er war vernarrt in sie. Er konnte ihr nichts abschlagen. Hat jeder ihrer Launen nachgegeben.«
»Launen?«
»In der Stadt zu wohnen, zum Beispiel. Mein Bruder liebte die Natur. Er hätte lieber ein Haus auf dem Land gehabt, irgendwo im Berliner Umfeld. Aber er hat ihr zuliebe nachgegeben. Oder letztes Jahr, als sie sich in den Kopf gesetzt hatte, ihren Geburtstag in Paris zu verbringen. Also sind sie dorthin, bloß für ein Wochenende. Sie tat ihm nicht gut, aber sie hat keinen Grund, ihn umzubringen. Sie kann frei über sein Geld verfügen. Und das ist das Einzige, was für sie zählt.«
Keine schmeichelhafte Beschreibung, dachte Diana. Die beiden Frauen kamen offenbar nicht gut miteinander aus.
»Sie ist eine kalte Frau, haben Sie gesagt«, fuhr Gregor fort. »Worin drückt sich ihre Kaltherzigkeit aus?«
»In allem, was sie tut.«
»Beispiele?«
»Vergangenes Jahr, da hat sich ihr Vater ein Bein gebrochen. Mein Bruder ist hingefahren, um nach dem Rechten zu sehen und zu helfen, obwohl Otfried doch bloß sein Schwiegervater ist. Sie nicht. Sie hatte was Besseres zu tun. Hat lieber einen Ausflug in den Spreewald gemacht, wie so oft. Hat ihren Mann allein zu ihrem Vater fahren lassen. Welche Tochter tut so etwas?«
Gregor nickte. »Sagen Sie, wer hat eigentlich außer Ihnen einen Schlüssel zur Wohnung Ihres Bruders?«
»Nur seine Frau.«
»Dienstboten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Hätte jemand Gelegenheit gehabt, den Wohnungsschlüssel nachzumachen?«
»Vermutlich. Ich nehme an, jeder, der zeitweise allein in Leopolds Wohnung war, hätte es tun können. Ersatzschlüssel hängen am Schlüsselbrett. Leopold hatte früher einen Privatchauffeur, der hätte natürlich die Gelegenheit dazu gehabt. Und meine Aushilfe wohl auch.«
»Aushilfe?«
»Als ich Anfang des Jahres ins Krankenhaus musste. Glauben Sie, mich hätte mal jemand besucht? Nee, mich doch nicht. Ich bin allen egal. Mein Bruder hat zweimal vorbeigeschaut, als ich wieder zu Hause war, bettlägerig. Das war alles.«
»Und als Aushilfe …?«
»Hat er jemand anderen beauftragt.«
»Wen?«
»Jemanden aus dem Betrieb, glaube ich. Eine Sortiererin.«
»Name?«
Frau Debus runzelte die Stirn. »Irgendwas mit B. Bau… Baumann, ja. Helga Baumann.«
»Hatte Ihr Bruder Feinde?«
»In seiner Position? Vermutlich. Aber davon weiß ich nichts.«
Gregor machte sich Notizen. »Eine letzte Sache noch«, sagte er. »Ich muss Sie das fragen. Ihr Bruder ist allem Anschein nach gestern Abend gestorben. Verraten Sie mir, wo Sie waren? Sagen wir, zwischen sechs und Mitternacht?«
»Nach der Arbeit war ich in den Grünanlagen in der Nähe meiner Wohnung. Da bin ich oft und sehe den Leuten zu, stricke ein bisschen.«
»Wie lange waren Sie dort?«
»Bis neun, glaube ich.«
»Im Dunkeln?«
»Die haben mir den Strom abgedreht«, sagte Frau Debus. »Weil ich neulich die Rechnung nicht bezahlen konnte. Warum muss immer mir so was passieren? Zu Hause ist es duster. Da sitze ich lieber draußen.«
»Bei der Kälte?«
»Im Mantel geht’s. Und ob ich krank werde oder nicht, interessiert sowieso keinen.«
»Kann jemand bezeugen, dass Sie dort waren?«
Sie zuckte die Achseln.
»Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt nach Hause gehen.«
Frau Debus erhob sich unsicher. Ihre Freundin brachte sie nach draußen, während sie beruhigend auf sie einredete.
»Was denkst du?«, fragte Diana.
»Ich weiß nicht.«
»Machst du Feierabend?«
Ehe Gregor antworten konnte, kam Edgar herein. »Seine Frau ist eben nach Hause gekommen«, sagte er.
4
Karoline Debus wirkte wie ein kostbares Schmuckstück in einer Glasvitrine mit dem Schild Nicht berühren davor, dachte Diana. Dazu trug nicht nur ihre unnahbare Miene, sondern auch ihre kunstvolle Frisur bei, die gewiss keine Zofe, sondern ein Meister seines Fachs aufgetürmt hatte und die aussah, als würde sie in sich zusammenfallen, sobald man ihr zu nahe kam. Auch der Salon im ersten Stock reflektierte ihre Persönlichkeit: Malachittischchen mit Kaffeegeschirr aus Meißner Porzellan, Jugendstillampen, Jadefiguren, Glasbläserarbeiten, eine Skulptur aus Elfenbein. Überall das Neueste, Modernste, Teuerste, und es sah nicht nach dem Geschmack ihres Mannes aus.
Hinzu kamen die Haushaltsgeräte: mitten auf dem Orientteppich ein Staubsauger der Marke Vampyr und eine Bohnermaschine, die Leopold Debus’ Schwester wohl infolge der Entdeckung seines Todes vergessen hatte zurückzustellen, ein Haartrockner, und auf dem Weg in den Salon hatte Diana in der Küche einen Toaster mit vollautomatischem Auswurf und den Volksherd der AEG gesehen, der erst vor wenigen Jahren auf den Markt gekommen war. Es sagte einiges über Leopold Debus aus, dass er seiner Frau erlaubt hatte, all diese teuren Geräte anzuschaffen, obwohl die Spreewolle in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Noch ein Indiz, das einen Selbstmord nicht eben unwahrscheinlicher machte.
Karoline Debus saß – nein, thronte – auf dem mit kostbaren Stoff überzogenen Diwan und hielt eine Katze auf dem Schoß, die sie unentwegt streichelte, wobei sich das Tier sichtlich unwohl fühlte. Ob wegen des Streichelns oder wegen der Socken an den Pfoten, war schwer zu sagen. Jedenfalls konnte sich die Katze nicht gegen die Zärtlichkeiten ihrer Herrin wehren und auch nicht davonlaufen, weil Frau Debus sie festhielt.
Aufgrund der Kälte – die sechs Grad Außentemperatur fühlten sich mehr wie null Grad an – waren Hendrik und Diana mit hinaufgekommen und saßen nun im Vorraum zum Salon. Da die Flügeltüren geöffnet waren, konnten sie alles mit anhören und -sehen, was Diana nur recht war. Sie hielt ihre Tochter im Arm, die nach dem Herumtoben mit Hendrik immerzu gähnte und sich an ihre Mutter kuschelte, und bemühte sich, kein Wort zu verpassen.
»Mein Beileid«, sagte Gregor, während er sich unschlüssig umsah und schließlich einen Stuhl heranzog, auf dem er Platz nahm.
Frau Debus nickte. Schwer zu sagen, ob der Tod ihres Mannes sie nicht berührte oder ob sie ihre Trauer nur nicht zeigen wollte. Sie hatte dick Schminke aufgetragen, stellte Diana fest, vielleicht um ihre Gefühle zu verbergen.
»Sie waren verreist?«
»Ich habe meine Eltern besucht. Bin eben erst zurückgekehrt, als mich Ihre Leute mit der Hiobsbotschaft empfingen.«
»Ihre Eltern wohnen in Kyritz, habe ich gehört?«
»Ja.«
»Wann sind Sie dorthin gefahren?«
»Gestern Nachmittag. Eigentlich wollte ich früher los, aber die Firma, der wir dummerweise einige unserer Stühle anvertraut haben, um die Polster neu zu beziehen, hat schlampig gearbeitet, darum musste ich mich kümmern. Ursprünglich hatte ich gar nicht vor, in Kyritz zu übernachten. Wenn es nicht so spät geworden und ich am Abend wieder zurück gewesen wäre … Vielleicht wäre dann alles anders gekommen.«
Ein müßiger Gedanke, fand Diana. Hendrik schien derselben Ansicht zu sein, denn sie hörte ihn murmeln: »Wäre die Nase der Kleopatra kürzer gewesen, hätte sich das Gesicht der Erde anders gestaltet.« Und als sie ihn ansah, ergänzte er: »Pascal.«
»Bevor Sie abgereist sind, gab es da einen Hinweis auf eine Veränderung im Verhalten Ihres Mannes? Dass er vielleicht besonders niedergeschlagen wirkte?«, wollte Gregor wissen.
Gedankenverloren streichelte Frau Debus wieder die Katze, die sich aus ihren Händen zu winden versuchte. »Eigentlich nicht. Er hat mich noch ermuntert, meine Eltern zu besuchen, und einen Scherz gemacht, bevor er in die Fabrik gegangen ist.«
»Hat Ihr Mann früher schon mal Selbstmordgedanken geäußert?«
»Nicht direkt. Aber er war oft deprimiert und in sich gekehrt. Die Wirtschaftskrise macht uns zu schaffen, wie Sie sich denken können. Es wuchs ihm alles über den Kopf. Ehrlich gesagt: Leopold war nicht gerade der geborene Geschäftsmann. Er hat die Firma von seinem Vater geerbt und einige Fehlentscheidungen getroffen. Wir können von Glück reden, dass wir Herrn Gruber als Vorstandsvorsitzenden haben. Dank ihm sind wir bisher glimpflich davongekommen.«
»Ja?«
»Er versteht etwas vom Geschäft. Leopold hat das übrigens ähnlich gesehen und häufig seinen Rat gesucht. Er wollte ihn zum Geschäftsführer machen.« Sie kraulte die Katze zwischen den Ohren. »Ich nehme an, ich werde den Wunsch meines Mannes erfüllen. Zumal ich niemand anderen wüsste, der uns sicher durch die Wirtschaftskrise führen könnte.«
»Ihr Mann hat sich also Sorgen gemacht?«
»Ja. Und es hat Augenblicke gegeben, da war er regelrecht verzweifelt und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Vor einem halben Jahr hatte er einen Tiefpunkt und sprach davon, dass er den Druck nicht mehr aushält. Aber diese Phase schien er überwunden zu haben. Dass er sich jetzt umbringt …«
»Wie war das mit der Fischvergiftung im vergangenen Jahr?«
»Warum interessiert Sie das? Oh, ich verstehe. Sie denken, wir hätten das erfunden, und in Wahrheit hätte er versucht, sich zu vergiften, ja? Nun, ich kann Ihnen versichern, das war nicht der Fall. Es lag tatsächlich am Fisch. Ich hatte anschließend ebenfalls Magenprobleme, allerdings weniger schlimm, weil ich nur ein paar Happen davon gekostet hatte. Herr Kommissar, es gab keinen Hinweis darauf, dass sich Leopold das Leben nehmen wollte. Aber er war deprimiert, ja, und ich habe nicht seinen Einblick in die Geschäfte, möglicherweise habe ich das Ausmaß seiner Verzweiflung unterschätzt.«
Gregor nickte. »Wie würden Sie das Verhältnis zwischen sich und Ihrem Mann beschreiben?«
»Partnerschaftlich.«
Ein seltsames Wort für die Quintessenz einer Ehe, fand Diana. In ihren Ohren klang es reichlich distanziert.
Gregor hakte auch gleich nach. »Die Schwester Ihres Mannes ist der Ansicht, dass Ihr Mann unglücklich war.«
Eine Unmutsfalte bildete sich auf der Stirn von Frau Debus. Ihre Hand grub sich in das Fell der Katze. »Ich kann mir schon denken, was sie über mich erzählt. Hilde sollte sich lieber an die eigene Nase fassen. Ständig kommt sie an und bettelt um Geld. Leopold hat ihr immer etwas zugesteckt. Er war einfach zu gutmütig. Die Leute nutzen das aus.«
»Sie würden also der Ansicht seiner Schwester widersprechen?«
»Mein Mann und ich kamen gut miteinander aus. Es gab nie Streit, wir haben immer alles zur gegenseitigen Zufriedenheit geklärt.«
Auch das klang mehr nach einer Geschäftsbeziehung als nach einer Ehe.
Karoline Debus schien es zu bemerken, denn sie fügte an: »Eine Liebe, die auf gegenseitigem Respekt gründet, ist nicht die schlechteste.«
Endlich gelang es der Katze, sich aus ihren Händen zu befreien. Mit einem Satz sprang sie davon, huschte unter einen Sessel und versuchte vergeblich, die Socken an ihren Pfoten loszuwerden.
Gregor erhob sich und wanderte im Raum auf und ab. »Frau Debus, bis jetzt gehen wir von einem Selbstmord Ihres Mannes aus, aber falls die Untersuchung etwas anderes ergibt –«
»Etwas anderes?«
»Nun, es ist natürlich denkbar, dass der Selbstmord nur vorgetäuscht wurde. So etwas kommt vor. Nicht oft, aber wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.«
»Sie meinen … Mord?«
Gregor zuckte die Achseln. »Hatte Ihr Mann Feinde?«
Karoline Debus dachte nach. »Nun … Wie gesagt, der Firma geht es nicht gut. Es gab Entlassungen. Darüber sollten Sie am besten mit unserem Personalchef sprechen, Herrn Thomae.«
»Werden wir. Und sonst?«
»Wenn Sie mich so fragen … Wir hatten einen Chauffeur, den wir ebenfalls entlassen mussten, weil er die Geldbörse meines Mannes gestohlen hat. Thaddäus Blumkrohn. Aber wie sollte jemand …?«
»Es ist vorerst nur Spekulation«, beschwichtigte Gregor. »Hat Ihr Mann gestern Abend jemanden erwartet?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Gut. Belassen wir es für heute dabei.« Gregor nahm seinen Hut. »Vielleicht sollten Sie in den nächsten Tagen mit Ihrem Verlust nicht allein sein.«
Karoline Debus nickte. Jetzt erst lockerten sich ihre Gesichtszüge, und man sah ihr die Erschöpfung an. Vielleicht steckte unter dem kühlen Äußeren doch so etwas wie ein Mensch.
5
Als Gregor den Sektionssaal betrat und das Gesicht von Oliver Pauly sah, wusste er, dass er recht daran getan hatte, zur Arbeit zurückzukehren, nachdem er erst Diana und Lissi und danach Hendrik zu Hause abgesetzt hatte.
»Guten Abend, Gregor«, sagte der Gerichtsmediziner. Er hatte abgenommen. Den Gerüchten nach versorgte er mit seinem Gehalt mehrere Verwandte, die infolge der Wirtschaftskrise mittellos geworden waren, da blieb für ihn selbst nur noch das Nötigste. Früher hatte er einem Walross nicht unähnlich gesehen, jetzt wäre er ohne seinen Backenbart kaum wiederzuerkennen. »Gennat hat Druck gemacht, dass ich mir deine Leiche noch vor dem Karfreitag anschaue. Eigentlich warten nämlich noch mehr Kunden auf mich, um mit mir zu reden. Dein Toter hat ebenfalls ausgiebig geplaudert.«
Gregor sah zum drehbaren Seziertisch, auf dem die zugedeckte Leiche von Leopold Debus lag. »Dein Grinsen verrät mir, dass du mir etwas mitzuteilen hast.«
»Ergebnisse, immer bloß Ergebnisse! Gönn mir das Vergnügen, mit dir über die Kunst der Obduktion zu sprechen.« Der Gerichtsmediziner studierte seine Notizen, als wüsste er nicht genau, was darauf stand. »Wir haben eine besondere Technik bei Strangulation, um keinen Befund zu übersehen. Ehe wir mit der schichtweisen Präparation der Halsweichteile beginnen, entleeren wir die Blutgefäße. Außerdem haben wir selbstverständlich auch das Gehirn mikroskopisch untersucht.«
»Ich habe nie an deiner Gründlichkeit gezweifelt«, sagte Gregor und war plötzlich froh, dass das, was nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung von der Leiche übrig sein musste, unter dem Laken verborgen lag.
»Ich merke schon, du bist an meiner Kunst nicht interessiert. Das kränkt mich«, grinste Oliver Pauly.
Gregor wusste, dass der Gerichtsmediziner ihn nur auf die Folter spannen wollte, und machte gute Miene zu dessen Spiel, indem er zurückgrinste.
»Also schön. Der Tod des Mannes trat gestern zwischen halb acht und neun Uhr abends ein. Todesursache war zweifellos das Erhängen. Der Strick hat durch den Druck auf die Halsschlagadern die Sauerstoffzufuhr des Gehirns unterbrochen, was dem Toten gnädigerweise eine rasche Bewusstlosigkeit beschert haben dürfte. Außerdem wurde die Zunge gegen die Rachenwand gedrückt, wodurch es zu einer Tamponade, also Verstopfung des Nasen- und Rachenraumes kam.« Der Gerichtsmediziner setzte bei jedem Wort, das er betonen wollte, seinen Zeigefinger wie ein Ausrufezeichen in die Luft, eine Marotte, die schon so mancher von Gregors Kollegen zum Gaudi der Kriminalkommissar-Anwärter parodiert hatte.
»Also Selbstmord?«, wollte Gregor wissen. Das würde das Ergebnis der Untersuchung des Strickes untermauern, die bestätigt hatte, dass der Strick beim Durchtrennen gespannt gewesen und ein Erhängen mithin nicht vorgetäuscht war.
»Das habe ich nicht gesagt.« Oliver Pauly grinste wieder. »Ich will dich nicht mit all den Dingen langweilen, die typisch sind für ein Erhängen. Es gibt jedoch drei Hinweise, die eventuell Aufschluss darüber geben können, ob ein Mord oder ein Selbstmord vorliegt.« Er machte eine Kunstpause.
»Und zwar?«
»Der erste Hinweis hat für sich betrachtet noch nicht viel zu sagen. Wir haben selbstredend auch den Mageninhalt untersucht und festgestellt, dass der Mann vor seinem Ende Alkohol zu sich genommen hat. Außerdem konnten wir die Reste eines Schlafmittels nachweisen. Das mag einfach nur bedeuten, dass er sich Mut angetrunken und versucht hat, sich zusätzlich mit Medikamenten umzubringen, um sicherzugehen, wobei die Dosis dafür nicht annähernd ausgereicht hätte.«
»Andererseits wäre es auch denkbar, dass jemand ihm ein Schlafmittel in den Alkohol getan hat, um ihn anschließend zu erhängen, willst du das damit sagen?«
»Ich zähle nur die Fakten auf, mehr nicht. Die Schlüsse überlasse ich deiner Gehaltsklasse.« Der Gerichtsmediziner setzte wieder seinen Zeigefinger ein, um das Folgende zu betonen: »Zweitens fanden wir Verletzungen am Rest des Körpers, die nahelegen, dass er kurz vor seinem Tod versucht hat, sich vom Strick zu befreien.«
»Sich gegen das Erhängen zu wehren?«
Oliver Pauly zuckte die Achseln. »Es kommt natürlich vor, dass sich Selbstmörder im Augenblick des Todes umentscheiden, aber wegen der eintretenden Bewusstlosigkeit nicht mehr in der Lage sind, sich zu retten. Wobei Druckstellen an bestimmten Körperregionen darauf schließen lassen könnten, dass jemand ihn daran hindern wollte, sich zu befreien. Ich möchte mich da aber ungern festlegen, die Male sind nicht eindeutig. Sie könnten auch auf andere Weise zustande gekommen sein.«
»Das sind viele Wenns und Abers. Die helfen mir nicht.«
»Vielleicht hilft dir dann der dritte Hinweis.« Der Gerichtsmediziner hielt inne und kratzte sich den Backenbart. »Ich begebe mich jetzt aufs Glatteis. Dir zuliebe.«
Gregor nickte ihm auffordernd zu.
»Wir konnten bei der Untersuchung des Halses feststellen, dass nicht nur der Kehlkopf beschädigt und die Schilddrüsenknorpel eingedrückt waren, sondern dass es auch Abschürfungen an ungewöhnlichen Stellen gab.«
»Das heißt?«
»Meiner Meinung nach wurde der Mann in mehreren Anläufen Stück für Stück mit der Schlinge um den Hals nach oben gezogen, daher die Abschürfungen. Wodurch er munter wurde und sich zu wehren begann.«
Gregor wollte sichergehen, dass er Oliver Pauly richtig verstand. »Also Mord?«
Der Gerichtsmediziner wiegte den Kopf hin und her. »Sagen wir: zu siebzig Prozent ja. Ich würde meine spärliche Pension darauf verwetten.«
6
Noah Rosenthal sah nicht gut aus. Dürr und hohlwangig war er geworden. Sicher machte die wirtschaftliche Lage dem ehemaligen Bibliothekar zu schaffen. Dennoch, für sein Alter – immerhin hatte er Anfang des Jahres seinen dreiundachtzigsten Geburtstag gefeiert – war er noch ziemlich rüstig. Wie er da an seinem geliebten Brennabor-Fahrrad schraubte, wirkte er geradezu jugendlich.
»Du machst dir Sorge um mich, jingel, ja?«, meinte er.
»Dir kann man wohl nichts vormachen«, erwiderte Hendrik. »Ja, ich mache mir Sorgen. Du siehst aus, als würdest du nicht genug essen. Brauchst du Hilfe?«
»Ich komme zurecht. Schau mal!« Er deutete auf die kitschige Kaiserglocke aus Zinnbronze mit Goldprägung und dem Konterfei des Kaisers an seinem Lenker. Mit Lackfarbe hatte er seiner Majestät eine Hand hinzugefügt, die eine rote Kommunistenfahne schwenkte.
Hendrik lachte. »Du bist unverbesserlich.«
Anton Broscheck, der Arbeiterjunge, den er kostenlos privat unterrichtete, kam soeben mit seinem Fahrrad auf den Hinterhof gesaust. Er war jetzt neunzehn, ein aufgeweckter junger Mann, fand Hendrik.
»Guten Abend«, rief Anton schon von Weitem und sprang von seinem Rad. »Ich hab' Arbeit, Herr Lilienthal! Seit letzter Woche.«
»Das ist ja fantastisch! Gratuliere!«
»Bei Bimmel-Bolle. Ich bin jetzt 'n Bolle-Junge. Allerdings muss ich um fünf antreten, das heißt, um vier aufsteh'n. Und dann mit der Kutsche quer durchs nächtliche Berlin und Milch, Sahne und Joghurt austragen, treppauf, treppab. Aber es gibt 24 Mark die Woche. Und 3 Pfennig für jeden Kunden. Und Trinkgeld.«
Hendrik musste schmunzeln, weil er sich daran erinnerte, wie er selbst als Steppke mit seinen Freunden dem weißen Pferdekastenwagen hinterhergelaufen war und zugesehen hatte, wie der Kutscher die Glocke schwang. Und wenn dann die Hausfrauen mit ihren Kannen herbeiströmten und sich Milch aus dem Zapfhahn einfüllen ließen, hatten er und seine Freunde den Vers gerufen, den jedes Berliner Kind kannte: »Bolle, bimbim, die Milch ist zu dünn, die Buttermilch zu dick, Bolle ist verrückt.«
»Unser Pferd is'n ausrangierter Gaul aus dem Zirkus Busch«, fuhr Anton fort. »Lise.«
»Also das freut mich, dass du in dieser schweren Zeit Arbeit gefunden hast.«
»Ein’ Teil des Geldes geb' ich mein’ Eltern ab. Aber vom Rest kann ich endlich wieder ins Kino. Ich hab' mir Die Drei von der Tankstelle angekuckt mit Willi Fritsch und Lilian Harvey. Und Lichter der Großstadt. Die Boxer-Szene war knorke. Ich hab’ mir ’n Ast gelacht. War'n Sie letzten Monat auch da, als Charlie Chaplin Berlin besucht hat? Ich war am Bahnhof, als er kam. Alles voller Schupos und Bahnpolizisten, die den Bahnsteig abgesperrt haben. Es hat wie verrückt geschneit. Ich hab’s geschafft, nach vorne zu kommen, und er hat mir die Hand gedrückt.« Antons Augen glänzten. Seine Begeisterung fürs Kino war stets ansteckend.
Hendrik hatte Lichter der Großstadt ebenfalls gesehen. Vor allem aber wartete er auf Fritz Langs ersten Tonfilm, M mit Peter Lorre. »Hast du denn überhaupt noch Zeit für unseren Unterricht?«, fragte er.
»Klar. Bin gleich wieder da«, sagte Anton. »Bring' nur schnell mein Rad innen Keller.« Er hakte die Tür zum Hausflur ein und verschwand nach unten.
Hendrik sah ihm nach, als er verschwand. »Aus dem wird mal was«, meinte er.
»Prächtiger Bursche«, stimmte Noah zu, während er sich niederkniete, um den Rahmen seines Rades zu polieren
Ein Schatten fiel über ihn.
Oskar Cremer blickte auf Noah herab und kickte mit dem Fuß das Werkzeugkästchen fort, sodass Schrauben und Muttern nach allen Seiten sprangen. »Bald is' Schluss mit euch Judenpack«, stieß er hervor. »Hitler wird mit euch aufräumen.«
Hendrik machte einen Schritt nach vorn, wissend, dass er dem muskulösen Zwanzigjährigen nichts entgegenzusetzen hatte. »Bist du immer so mutig, einen alten Mann zu schikanieren?«, fragte er so ruhig wie möglich.
»Judenfreunden wie dir geht's gleich mit an den Kragen, wenn wir erst anner Macht sind.«
»Das wird ein schwarzer Tag für Deutschland, sollte es je so weit kommen.«
»Es wird die Befreiung von Schmach und Schande.«
»Wenn du so für Hitler schwärmst, warum gehorchst du dann nicht seinen Befehlen? Er hat angeordnet, Brünings Notverordnung zu respektieren, und euch untersagt, die Bevölkerung zu terrorisieren.«
Oskar packte Hendrik am Kragen und drückte ihn gegen die Hauswand. »Erzähl du mir nich', was der Führer will!«, zischte er. »Los, sprich mir nach: Heil Hitler! Weg mit den Juden!«
»Lass ihn sofort los«, sagte Anton, der mit geballten Fäusten auf der der Kellertreppe stand.
Oskar reagierte nicht.
»Ich hab' gesagt, du sollst ihn loslassen. Und was hab' ich dir angedroht, wenn du Herrn Rosenthal noch mal belästigst?«
Oskar schubste Hendrik beiseite und baute sich vor Anton auf.
Früher waren sie Freunde gewesen, wusste Hendrik. Aber Oskar und seine Eltern hatten sich den Nazis zugewandt, der Junge war inzwischen sogar bei der lokalen SA, während Anton und seine Eltern zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten schwankten.
»Glaubst du, ich hab' Angst vor dir kleinem Scheißer?«, zischte Oskar. »Vor ei'm, der vor den Juden kuscht, die Schuld sind am Zustand Deutschlands?«
Hendrik kam Montaigne in den Sinn: Welche Ursachen erfinden wir nicht für die Unglücksfälle, die uns treffen! Wie vielem schieben wir nicht zu Recht oder Unrecht die Schuld hierfür zu, nur um etwas zu haben, woran wir unsre Erbitterung auslassen können!
»Na klar«, höhnte Anton, »genau wie am Regenwetter, an Grippe und an Hühneraugen. Mann, was is' bloß aus dir geworden?«
Sie standen sich gegenüber, bereit, jede Sekunde mit den Fäusten aufeinander loszugehen.
»Lasst es gut sein«, mischte sich Hendrik ein.
Oskar kam wohl zu dem Schluss, dass er gegen eine zahlenmäßige Übermacht nicht gewinnen konnte, denn er spuckte aus, erst vor Anton, dann vor dem ehemaligen Bibliothekar, und marschierte davon.
Hendrik hockte sich zu Noah nieder. »Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Das ist doch bloß ein dummer Junge mit einer großen Klappe. Ich nehme das nicht ernst.«
Aber Hendrik sah, wie der alte Mann zitterte.
»Oskar is' ein Arschloch«, sagte Anton. »Wenn er Sie noch mal bedroht, sagen Sie mir Bescheid, ja? Dann kümmer' ich mich um ihn.«
»Nett von dir, jingel. Aber das wird nicht nötig sein. Und jetzt verschwindet zu eurem Unterricht.«
»Bist du sicher?«, fragte Hendrik.
»Natürlich. Sehe ich aus wie ein Säugling, der eine Amme braucht?« Er fing an, die Schrauben zusammenzusuchen. Hendrik und Anton wollten ihm helfen, doch er scheuchte sie mit einer Handbewegung fort.
»Wir ham schon zweimal die Polizei geholt«, flüsterte Anton, während sie die Treppen hinaufstiegen. »Weil Oskar Herrn Rosenthal bedroht hat. Seitdem pöbelt er bloß noch. Meistens, jedenfalls.«
Noah wohnte direkt neben den Broschecks, deshalb entdeckte Hendrik, dass seine Tür mit dem Schriftzug Jude! und einem Hakenkreuz beschmiert war.
»Wir ham versucht, es abzuwaschen«, sagte Anton. »Is' nich' so einfach. Wir woll'n am Wochenende noch mal ran.«
Sie betraten die Wohnung der Broschecks. Antons Eltern waren nicht da. Der Junge brachte sich und Hendrik ein Glas Wasser, ehe sie sich aufs Sofa setzten.
»Dir ist vermutlich nicht nach einer philosophischen Diskussion«, meinte Hendrik, der selbst noch mit dem Adrenalinstoß kämpfte, den die Auseinandersetzung in ihm ausgelöst hatte.
Anton zuckte die Achseln.
Sie schwiegen eine Weile.
»Wodurch is' Oskar so geworden, was mein' Sie?«, fragte Anton schließlich. »Oder war er schon immer so, und ich hab’s bloß nich' gemerkt? Ich meine, er war mal mein Freund.«
»Eine gute Frage. Und eine klassische dazu. Sie ist nämlich nichts anderes als der uralte Streit, ob wir durch unser Erbgut oder durch unsere Umwelt geprägt werden.«
»Sie finden immer 'n Grund zum Philosophieren, was?«, grinste Anton.
»Weil alles, was wir tun und denken, auf etwas Größeres verweist. Echte Philosophie ist keine verstaubte Bücherweisheit, sondern hat etwas mit unserem Leben zu tun. Also: Glaubst du, dass Oskar von jeher so war, wie er ist, und du es nur nicht gemerkt hast?«