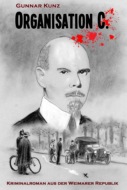Kitabı oku: «Aufmarsch der Republikfeinde», sayfa 3
»Eigentlich nich'. Früher hat er sich bloß für Fußball und Radfahren interessiert. Er hat nie über Juden geschimpft. Erst seit sein Vater arbeitslos geworden is' und die Nazis wählt.«
»Also sind es seine Erfahrungen, die ihn prägen? Seine Eltern, die Arbeitslosigkeit?«
»Scheint so.«
»Ihr beide seid zusammen aufgewachsen. Habt zusammen gespielt und ähnliche Dinge erlebt. Und dein Vater ist auch arbeitslos, nicht wahr? Würdest du also herumgehen und den Juden an allem die Schuld geben?«
»Natürlich nich'. Ich bin ja nich' blöd.«
»Also sind es doch die Gene, die uns prägen?«
»Vielleicht … beides.«
Hendrik schwieg und ließ den Jungen weiter nachdenken.
»Meine Mutter sagt, ich seh' mei'm Vater ähnlich. Und es gibt 'n altes Foto von ihm, wo er so alt is' wie ich jetzt, da könnte man uns verwechseln. Außerdem gibt's Erbkrankheiten und so Sachen.«
»Also werden manche Dinge anscheinend vererbt. Das Aussehen, wie gesund wir zur Welt kommen. Aber wie ist das mit dem Charakter, dem Temperament, politischen Einstellungen? Hast du die gleichen Ansichten und Vorlieben wie dein Vater?«
»Manche schon. Aber er würd' den Stahlhelm verbieten und den Roten Frontkämpferbund nich', das find' ich nich' richtig. Außerdem will er, dass ich was ›Anständiges‹ lerne und nich’ beim Rundfunk anfange, wie ich’s vorhab’. Das is' 'ne brotlose Kunst, sagt er. Das is' bloß 'ne Mode, die vorbeigeht. Und dass ich Detektivromane lese, stört ihn auch. Er sagt, das is' Schund, ich soll lieber die Schriften von Rosa Luxemburg lesen.«
»Sein erzieherischer Einfluss auf dich hat also Grenzen.«
Anton grinste wieder.
Hendrik erwiderte das Grinsen. »Das scheint ebenfalls eher für die Gene zu sprechen. Eine andere Frage: Seit über zehn Jahren philosophieren wir über die Welt. Hat dich das nie gelangweilt?«
»Nie!«
»Was gefällt dir daran?«
»Dass man, wenn man über irgendwas nachdenkt, mehr über die Welt rausfinden kann. Manchmal versteh' ich hinterher was, was ich vorher nich' verstanden hab'. Ich find' gut, dass nix tabu ist. Wenn wir über was reden, können wir alles infrage stell'n.«
»Hätte Oskar auch Lust dazu?«
»Nee. Der is' bequem. Der nimmt alles hin. Das war schon immer so. Unser Lehrer hat noch 1918 vom Krieg gesprochen, als wär' der was Tolles. Ich hab' ihn mal gefragt, warum wir in den Krieg gezogen sind, und er hat gesagt, weil wir von Feinden umringt sind, die uns den Platz an der Sonne nich' gönnen. Dass wir Raum brauchen. Oskar hat's geschluckt. Der fragt nich' nach.«
»Warum seid ihr beide so unterschiedlich? John Locke glaubt, der Mensch komme als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Tabula rasa, wird das genannt. Und dass wir erst durch die Erziehung geformt werden. Aber es scheint, dass ihr beide, du und Oskar, von Anfang an eine eigene Persönlichkeit mitgebracht habt.«
»Meine Mutter sagt immer, ich war schon als Säugling neugierig und wollte alles erkunden.«
»Das waren jetzt mehrere Hinweise, dass die Vererbung einen gewissen Einfluss hat. Heißt das, wir sind bloß so eine Art Maschine? Die lediglich ausagiert, was in unseren Genen festgelegt ist?«
Anton schüttelte den Kopf. »Wär' ich in 'ner schicken Villa aufgewachsen, würd' ich bestimmt anders über Streiks und Gewerkschaften denken. Außerdem gibt's Dinge, die ich als Kind erlebt hab', die ham mein Leben verändert.«
»Zum Beispiel?«
»Ich war viel allein, weil meine Eltern beide arbeiten müssen, das hat mich selbstständig gemacht. Und Bücher zu lesen, darauf wär' ich als Knirps nie gekomm'. Erst als ich lange krank war und im Bett liegen musste, hab' ich das für mich entdeckt. Seither bin ich verrückt danach, wie Sie wissen. Und natürlich hat mich der Tod meines kleinen Bruders verändert.«
»Auf welche Weise?«
»Meine Freunde ham damals gesagt, ich bin stiller geworden. Nachdenklicher. Und sicher nich' mehr so leichtsinnig wie früher. Weil ich gesehen hab', wie schnell das Leben vorbei sein kann.«
»Offenbar ist die Antwort auf die Frage, was uns prägt, nicht so einfach.« Hendrik dachte nach. »Du hast schon mit jungen Jahren einen Detektor-Empfänger zusammengebaut, stimmt's? Und du würdest gern beim Rundfunk arbeiten oder als Beleuchter am Theater. Hattest du nie den Wunsch, Fabrikarbeiter zu werden wie dein Vater?«
»Nee.«
»Warum nicht?«
»Ich mag technische Sachen.«
»Hat dir das jemand nahe gebracht?«
»Das war schon immer so. Ich hab’ alles auseinandergenomm' und untersucht, wie's aufgebaut is'. Und die Seiten inner Zeitung über Radios und Telefone und so gelesen. Und mit Leuten geredet, die was mit Technik machen: dem Automechaniker in unserer Straße und Herrn Stöhr, Sie wissen schon, dem Beleuchter vom Theater, und sei'm Bruder beim Rundfunk.«
»Was bedeutet das in Hinblick auf die Frage, was uns prägt, was meinst du?«
»Vielleicht … dass wir Situationen suchen, die uns helfen, die Vorlieben in unseren Genen und das, was in uns angelegt is', umzusetzen?«
»Das ist ein kluger Gedanke. Wir reagieren auf unsere Umwelt, aber wir selektieren auch.«
»Was denken Sie? Was is' wichtiger: das, was angeboren is', oder das, was wir lernen?«
»Ich würde keins von beiden unterschätzen. Die Forschung an eineiigen Zwillingen, die getrennt aufwuchsen, legt nahe, dass Menschen mit identischer genetischer Ausstattung trotz unterschiedlicher Umweltfaktoren eine ähnliche Persönlichkeit entwickeln. Andererseits zeigt sich, dass adoptierte Kinder einen ähnlichen Humor ausbilden wie die leiblichen Kinder, mit denen sie zusammenleben. Und natürlich kann man ein Kind fördern oder vernachlässigen, was sich unweigerlich auf seine Intelligenz auswirkt. Ich halte es für gefährlich, einen der beiden Faktoren – Erbgut oder Umwelt – überzubewerten und den anderen zu bagatellisieren.«
Zumal sich beide Richtungen zu einer totalitären Ideologie missbrauchen ließen. Die Nazis glaubten, Gene seien alles, es gebe daher höherwertige und minderwertige Rassen, die durch Zuchtwahl und die Prinzipien der Eugenik gefördert oder beseitigt werden sollten. Die Sowjets glaubten, alle Menschen seien gleich, die Umwelt sei das Entscheidende, und bevorzugten daher die Methoden der Gehirnwäsche, indem sie Familien trennten, Menschen aus ihrer natürlichen Umwelt rissen und in Umerziehungslager steckten.
In diesem Augenblick ging ein Schlüssel in der Wohnungstür, Antons Vater kam nach Hause. »'n Abend, Herr Lilienthal. Hallo, Anton!«
»Guten Abend, Herr Broscheck. Sie sehen erschöpft aus.«
»War kein Zuckerschlecken heute.« Curt Broscheck goss sich ein Glas Wasser ein und setzte sich an den Tisch.
»Wieder kein Glück gehabt?«
»Wie man’s nimmt. Frühmorgens warte ich immer in einer der Kneipen rings um die Zentralmarkthalle. Manchmal werden da Leute gebraucht, die helfen, Obst und Gemüse von den Waggons zu laden. Man wird stundenweise bezahlt und bekommt auch 'n paar Naturalien.« Er hob die Leinentasche hoch, die er neben dem Tisch abgestellt hatte und in der sich Kohl und Äpfel befanden. Anton nahm sie ihm ab und packte die Lebensmittel aus.
Hendrik war klar, dass Herr Broscheck diese Gelegenheitsarbeit kaum beim Wohlfahrtsamt angeben würde. Wer wollte schon riskieren, dass ihm der Lohn von der spärlichen staatlichen Hilfe abgezogen wurde? Nach sechsundzwanzig Wochen Arbeitslosenunterstützung und dreizehn Wochen Krisenfürsorge gab es für ein Ehepaar mit Kind 19,95 Mark Unterstützung pro Woche. Wer konnte davon existieren?
Als würde Herr Broscheck ahnen, was ihm durch den Kopf ging, sagte er: »Letzte Woche war 'n Prüfer hier. Hat 'rumgeschnüffelt, Schränke geöffnet, sogar bei den Nachbarn herumgehorcht, ohne sich zu erkennen zu geben. Und die Verbrecher, die sich an der Krise gesundstoßen, während sie Leute entlassen und Löhne drücken, kommen wie immer ungeschoren davon.«
Hendrik nickte. Es war auch ein Vertrauensbeweis, dass Curt Broscheck so offen von seinem Zusatzverdienst sprach. Aber nach über zehn Jahren, in denen Hendrik Anton unterrichtete, wussten sie, woran sie miteinander waren.
Offenbar tat es dem Arbeiter gut, sich seine Not von der Seele zu reden, denn er fuhr fort: »Dabei ham se mich neulich auf'm Wohlfahrtsamt wie 'n Verbrecher verhört. Erst zwei Stunden warten, dann die Papiere vorlegen: Entlassungsschein, Abmeldung von der Krankenkasse, Stempelkarte, und dann Fragen beantworten, nach mei'm Familienstand, mein' finanziellen Verhältnissen, nach der Wohnung, nach allem. Erstaunlich, dass se nich' auch die Beschaffenheit meines Stuhlgangs wissen wollten.« Er nahm das Glas Wasser und trank es in einem Zug leer.
Hendrik wusste nicht, was er sagen sollte, also nickte er bloß wieder.
»Nach der Markthalle bin ich zum Arbeitsamt«, sagte Herr Brocheck. »Warten, warten, warten. Warten is' da die Hauptbeschäftigung. Eine behördliche Verpflichtung, untätig zu sein. Ich hab’ mich gezwungen, so lange wie möglich die Uhr an der Wand nich' anzusehen und dann zu schätzen, wie viel Zeit inzwischen vergangen is’. Hab’ mich immer verschätzt. Hab’ immer geglaubt, es wär' schon viel später. Man könnte wahnsinnig werden dabei. Und am Ende gab’s wieder nix für mich.«
»Was ist mit dem Rundfunk?«, erkundigte sich Hendrik. »Das Arbeitsamt verkündet doch manchmal während des Programms offene Stellen.«
»Ja, klar. Da suchen se Stenotypistinnen, die bereit sind, nach Griechenland zu geh'n. Und warnen die Leute vom Land davor, nach Berlin zu kommen, weil's hier keine Arbeit gibt.«
Hendrik musste ihm Recht geben. Drei Minuten vom Arbeitsamt lautete das großspurige Motto der Rundfunkmeldungen, aber es handelte sich eher um eine Alibiveranstaltung.
»Die Zeitungsanzeigen hab’ ich natürlich auch studiert und meine Runde bei Bekannten gemacht, um zu fragen, ob se was für mich ham oder zumindest wissen, wo wer gesucht wird. Die seh'n mich mittlerweile lieber von hinten. Einige tun so, als wär'n se nich' zu Hause, wenn ich klopfe. Ich kann's ihn' nich' mal verübeln. Aber ich hab’ 'ne Familie, an die ich denken muss. Ich kann auf so was keine Rücksicht nehm'.«
Nicht zum ersten Mal fühlte sich Hendrik ohnmächtig angesichts der Not der Broschecks. Er hatte schon mal mit etwas Geld ausgeholfen, aber natürlich war ihnen das peinlich gewesen, und insbesondere Curt Broscheck lehnte es ab, noch einmal etwas von ihm zu nehmen.
Der neue Fall seines Bruders fiel Hendrik ein. Die Spreewolle war ein großer Betrieb. Auch wenn es schien, als sei die Firma in Schwierigkeiten, war doch bislang nicht von Konkurs die Rede. Gregor wollte seine Ermittlung übermorgen, nach dem Karfreitag, dort fortsetzen. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, Curt Broscheck zu Arbeit zu verhelfen, wenn Hendrik ihn dem Personalchef empfahl. Ja, das war eine gute Idee! Er würde Gregor bitten, bei dem Gespräch dabei sein zu dürfen.
7
Weil Nathan Gruber, Vorstandsvorsitzender und möglicher künftiger Geschäftsführer der Spreewolle, noch nicht an seinem Arbeitsplatz eingetroffen war, beschlossen Hendrik und Gregor, sich in der Fabrik umzusehen, und waren überrascht, dass alles seinen gewohnten Gang zu gehen schien. Auf den ersten Blick vermittelte die Firma den Eindruck eines prosperierenden Unternehmens. Der Lagerschuppen war bis an den Rand mit Rohwolle gefüllt, und es trafen weitere Lieferungen ein. In den Sortierräumen waren Männer und Frauen damit beschäftigt, die Vliese auf Tischen auszubreiten und nach Feinheitsgraden zu sortieren. In Bottichen wurde die Wolle mit Wasser, Soda und Seife aus der eigenen Seifenfabrik gereinigt und von Fett befreit, anschließend getrocknet. Walzen lösten die Ware in einzelne Härchen auf und befreiten sie zugleich von Pflanzenresten. Dann wurde verstreckt, parallelisiert und ausgekämmt, nochmals gewaschen, getrocknet, geplättet und auf Kreuzspulen gewickelt. In den Packsälen bereiteten Männer die Fertigspulen zum Versand an die Kammgarnspinnereien vor. Auch die chemische Abteilung, in der aus dem Wollwaschwasser Wollfett, Pottasche und Dünger gewonnen wurde, brummte vor Geschäftigkeit. Bei genauem Hinsehen konnte man jedoch erkennen, dass den Arbeitern die prekäre Situation der Fabrik bewusst war: Viele gingen umher, als trügen sie eine Last auf den Schultern, es wurde kaum gesprochen, geschweige denn gescherzt.
Die Wirtschaftskrise hielt sich nun schon anderthalb Jahre, und ein Ende war nicht abzusehen. Es gab knapp fünf Millionen Arbeitslose im Deutschen Reich, von denen nur die Hälfte die Arbeitslosenversicherung in Anspruch nehmen konnte, der Rest war auf Krisenunterstützung und Wohlfahrt angewiesen. Über zweiundzwanzigtausend Konkurse hatte es im vorigen Jahr gegeben. Arbeitsgeber nutzten die Gelegenheit, um Löhne zu drücken. Im Januar hatten die Bergarbeiter an der Ruhr nach gescheiterten Tarifverhandlungen und Massenentlassungen gestreikt, wobei es zu Gewalttätigkeiten zwischen ihnen und der Polizei, aber auch untereinander gekommen war. Nicht wenige Familien wurden aus ihren Wohnungen geworfen, weil sie die Miete nicht zahlen konnten. Selbstmordraten schnellten in die Höhe.
Im Dezember vergangenen Jahres hatte Reichskanzler Brüning mit Rückendeckung durch Reichspräsident Hindenburg eine Notverordnung erlassen, die unter anderem eine Reduzierung der Beamtengehälter vorsah. Er versuchte, die durch die Folgen der Wirtschaftskrise sinkenden Steuereinnahmen aufzufangen, indem er Steuern erhöhte, Löhne und Gehälter kürzte und Sozialabgaben abbaute, was die Misere eher noch verschärfte. Ganz abgesehen davon, dass etwa die ostelbische Großlandwirtschaft weiter subventioniert wurde und die Bewältigung der Krise überwiegend auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen wurde. Hendrik argwöhnte, dass Brüning mit seinen Notverordnungen bewusst einen schleichenden Wandel im politischen Alltag und damit eine Gewöhnung an eine autoritäre Regierungspraxis in Gang setzte. Der wirtschaftliche Zusammenbruch und die Not der Bevölkerung dienten ihm zudem als willkommenes Alibi für das Unvermögen des Staates, die vereinbarten Reparationszahlungen an die Siegermächte aus dem Großen Krieg – dem Weltkrieg, wie sie ihn jetzt nannten – zu leisten.
Aus Furcht vor einer Stärkung der Rechts- und Linksradikalen nach einem etwaigen Sturz der Regierung hatte sich die SPD zu einer Politik der Tolerierung Brünings und seiner rigorosen Sparmaßnahmen entschlossen und Misstrauensanträge im Parlament verhindert. Zugleich gab sie damit allerdings die Kontrolle des Reichstags gegenüber der Regierung preis. Und die Gewerkschaften kämpften nicht länger für Lohnerhöhungen, sondern nur noch dafür, den Schaden durch Lohnkürzungen in Grenzen zu halten. Aus all diesen Gründen war die drückende Stimmung der Belegschaft in der Fabrik nur allzu verständlich.
Hendrik und Gregor beendeten ihren Rundgang und begaben sich über den gepflasterten Fabrikhof zum Bürotrakt.
Nathan Gruber war mittlerweile eingetroffen und saß in seinem Bürostuhl zurückgelehnt, kaute an einer Gewürzgurke und blätterte in der Berliner Morgenpost vom Vortag. »Immer herein!«, rief er, als die Sekretärin sie ankündigte. »Haben Sie sich auch die Mondfinsternis angesehen?«, fragte er und hielt einen Artikel hoch. Im Schatten der Erde, hieß es dort.
Hendrik schüttelte den Kopf. Tatsächlich hatte er wegen der Auseinandersetzung mit Oskar Cremer nicht mehr daran gedacht und das Ereignis am Donnerstag verpasst.
»Macht nichts, am 26. September haben Sie noch mal Gelegenheit dazu.« Jetzt erst richtete sich Herr Gruber auf, lud sie mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen, und strahlte sie mit einem gewinnenden Lächeln an, als wollte er ihnen gleich ein Schnäppchen anbieten.
Gregor suchte sich einen Stuhl gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden aus, Hendrik nahm weiter hinten Platz und schrieb mit, wie sein Bruder ihm aufgetragen hatte.
»Bitte entschuldigen Sie die Unordnung«, fuhr Herr Gruber fort und schob nachlässig einen Stapel aufgeschlagener Zeitungen beiseite. »Unordnung spricht für einen kreativen Geist.« Er fischte eine weitere Gewürzgurke aus einem Glas. »Ich liebe Spreewälder Gurken. Wollen Sie auch eine? Nein? Direkt vom Erzeuger. Ich verhandele immer direkt mit Erzeugern, nie über Mittelsmänner. Das ist eine der Grundlagen von Erfolg.« Er schraubte den Deckel des Glases zu. »Gurken haben reichlich Vitamine, das ist viel zu wenig bekannt. Und gut gegen Magenbeschwerden sind sie auch, wussten Sie das?«
»Wir möchten Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen«, unterbrach Gregor den Redeschwall.
»Natürlich, natürlich. Sie wollen mir sicher vom tragischen Selbstmord von Herrn Debus berichten, aber das weiß ich schon. Ich habe meine Ohren überall. Sonst bringt man es nämlich im Geschäftsleben zu nichts.«
»Nein«, erwiderte Gregor, »das wollte ich keineswegs.«
»Nicht?« Jetzt sah Herr Debus ratlos aus. »Was könnte die Polizei denn sonst hier wollen? Gibt’s Ärger mit einem Mitarbeiter?«
»Ich will Sie nicht über einen Selbstmord in Kenntnis setzen, sondern führe eine Untersuchungen über einen möglichen Mord an Herrn Debus durch.«
»Mord? Sie meinen …?«
»Welchen Grund haben Sie, einen Selbstmord zu vermuten?«, wollte Gregor wissen.
»Nun ja … Er war beunruhigt wegen der Wirtschaftskrise und ihrer Auswirkung auf die Firma. Wir haben etliche Angestellte entlassen müssen. Es sind Kredite zurückzuzahlen.«
»Und Sie sind nicht beunruhigt?«
»Ich lasse mich nicht so leicht ins Bockshorn jagen. Die Lage ist ernst, aber die Firma hat eine solide Basis. Meiner Meinung nach werden wir die Krise überstehen, womöglich sogar gestärkt daraus hervorgehen, da einige unserer Konkurrenten über kurz oder lang Konkurs anmelden müssen. Herr Debus hätte mehr Vertrauen in die Spreewolle haben sollen. Sie glauben wirklich, er sei ermordet worden? Wie kommen Sie darauf?«
Gregor ging nicht auf die Frage ein. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«, wollte er wissen.
»Am Mittwoch. Hier, in der Firma. Wir sind ein paar Zahlen durchgegangen, haben über Lieferungen gesprochen, über die Qualität der erhaltenen Rohwolle, über mögliche neue Absatzmärkte. Wir planen eine groß angelegte Werbekampagne. In manchen Dingen war Herr Debus altmodisch. Ich habe ihm klargemacht, wie wichtig ein modernes Profil ist, dass wir hochwertiges Briefpapier brauchen und ein besseres Firmensignet. Man muss etwas von Psychologie verstehen, um diese Dinge richtig einordnen zu können. Wir verkaufen nicht bloß Wolle, sondern eine Marke. Das Ansehen der Marke macht dreißig Prozent des Erfolgs aus. Und dann muss man natürlich die grundlegenden Prinzipien berücksichtigen: was, wann, wie, wo. Die Sache sorgfältig vorbereiten, den Markt sondieren, abwägen und dann zuschlagen.«
»Da haben Sie sich ja einiges vorgenommen.«
»Ich bin seit zehn Jahren in der Textilindustrie, ich kenne mich aus. Ich habe schon alles gesehen, glauben Sie mir. Ursprünglich komme ich aus kleinen Verhältnissen und habe mich Stück für Stück emporgearbeitet. Wo andere aufgeben, habe ich erst angefangen. So manches Mal musste ich mich wie Münchhausen an meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Aber am Ende bin ich immer siegreich aus allen Katastrophen hervorgegangen. Weil ich schon als Kind kapiert habe, wie der Hase läuft. Außerdem pflege ich Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in der Politik. Ich gehe regelmäßig mit Arbeitsminister Stegerwald essen. Bei Robert’s. Kennen Sie das? Sehr amerikanisch. Sehr modern. Da liegt die Zukunft. Ich esse nie woanders.«
»Zurück zu Herrn Debus. Wirkte er verändert, als Sie ihn zuletzt sprachen? War er vielleicht über irgendetwas beunruhigt, abgesehen von der wirtschaftlichen Situation?«
Herr Gruber zuckte die Achseln.
Das Telefon klingelte. Der Vorstandsvorsitzende nahm ab. »Gruber? Ach, Sie sind’s. Guten Morgen! Danke der Nachfrage. So weit gut, aber viel Arbeit. Ich ackere jeden Tag bis in die Puppen. Komme kaum vor Mitternacht nach Hause.«
Während Herr Gruber telefonierte, sah Hendrik sich um. Der Aktenschrank war geschlossen, darauf stand ein Grammophon, das seinem Zustand nach zu urteilen oft benutzt wurde. Neben dem Telefon waren Zeitungen aufgeschlagen, allerdings nicht auf den Wirtschaftsseiten, sondern beim Sportteil. Und in der Funkstunde war das Radioprogramm um fünf Uhr nachmittags angestrichen: II. Halbzeit vom Länder-Hockeyspiel Deutschland – England. Offenbar hatte der Vorstandsvorsitzende genug Muße, um während der Arbeitszeit Sportberichte zu hören. Dem Anrufer gegenüber ließ er sich indes immer noch darüber aus, wie beschäftigt er war. Hendrik konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Hälfte seiner Arbeitszeit darin bestand, anderen zu erzählen, wie viel er zu tun hatte.
Endlich kam sein Gesprächspartner zum Grund des Anrufs – es ging um eine verspätete Lieferung –, der in einer Minute abgehakt war. Herr Gruber traf jedoch keine Anstalten aufzulegen, sondern nickte den Brüdern Lilienthal kurz zu und sprach dann über die Mondfinsternis. Gregor runzelte die Stirn, weil der Vorstandsvorsitzende ihn warten ließ. Hendrik hatte den Eindruck, dass dies weder Unhöflichkeit noch eine Machtdemonstration, sondern lediglich dem Charakter des Mannes zu verdanken war.
Das Telefongespräch wandte sich der Politik zu. »Also, ich an Brünings Stelle würde auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen setzen. Kreditfinanzierte Staatsaufträge. Das sind doch alles Dilettanten da. Na ja, Brüning ist sowieso bald weg vom Fenster. Hugenberg ist der kommende Mann, das habe ich im Blut. Merken Sie sich meine Worte.«
Erst nach zehn Minuten beendete Herr Gruber das Gespräch. »Entschuldigung. Dauernd klingelt das Telefon, ich weiß kaum, wo mir der Kopf steht. Wo waren wir?«
»Am Mittwoch zwischen halb acht und neun Uhr abends – was haben Sie da gemacht?«
»Ich hoffe, Sie verdächtigen nicht mich, etwas mit dem Tod von Herrn Debus zu tun zu haben. Das wäre nämlich schön dumm von mir. Ich verliere mit ihm meinen Förderer. Er hat mich in den Vorstand geholt und wollte mich zum Geschäftsführer aufbauen. Für mich war er so etwas wie mein Mentor. Was jetzt wird, steht in den Sternen.«
»Es war geplant, dass Sie künftig die Firma leiten?«
»Herr Debus hatte vor, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Sie werden es sicher sowieso von irgendjemandem hören: Die Spreewolle war nicht gerade sein Traum. Er hatte keine Ader fürs Geschäftliche. In letzter Zeit hat er sich mehr und mehr auf meine Empfehlungen verlassen. Aber er war ein wunderbarer Mensch. Kollegial, ohne jede Eitelkeit.«
»Wer übernimmt die Firma, was meinen Sie?«
»Vermutlich seine Frau. Kinder hat er nicht, es gibt auch keinen Bruder, und seine Schwester, na ja …« Herr Gruber kaute auf seiner Unterlippe. »Womöglich wird die Spreewolle liquidiert. Wenn jemand die Firma übernimmt, der keine Ahnung vom Geschäft hat … Oder Herr Franke von der Frawo, unser größter Konkurrent, besticht ein paar Abgeordnete und streckt seine gierigen Finger nach dem Unternehmen aus.«
»Kommen wir zu meiner Frage zurück. Wo waren Sie Mittwoch Abend?«
»Im Deutschen Theater. Der Hauptmann von Köpenick. Das Stück fing um acht an. Ursprünglich wollte ich mir Liliom in der Volksbühne ansehen, wegen Hans Albers, habe mich dann aber doch umentschieden. Es soll nicht besonders viel taugen.«
»Gibt es dafür Zeugen?«
Herr Gruber zuckte die Achseln.
Wenn seine Aussage der Wahrheit entsprach, schied er als Verdächtiger aus, dachte Hendrik. Laut Oliver Pauly war der Tod zwischen halb acht und neun eingetreten, und in einer halben Stunde hätte Herr Gruber es nie geschafft, seinen Gönner umzubringen und rechtzeitig im Theater zu sein. Allerdings dürfte es nicht leicht sein, das Alibi zu verifizieren. Vielleicht erkannten ihn die Damen an der Abendkasse wieder.
»Was wissen Sie über das Verhältnis zwischen Herrn Debus und seiner Frau?«
»Freundschaftlich, würde ich sagen. Vielleicht nicht oder nicht mehr die große Leidenschaft, aber gegenseitiger Respekt. Wenn Sie sie verdächtigen, ihren Gatten ermordet zu haben, sind Sie auf dem Holzweg. Eine feine Person. Immer korrekt.«
»Sie erwähnten die Konkurrenz. Können Sie sich vorstellen, dass dort Rivalitäten aus dem Ruder gelaufen sind?«
»Herr Franke von der Frawo versucht ständig, uns zu übertrumpfen, zieht aber immer den Kürzeren. Aus professioneller Sicht muss ich sagen, dass er viel zu kleinkariert denkt. Dass er einen Mord begangen haben könnte, halte ich allerdings für ausgeschlossen. Seine bevorzugte Methode ist die Intrige.«
»Wer könnte sonst ein Interesse daran gehabt haben, Herrn Debus zu töten?«
»Es gab Entlassungen. Nicht alle Arbeiter haben das hingenommen. Hier und da sind Gefühle hochgekocht. Durchaus verständlich in diesen schwierigen Zeiten. Ich glaube, es hat Drohungen gegeben, aber da fragen Sie besser Herrn Thomae, unseren Personalchef.«
Wunderbar, dachte Hendrik. Das gibt mir Gelegenheit, Curt Broscheck ins Spiel zu bringen.
8
Während sein Bruder die Sekretärin von Herrn Debus befragte, nutzte Hendrik die Atempause, um sich einige Tageszeitungen zu besorgen. Er war neugierig, wie sich der Streit in der Hitlerbewegung entwickelte.
Gestern Nacht hatten die SA-Leute um Hauptmann Stennes offenbar das Berliner Hitlerhaus geräumt, nachdem sie zuvor nur Leute hereingelassen hatten, die sich durch einen SA-Ausweis legitimieren konnten. Dabei war es mehr als einmal zu Handgreiflichkeiten zwischen ihnen und jenen Nazis gekommen, die Hitler die Treue hielten. Man warf sich gegenseitig Gesinnungslosigkeit und Verrat vor. Wie es aussah, waren auch die ewigen Totengräber der Republik, Kapitän Ehrhardt und Manfred von Killinger, wieder mittendrin. Dem Berliner Tageblatt zufolge hatte Stennes-Anhänger Ernst Werner Techow, der damals am Mordkomplott gegen Walther Rathenau beteiligt gewesen war, den Anhängern des »Führers« entgegengehalten: »Dazu haben wir den Rathenau umgebracht, dass Ihr Bürgerbonzen euch jetzt hier hereinsetzt!« Nun also gehörte das Hitlerhaus wieder Hitler.
Der schien jedoch in Panik geraten zu sein. Zwar wurde in seinem Völkischen Beobachter behauptet, die Meuterei von Stennes sei zusammengebrochen, gleichzeitig gab es darin jedoch eine von Ernst Röhm unterzeichnete Anordnung, wonach sämtliche SA-Führer bis zum 12. April eine schriftliche Gehorsamserklärung gegenüber Hitler abzugeben hatten, andernfalls würden sie aus der Partei ausgeschlossen. Geradezu komisch waren die Verrenkungen, die Hitler unternahm, um Stennes nachträglich zu diskreditieren, indem er etwa behauptete, dieser sei »im Inneren nie Nationalsozialist gewesen«.
Angewidert warf Hendrik die Zeitungen in einen Papierkorb und gesellte sich zu seinem Bruder, der gerade das Zimmer der Sekretärin verließ. »Und?«
»Die Sekretärin weiß auch nichts. Angeblich hat sich der Wollbaron wie immer verhalten.«
Gemeinsam begaben sie sich zum Personalchef. Hendrik hatte mit seinem Bruder abgesprochen, dass er sich zunächst für Curt Broscheck verwenden durfte, ehe die eigentliche Befragung begann, deshalb erkundigte er sich, nachdem Gregor sich und ihn vorgestellt hatte: »Mir ist klar, dass Sie Personal entlassen mussten, aber gibt es dennoch Stellen in der Produktion, bei denen Ihnen Arbeiter fehlen?«
Herr Thomae betrachtete ihn von oben bis unten, als wollte er sagen: Sie sehen nicht gerade wie jemand aus, der es gewohnt ist zuzupacken.
»Es geht nicht um mich, sondern um einen Bekannten. Ein zuverlässiger Arbeiter, fleißig, vertrauenswürdig.«
»Es gibt derzeit keine freien Stellen bei uns. Und wenn, dann würde ich diese nicht aufgrund von Protektion besetzen. Es wird erwartet, dass eine Bewerbung den üblichen Weg nimmt. Ich halte mich an die gesetzlichen Bestimmungen und die Gepflogenheiten des Hauses.«
Während des Wortwechsels hatte Herr Thomae keine Gefühlsregung gezeigt. Überhaupt war er steif wie ein tiefgefrorener Fisch. Die Krawatte und der hoch geschlossene Kragen mussten ihn halb erwürgen, ohne dass ihm Anzeichen von Atemnot anzusehen waren. Auf Hendrik wirkte er wie ein Buchhalter, der Menschen ebenso verschiffen würde wie Schweinehälften, solange die Bilanz stimmt.
»Wissen Sie vielleicht von einer freien Stelle bei Ihren Geschäftsfreunden?«
»Ich pflege mich nicht in die Verhältnisse anderer Unternehmen einzumischen.«
Es hatte wohl keinen Zweck, weiter nachzuhaken. Schade. Hendrik hatte natürlich nicht damit gerechnet, gleich einen Arbeitsvertrag für Herrn Broscheck in die Hand gedrückt zu bekommen, aber eine Empfehlung und etwas mehr Bemühen hatte er sich schon erhofft.
»Ich gebe Ihnen aber gern ein paar Tipps für Ihren Bekannten mit auf den Weg«, schnarrte Herr Thomae. »Bewerbungsschreiben sollten kurz und prägnant gehalten sein, sauber, in einwandfreiem Deutsch und ohne schwülstige Redensarten. Und immer handschriftlich, wegen der graphologischen Prüfung durch die Firmenleitung. Besonders interessieren natürlich Fachkenntnisse und Erfahrungen. Schulzeugnisse sagen dagegen wenig aus, und Zeugnisse über die bisherigen Stellungen sind nur wegen des lückenlosen Nachweises der Beschäftigungen von Interesse und nicht wegen des Inhalts, da es Firmen bekanntlich untersagt ist, ungünstige Tatsachen hineinzuschreiben, die geeignet sind, den Erhalt einer neuen Stellung zu erschweren. Wer diese Punkte beachtet, kann zumindest damit rechnen, nicht sofort aussortiert zu werden.«
Hendrik murmelte einen Dank, obwohl er die Ausführungen des Personalchefs wenig nützlich fand. Der Mann erinnerte ihn an einen Satz von Montaigne: Ich habe oft Menschen getroffen, die vor lauter Höflichkeit unhöflich waren und ungeschliffen durch zu viel Schliff.
Gregor übernahm die Gesprächsführung. »Herr Thomae«, sagte er, »ich leite die Untersuchung über den mutmaßlichen Mord an Herrn Debus, und –«
»Mord?« Jetzt zeigte der Personalchef zum ersten Mal eine Reaktion. »Ich dachte –«
»Sie haben in den letzten Monaten Arbeiter entlassen?«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.