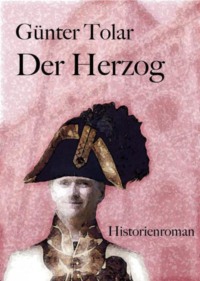Kitabı oku: «Der Herzog», sayfa 8
Aber noch berichten wir ja von der Zeit, in der Joseph Moritz den Herzog noch nicht so gut kannte, dass er behaupten konnte, dass er „ihm nahe war".
Joseph Moritz hat den vorigen Teil seines rückschauenden Berichtes, den er genau am 16. Geburtstag des Herzogs geschrieben hat, unterbrochen und hat erst spät am Abend, vor dem Zubettgehen oder schon im Bett, weitergearbeitet.
Erinnern wir uns, Joseph Moritz war unsicher, ob er heute noch den Herzog sehen würde. Und er war auch unmutig, weil er verschwitzt hatte, ob der Herzog jetzt eine Nachricht schicken hatten wollen oder nicht.
Da war keine Nachricht. Und jetzt geht der Franz wohl zu Bett. Es ist seine Zeit. Ich tue es ihm gleich.
Jetzt, wo er müde wohl eingeschlafen ist, wandern meine Gedanken wieder zurück.
Wie er sich von mir hat erklären lassen, was da für Personen am Wasserglacis verkehren. Wie er gelacht hat, daß der Eipeldauer das Wasserglacis „Fratzenglacis“ genannt hat, sich wohl darüber ärgernd, daß da so viele Kinder lärmend spielten. Und der Franz war damals ja selber noch ein Kind, sieben oder acht Jahre alt und von den anderen Kindern respektvoll und scheu betrachtet, wohl weil er wegen seines Standes nicht im Stande war, mitzuspielen.
Da gibt es eine Notiz des Joseph Moritz aus dem Sommer des Jahres 1818, die von „respektvoll“ nicht viel spricht. Es war wieder einer dieser Dienstage.
Nach einigem suchenden Umherirren am Glacis entdeckte ich den Herzog und Foresti dann endlich am Wasserglacis. Schon gut, schon sehr gut, diese großen Wiesen, unverbaut, weil sie die Stadt ja doch von den proles in den Vorstädten räumlich gebührend trennen. Dennoch aber sind die Glacis eine Zone höchster Unordnung und höchst anlassiger Freiheit und Freizügigkeit, wo sich Bürger, Gesellen und Arbeiter ihre freien Stunden um die Ohren schlagen. Des Nachts wagt sich kein ordentlicher Mensch da hinaus, weil sich da die Huren und das Kriminal der Szene bemächtigen.
Der Herzog und Foresti standen da und blickten hinüber zum Kur-Pavillon des Friedrich Pelikan. Zwischen ihnen und dem Pavillon auf der Wiese, spielten Kinder mit Bällen, die sie wohl aus alten Flicken zusammengenäht hatten. Immer wieder aber glotzten die unsauberen kleinen Bälger auf den Herzog, der da in seinem hellblauen seidenen Sommerwams da stand. Er ist ja nicht älter als sie, er ist ein Kind wie sie. Und als so ein Flickenball einmal direkt vor seinen Füßen landete, da versuchte er ihn mit dem Fuß zu den Kindern zurückzustoßen. Dabei stieß er aber kläglich daneben, sodaß er fast aus dem Gleichgewichte kam; die Kinder lachten schallend. Der Foresti hob den Ball schnell auf und warf ihn zu den Kindern; die hatten aber zu lachen aufgehört, als plötzlich zwei Mann Wache da waren und drohend auf die erstarrten Kinder zugingen. Diese rannten wie auf ein Kommando los und verzogen sich in den Pavillon oder dahinter. Der Foresti aber hatte den Herzog umgewandt zum Weggehen; da erblickten sie mich.
Foresti grüßte kurz und sagte dann zum Herzog: „Durchlaucht, das ist schon eher ein Umgang für Euch.“
Das „schon eher“ des Foresti machte mich heiß.
Der Herzog aber lächelte und sagte zu mir: „Hat er gesehen, wie ich den Ball verfehlt habe?“
Ich empörte mich gleich weiter: „Das ist aber auch kein Spiel für Durchlaucht, mit dem Fuße zu stoßen!“ Und ich fügte hinzu: „Auf dem Wasserglacis promeniert die elegante Welt erst am Abend!“
Sogleich befiel mich eine Angst, denn es stand mir sicherlich nicht zu, am Herzog Kritik zu üben.
Er aber fragte unbefangen: „Warum ist er dann hier, Herr Graf?“
Empörung, Angst, alle wichen sie einer Verwirrung. Weil Er da sei, wollte ich schon sagen, sagte es aber nicht.
Er aber vollendete selbst: „Schön jedenfalls, sonst würden wir uns ja nicht sehen.“
Dann nahm er mich wie einen guten Onkel bei der Hand und deutete auf ein Milch verkaufendes Mädchen: „Was bietet denn die da feil?“
Und jetzt erklärte ich ihm die „Geißmädchen“, die Ziegenmilch verkauften, und die „Brezelbäcker“. Und drüben im Kur-Pavillon gibt es mehrere Sorten von Mineralwässern. Wir sahen auch den Werkelmann Johann Riegler, der gar wundersame Melodien spielte, immer ein wenig falsch. Und den blinden Harfenisten Karl Perfetta, der gar virtuos spielte. Als wir mit dem Herzog vor ihm standen, unterbrach er kurz sein Spiel, schnupperte in die Luft und sagte dann mit hoher Stimme: „Na? Die noblichte Gesellschaft jetzt schon unterwegs? Fangt’s früher an mit die guten Trinkgelder!“
Er hatte wohl mein Parfum gerochen. Ich fühlte mich ungut, weil auch mein Vater mich schon als „Duftwolke“ bezeichnet hat. Der Herzog gab dem Foresti einen Wink, und der gab dem Perfetta ein schönes Trinkgeld. Er steckte es ihm aber in die Tasche seiner Weste, wohl damit es ihm nicht aus dem Hut gestohlen würde.
Auch der zerlumpte „Hahnreiter“ war da, die Arme voll mit Parapluies.
Es war mir schon eine Erleichterung, als wir uns aus der übelriechenden Umgebung wieder in die ruhigeren und ordentlicheren Gefilde begaben, ohne proles.
„Wieso weiß er so viel von denen da?“, fragte mich der Herzog. Ich wußte nicht, was antworten.
„Ach ja“, fuhr er fort, „er hat ja Freunde da. Den Schneider meine ich, und so...“
Dann dachte er nach, bis er zu mir aufblickte, im Gehen: „Ich werd’ ihn fragen, wenn ich da was wissen will. Immer ihn. Nur ihn. Ist ihm das recht?“
Ich verbeugte mich ob der huldvollen Frage.
Dann sprach er bis zur Einbiegung ins Burgtor kein Wort mehr.
Dort aber murmelte er dann doch - mehr für sich selbst als für uns andere: „Ich muß das mit dem Ball ein wenig üben.“
Dann sagte er aber doch für uns alle lächelnd: „Geht doch nicht, daß die mehr können als ich!“
Dann tänzelte er allerliebst davon, mit dem rechten Fuß immer so tuend, als würde er einen Ball wegstoßen. Die Bewegungen sahen virtuos aus, es war aber auch kein Ball da, der ihren Effekt hätte beweisen können.
Ungeminderte Standesdünkel und Spott gleichzeitig gegen den durchlauchtigst ungeschickten Buben. Und Stolz, dass man sich doch mit den unteren Ständen auch ein wenig auskannte, dem Leben der – übelriechenden - Leut’ also ein wenig näher stand als der Bub in seinem Käfig da oben.
Was aber schreibt der Joseph Moritz acht Jahre später?
Ich entsinne mich, daß damals der Franz zum ersten Mal Neigungen zu proletarischem Verhalten nicht verhehlte. Das war wohl auch der Grundstein für so manche Derbheiten, die er später seiner Umgebung und auch mir manchmal angedeihen ließ.
Wie klar war alles damals. Und wie unklar ist alles heute. Ich kann nicht mehr wachen, sonst schlafe ich noch, wenn der Franz schon munter ist. Und ich möchte keine Sekunde verschlafen, die der Franz wach erlebt. Er wäre mir sicher böse darob.
Das war es, was Joseph Moritz am Tage des 16. Geburtstages des Herzogs notiert hat. Es klingt, als ob er gerne Franz das Kind zurück hätte. Wenn Joseph Moritz allein ist in einer Zeit, in der er den Herzog gerne sähe, oder in der er den Herzog eigentlich sehen sollte, vom Zeitplan her, dann neigt er dazu, zurückzublicken. Kein Blick aber in die Zukunft, auf das, was kommen wird und soll.
Daher schleppt sich das Tagebuch auch, solange die ständigen geheimen Besuche beim Herzog noch nicht stattfinden, in Alltagsnotizen dahin. Wir aber greifen weiterhin penibel alles heraus, was uns weiterbringt in der Geschichte des Joseph Moritz und des Herzogs von Reichstadt.
KAPITEL 9
25. Mai 1819.
Welch wohltuend genaue Datierung.
Heute fand am Donaukanal die feierliche Grundsteinlegung zu einer Brücke statt, die einmal „Ferdinandsbrücke“ heißen soll. Am Kanalufer war zum Empfang des Hofes ein prunkvolles Zelt aufgebaut. Die alte Schlagbrücke wird bald abgerissen werden. Die Redner betonten, daß es sich bei dem neuen Brückenbau um eine höchst revolutionäre Art des Unterwasserbaues handeln würde. Ein Ingenieur erläuterte worte- und gestenreich ganz genau das neue Verfahren.
Der Herzog war mit meinem Vater und Foresti erschienen. In der ersten Reihe war nur Seine Majestät.
In der zweiten Reihe, bei den Erzherzögen, fand der Herzog Platz; mein Vater in der zweiten Reihe, ich, der ich ihn begleiten durfte, in der dritten Reihe, Foresti hinter mir.
Ich blickte unverwandt auf das unter seinem Hut hervorquellende Blondhaar des Herzogs und die darunter befindliche helle Haut seines Halses. Ein kleines Muttermal entdeckte ich, und eine ebenso ganz kleine Warze, knapp ober der Kragenkante, wo der Körper im verhüllenden Wams versank.
Die genaue Schilderung lässt den Schluss zu, dass die Aussicht den Schreiber sehr beeindruckt hat.
Der Herzog blickte sich um und lächelte dermaßen, daß ich mich ertappt fühlte und mir recht heiß wurde.
Joseph Moritz vermittelt uns manchmal den Anschein, als handle es sich bei dem Herzog um eine männliche Lolita, die ihr naives Spiel mit einem um zehn Jahre älteren Mann treibt. Aus der Sicht des Joseph Moritz – und wir haben nur diese Sicht – mag es vielleicht auch so gewesen sein. Er fühlte so, wie der Mann, mit dem Lolita ihr Spiel getrieben hat. Der Herzog hat – zumindest damals noch - nicht mit dem Joseph Moritz gespielt. Der Joseph Moritz muss sich selbst aber eingestehen, dass ein Typ wie der Herzog mit ihm spielen kann. Hier wird keiner hingezogen, hier sinkt einer hin, einem Sog folgend, der aus seinem eigenen Drang entsteht. Und der Herzog ist es, zu dem es Joseph Moritz in seinem Drang zieht. Zieht. Also doch Sog. Sog in einen geliebten - Schlund. Und das ist der Herzog.
Ich bin so unruhig, so schwebend, jetzt, da ich wieder daheim bin, daß ich ausreiten muß. Einfach ausreiten.
Wie einst James Dean, der derart sogar in den Tod „geritten“ ist.
Und schon am Abend schrieb Joseph Moritz - nach anfänglicher Selbstanalyse - von viel Glück.
Da verschaffte nämlich der wirkliche Zufall zum zweiten Male die Möglichkeit, neben den Dienstagen ein weiteres mehr oder minder zufälliges Zusammentreffen der beiden zu arrangieren.
Ich bin also ungeduldig losgeritten, wobei ich aber die in der Stadt erlaubte Schnelligkeit nicht zu überschreiten mich bemühte. Wenn auch der Harro, mein Lieblingshengst, meine Ungeduld wohl spürte und immer wieder in schnellere Gangart zu fallen sich anschickte. Aber mit ihm zügelte ich auch mich, beruhigte ich auch mich. So wurde dann, als wir nach Passieren des Donaukanales das freiere Gelände bald erreicht hatten, wo auch die Beschränkung der Schnelligkeit nicht mehr giltig wäre, ein Ritt des Nachdenkens. Auch Harro hatte sich dem zugesellt und dachte wohl mit mir.
Und immer wieder schüttelte Harro seinen edlen Kopf. Das mit dem edlen Kopf schreibe ich übrigens nur, weil ein Pferd eben einen edlen Kopf zu haben hat. In Wahrheit kommt mir ein Pferdekopf plump, unförmig, häßlich geformt, glotzäugig und sogar ausgesprochen blöde vor. Aber gut so. Edler Kopf.
Und immer, wenn der Harro seinen Kopf schüttelte, nahm ich es als Antwort eines aufmerksamen Zuhörers, der mir sich verpflichtend versprochen hatte, selbst nichts zu sagen, sondern meinen Gedankenmonolog unwidersprochen sich anzuhören. Aber das Kopfschütteln konnte ich ihm doch nicht verbieten. So lenkte er meine Gedanken, leitete sie um, hemmte ihren Fluß, bedeutete mir Sackgassen, ließ mich letztendlich aber so zu keinem Ende kommen. Aber vielleicht war da gar kein Ende zu denken und Harro verhinderte nur, daß ich zu der Erkenntnis kommen konnte, daß da gar kein Ende war, auf das ich so hindenken wollte. So handelte ich also mein waidwundes Innenleben in der Form eines Dialoges mit einem Pferd ab. Einem Hengst.
Was ist mit mir, daß ich ein Zerren und Ziehen in mir habe, das mir jede Entscheidung nimmt? Gleichgültig, was ich da denke, für und wider - das Zerren und Ziehen gewinnt immer; das Gewinnen steht gar nie in Frage. So sehr ich es auch in Frage stellen mag. Ich tu’ was und da ist immer was. Aber was?
Und immer ist am Ende des Ziehens und Zerrens der Herzog. Er selbst, oder in meinen Gedanken gegenwärtig. Immer der Herzog. Ich empfand jetzt Schmerz in der Brust, einen Krampf um das Herz herum.
Da schüttelte der Harro den Kopf.
Ich atmete tief ein und der Gedanke drehte sich um. Der Schmerz blieb zwar, der Krampf hielt auch, aber da schlich Freude heran, als hätte ich mir meine Frage selbst beantwortet, sodaß ich zufrieden sein durfte. Ich freute mich ja, wenn ich den Herzog sah. Ich empfand jedesmal - und auch jetzt - ein taumelartiges Glücksgefühl.
Der Schmerz begann zu galoppieren. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, der Kragen wurde mir zu eng, mein Atem wurde schnell. Das alles bemerkte ich und merkte ich mir genau, um es aufschreiben zu können. Glück. Da war ja plötzlich Glück.
Da schüttelte Harro den Kopf.
Was da eben noch heiß war, wurde kühler, wurde kalt, starr, fahl und verlor jede Farbe.
Glück? Glück, wenn ich einen zehn Jahre jüngeren Buben sah? Dachte? Traf? Ein Muttermal und eine Warze entdeckte? Mich am verhüllten Körper weiterdachte? Weiter dachte wohin? Mich an der Haut eines Kindes weiterdachte? Eines Buben? O Gott!
Ich weine jetzt, der Leser wird die Tropfen vielleicht am gewölbten Papier sehen. Ich sehe nicht gut, was ich schreibe, ich blinzle und schreibe durch die Tränen durch, ich muß weiter, weiter!
In mir brannte es. Wie Eis. Das Reiten tat mir weh. Mein Körper fing ob der Starrheit die Stöße des Pferdes nicht ab. Blödes Pferd, kannst du nicht ruhig gehen? Ich fühlte mich wie gepfählt an einer Stange von Eis. Kopf, Mund, Hals, Herz, Atem, Magen, Gedärm - alles aus Eis, brennendes Eis. Scham? War das die tiefe Scham?
Harro! Harro schüttelte den Kopf.
Was schämte ich mich? Was hatte ich mich zu schämen? Wes hatte ich mich zu schämen? Ich habe den Buben gern. Was ist daran? Ich sehe ihn gern? Was ist daran? Auch er sieht mich gern? Also? Das habe ich ganz vergessen. Der Bub sieht mich auch gern!
Harro, hör’ auf, den Kopf zu schütteln.
Ich weiß, ich weiß, da ist ein Unterschied. Ich liebe den Buben. Den Buben, der Bub ist ein Bub. Und ich bin ein Mann. Ich liebe ihn mit der Seele und mit dem Körper. Nein. Mit dem Körper nicht. Nicht so, wie den Schneider Hans. Nicht so.
Der Czernin und der Belcredi und vor allem der Todesco, alles Burschen in meinem Alter, haben sich neulich unterhalten über die Mädchen, die Apponyi, die Komarom und noch eine Ungarin.
„Die sind viel leichter zu haben“, sagte der eine, welcher weiß ich nicht mehr.
„Aber paß’ auf, eine Ungarin heiraten ist derzeit nicht opportun.“
„Wer sagt das?“
„Na, zum Beispiel der Metternich.“
„Der soll doch schauen, bei wem und bei was sein eigenes Schwänzchen sich erhebt!“
Und wir lachten alle recht laut.
Da flüsterte einer - es war der Czernin: „Ob die Apponyi unten auch rot ist?“
Wir blickten einander verschmitzt ratlos an. Da sagte der Belcredi leise, aber dezidiert: „Sie ist.“
Alle fragten sofort: „Was?“
„Unten rot. Was sonst?“
„Woher weißt du das?“, fragten wir alle wild durcheinander.
Er aber gab sich geheimnisvoll: „Ich weiß es eben. Das muß genügen!“
Der Todesco aber meinte verächtlich: „Das hätt’ er gern. Das denkt er sich so.“
Dann deutete er auf die lange, dicke Ausbuchtung auf des Belcredi untere Leibesmitte: „Da schau. Das hätt’ er gern.“
Der Czernin lenkte ein: „Also wenn ich an das Rote unten an der Apponyi denke, dann kann ich auch nicht anders.“
Auch er hatte sich erhoben.
Jetzt grinste auch der Todesco: „Wenn das mir passiert, meiner ist so spitz, daß er immer gerade wegsteht.“
Und er reckte seinen Unterleib vor, von dem sich ein vulkanartiger Kegel wegstreckte.
Und ich? Mich fragten sie zum Glück nicht. Dennoch wagte ich die Bemerkung: „Also mir gibt die Apponyi überhaupt nichts!“
Alle wandten sich mir zu: „So? Von wem schwärmst denn du?“
Ich lächelte. Ich lächelte verlegen, weil ich nicht wußte, was antworten.
„He“, rief da der Czernin, „ist da nicht die Ludmilla von den Weissenbergs?“
Ich erschrak. Nicht nur, dass mein Vater mir die Ludmilla Weissenberg als gute Partie gleichsam empfohlen hat, jeden reden auch schon die anderen darüber.
In meinem Schreck sagte ich: „Die Ludmilla? Nein! Nein! Nein!“
Ich Tölpel, hätt ich’s bei der Ludmilla bewenden lassen. So aber deuteten sie es so: „Ach, da ist was Geheimes?“
„Wer denn?“ und „Wir haben ja auch erzählt!“
Ich schüttelte den Kopf, aber nur um den Schneider Hans aus meinem Kopfe zu vertreiben. Er hatte vor mir in seiner Werkstatt ein Beinkleid probiert, ich habe ihn so gesehen, daß ich von ihm geträumt habe, selig geträumt. Und die drei lachten, denn auch meine Hose hatte jetzt eine Wölbung. Verflucht, diese französische Mode, der ich huldigte.
Hier taucht einer der Namen der drei Grazien von der Liebesinsel in Dubrovnik auf.
Gedanken beutelte es durch mich hindurch.
„Gefällt das enge Zeug, das du trägst den Mädchen?“, hatte mein Vater gefragt. „Oder gefällt es nur dir?“
Harro schüttelte den Kopf. Wir waren auf einem Weg, den ich nicht kannte.
Hatte der Herzog schon Haare da unten? Einen Flaum?
Harro schüttelte wohl den Kopf, weil ich auch jetzt erregt war. Da verwandelte sich mein geistiges Bild des Herzogs plötzlich in das leibhaftige. Wie das geschah?
Es war beim Konstantinhügel, den ich eben umritt. Da stand er mit einemmal auf seinem Pferd vor mir. Hinter ihm der Foresti, grantig blickend; und etwas weiter hinter ihm zwei von der Wache. Ich war fürchterlich erschrocken. Glaubte es nicht. Fühlte meine Erregung plötzlich riesengroß, so als müßte ich darüber hinüber blicken. So, als stünde sie zwischen dem Herzog und mir wie ein Baum. Ich fing meinen schnellen Atem ein, wurde klarer, ruhiger, Harro begann zu grasen, das Pferd des Herzogs auch.
Da begann nach der langen Erstarrung der Foresti das Begrüßungsritual: „Grüß Gott, Herr Graf!“, sagte er so drängend, als wollte er mich darauf aufmerksam machen, daß es auch für mich an der Zeit wäre, zu grüßen.
Also tat ich es: „Einen guten Tag wünsche ich Euer Durchlaucht!“
„Guten Tag“, sagte nun auch recht huldvoll der Herzog. Und er fuhr gleich fort: „Das ist aber nun schon wieder eine Überraschung. Gerade haben wir uns noch bei dem Brückenschlag gesehen - und jetzt hier, wo doch sonst kaum unsereiner hinkommt. So viele Fügung.“
Und zu Foresti gewandt fragte er: „Darf ich den Grafen denn fragen, wie er heißt?“
Foresti darauf eilig: „Der junge Graf Dietrichstein, Sohn Eures Erziehers, den kennt Ihr doch...“
Der Herzog aber schüttelte den Kopf: „Nein. Sowie ich Napoleon und Franz und sonst noch wie heiße. Das meine ich.“
Damit wandte er sich zu mir: „Also?“
„Joseph Moritz“, sagte ich.
„Joseph Moritz“, wiederholte er und lächelte.
„Gefällt Euch der Name nicht?“, fragte ich, „Findet Ihr ihn komisch?“
„Nein, nein“, antwortete der Herzog, „es ist nur, man stellt sich immer was vor unter einem Menschen, auch bei den Namen. Und dann...“
„Was haben sich Durchlaucht denn bei mir vorgestellt?“
„Das weiß ich nicht. Jedenfalls nicht Joseph Moritz. Dabei, ich erinnere mich, er hat mir den Namen schon einmal gesagt. Joseph Moritz.“
Mein Herz schlug, wie er meinen Namen aussprach. Damals hatte er „Molitz“ gesagt.
Dann sah er mich ernst an, immer mit einem Seitenblick auf Foresti: „Und wenn ich jetzt Joseph Moritz, oder Herr Joseph Moritz zu ihm sage, ab jetzt, was wird denn er zu mir sagen?“
„Durchlaucht“, mahnte der Foresti.
Der Herzog aber fuhr unbeirrt fort: „Wenn er will, dann darf er Franz zu mir sagen. Oder sagen wir so: wenn er Franz zu mir sagt, so werde ich nichts dagegen sagen, als Joseph Moritz.“
„Durchlaucht“, mahnte der Foresti, nicht unfreundlich, aber doch unsicher.
„Die Frau Großmutter sagt Fränzchen zu mir. Ich möchte wenigstens einen, der Franz zu mir sagt. Und das soll Er sein, wenn er will.“
Die Frau Großmutter war des Kaisers vierte Gattin Karoline Augusta von Bayern. Sie verhätschelte der Herzog, und sie sagte „Fränzchen“ zu ihm.
„Wir werden ja sehen. nicht?“, sagte da der Herzog, nickte kurz grüßend, gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon. Foresti verbeugte sich ebenfalls und ritt nach. Die beiden Wachen sahen mich an, als wäre ich Luft. Jetzt stand auch der Harro still. Wir beiden standen da, im wunderschönen Grün. Die Vögel sangen plötzlich so laut, so schön, so jubelnd. In mir jubelte es, Harro stand stolz, hoch aufgereckt, ich saß stolz, hoch aufgereckt. Und alles gehörte mir. Es gab einfach nichts, was nicht mir gehört hätte. Und alles war schön. Schön. So schön
Und alles ist schön, so schön. Was habe ich eben geweint? Als ich von der Trauer vor der Begegnung mit dem Herzog geschrieben habe, da habe ich ja schon gewußt, daß alles in Freude enden wird. Und dennoch, ich habe noch einmal geweint; geweint ob der vielen Fragen, die da vorher so unbeantwortbar waren und die jetzt gar nicht mehr beantwortet werden müssen. Keine Fragen, keine Antworten. Joseph Moritz in seinem Munde und Franz in meinem Herzen.
Mit Bangen sehe ich dem nächsten Zusammentreffen entgegen. Was werden wir einander sagen? Der Herzog, nein, der Franz, ist da eher kühl, der heiße bin ich. Er wird Joseph Moritz zu mir sagen. Oder wird er das erst dann tun, wenn ich Franz zu ihm gesagt haben werde?
Warum ist er noch nicht da, der Augenblick der Entscheidung! Da bin ich wieder, in einer neuen Trauer.
Immer schafft er es, ganz dem vertrauten Bild des romantischen Jünglings entsprechend, in eine neue Trauer zu verfallen, sich einen neuen Abgrund an zu denken.
8.10.89 (Playa del IngLes)
Eine neue Angst. Eine neue Unsicherheit. Nur keine Ruhe geben. Sofort unruhig werden, wenn es einmal nichts zu fürchten gibt. Leben ohne Angst, ohne Ängste - das scheint wohl unmöglich. Ungetrübtes Glück, gibt es das? Darf es das geben? Romantik leidet immer. Muß immer leiden. Da lebt ein Klischee vor sich hin.
Joseph Moritz war doch eben noch glücklich gewesen. Aber schon sieht er die nächste Klippe, die nächste vermeintliche Falle des Schicksals, sei sie auch noch so weit weg. Sie ist ja in Wahrheit auch noch einige Jahre weit weg, diese Falle, diese endgültige.
Der Grundgedanke hat Joseph Moritz nicht losgelassen. Schon nach dem nächsten Treffen mit dem Herzog auf der Bastei riecht er überall Zweifel. Medizinisch ausgedrückt inkliniert er auf Zweifel. Er ist sensibilisiert auf Zweifel. Also findet er sie auch. Welche Qual! Verstehen wir den Joseph Moritz?
„Hab' keine Angst“, lesen wir in heutigen Ratgebern, „die Angst ist das größte Hindernis zum Erfolg!“ Als ob das so einfach wäre, KEINE Angst zu haben. Wenn man vermeint, ein hohes, hehres Ziel vor Augen zu haben, vor Augen der Seele gleichsam, dann ist dieses hohe Ziel immer wieder in Gefahr, verloren zu gehen. Und das schafft Angst. Je höher das Ziel, desto größer die Angst.
Man wird es den Beteuerungen des Joseph Moritz also wohl glauben müssen, dass er seine Ziele sehr hoch, allerhöchst ansetzte; und daher kamen auch seine Ängste, die wie um sein Leben gingen.
Vater hat heute wie ein Rohrspatz geschimpft. Metternich – „Ja, wenn er’s nur selber war“ - begehrte der Vater auf, - „dann fiele das Gehorchen wenigstens leichter!“. Aber es war wahrscheinlich gar nicht Metternich, sondern irgendein Unterrichts-Beauftragter, sein Name ist mir wohl entfallen, jedenfalls ein Freiherr von Sowieso - und dem muß mein Vater jetzt gehorchen, da er den Auftrag ausgesprochen hat. Metternich lasse wissen, daß die Unterrichtung des Herzogs den Sommer über mit vollem Nachdrucke fortgesetzt zu werden habe. Was das heißt? Keine Sommerfrische. Der Herzog darf aus Wien nicht hinaus, also gibt es auch keine Verlegung des Unterrichtes in die Sommerfrische. Mutter sagte noch etwas von der Unmöglichkeit der Versorgung des ganzen Trosses und damit war wieder einmal ein Abend verdorben. Ich spüre ein eigentümliches Gefühl tief drinnen. Der Franz in unserer Sommerfrische! Ob ich den Vater nicht doch insistieren sollte, er möge Nachdruck machen, ob es nicht doch möglich wäre, die Unterrichtung zu verlegen? Ich habe also Empörung anklingen lassen; das hat aber meinen Vater mehr in Erstaunen versetzt, als es ihn wirklich zu Widerstand reizte. Der Franz in unserer Sommerfrische. Am Erlaufsee vielleicht? Der Franz. Ich habe ihn vierzehn Tage nicht gesehen. Und morgen ist Dienstag.
Joseph Moritz hat also einen Dienstag ausgelassen. Er schreibt nichts darüber. Wäre er nämlich dort gewesen und der Herzog wäre nicht gekommen, so hätte Joseph Moritz das mit Sicherheit schmerzlich vermerkt. Auch die Begrüßung der beiden am „morgigen“ Dienstag sagt nichts über die ganze Sachlage aus.
Ich lehnte eben an der Außenmauer der Burgbastei etwa auf der Höhe des Burggartens und blickte in das sonnige Grün der Vorstadt Neubau hinaus und hoffte, daß unsere Begegnung einmal stattfinden würde, ohne daß ich ihr körperlich mit Sehnsucht entgegenblickte. Seelisch tat ich es sowieso. All mein gespanntes Sehnen war also dennoch nach hinten gerichtet. Welche Lüge, so verkehrt zu seiner Erwartung zu stehen.
Da sprach es hinter mir: „Guten Tag!“
War da eine bewußte Pause nach dem Guten Tag?
Ich drehte mich um, tat überrascht, verneigte mich schnell, und sagte ebenfalls:
„Guten Tag!“
Nun, bei mir war da eine Pause. Der Franz sah mich so an, als hätte er verstanden, daß da eine Pause gewesen war. Ich weiß, wie soll nach einem gesagten Guten Tag eine Pause merkbar sein, wenn gar nichts mehr darauf gekommen ist? Ich weiß. Aber da waren Pausen. Da ist etwas - nicht gesagt worden.
Der Herzog lächelte, zuckte mit Ergebenheit die Achseln und sagte: „Also gut, kein Joseph Moritz, kein Franz.“
Ich war zutiefst verlegen: „Durchlaucht!“
Franz nickte: „Durchlaucht. Und darüber hat er jetzt vierzehn Tage lang nachdenken müssen?“
„Ja“, sagte ich, und dann mit Nachdruck, „Franz.“
„Fein“, lächelte er jetzt fast hoheitsvoll, „Joseph Moritz.“
Es klang wirklich, als hätte er mich zum Ritter geschlagen.
Der Collin, der das Vorgespräch im Prater ja nicht miterlebt hat, fuhr auf: „Herr Graf, was nimmt er sich heraus?“
Ich aber war ja nun geadelt: „Frag’ er doch den Franz!“
Der Collin fuhr zum Franz herum, der aber sah ihn höchst dumm und höchst dreist an: „Will er dem Joseph Moritz verbieten, mich so zu heißen, wie ich es befohlen habe?“
Collin machte so große Augen, daß ich dachte, sie würden ihm gleich herausfallen.
Franz aber beschloß den Disput: „Na also.“
Dann wendete er sich zu mir, hängte sich an meinen rechten Arm und zog mich zum Spazieren: „Joseph Moritz, erzähl’ er mir, was er die vierzehn Tag’ gemacht hat. Was macht er vierzehn Tage, von denen ich nichts weiß?“
Alles habe ich ihm erzählt. Oder doch vieles. Nur nichts von dem, was ihn betrifft. Wenn immer ich einen Gedanken faßte, wurde mir der Franz zum Kind. Da paßte auf einmal alles dermaßen nicht zusammen, daß es mir geradewegs lächerlich schien, ihm etwas zu erzählen; lächerlich zumindest in dem Augenblicke, in dem ich einen erzählbaren Gedanken beisammen hatte.
Dabei wäre ein privates Gespräch dieser Art und dieses Inhaltes ohne Schwierigkeiten gegangen, denn der Collin war sichtlich froh, daß sein Zögling eine Ansprache hatte und er, Collin, so nun ungehindert seinen eigenen Gedanken nachzuhängen vermochte.
Nun, so berichtete ich eben von den Wirtschaftsstudien, die ich im Blick auf die doch im Einzelnen sehr verschieden gelagerten Länder zu tätigen hatte -
Hier erfahren wir - selten genug - etwas über die Berufsausübung des Joseph Moritz.
- vor allem deshalb, weil, und da stockte ich etwas, weil ich eben sagen wollte, daß der Napoleon wohl einiges durcheinandergebracht hatte. Er aber begriff mich und meinte klüger als es seinem Alter zugestanden wäre: „Ja. Mein Vater hat da viel in Bewegung gesetzt. Kriege setzen immer viel in Bewegung. Und die Toten sind halt bedauernswerte Opfer des Fortschrittes.“
Ich war - und bin es noch - zutiefst erschrocken über dieses doch sehr apodiktische Urteil, das der Franz da so leichthin von sich gegeben hatte. Aber ich wußte ja, woher das kam. Mein Vater hatte den Auftrag, den Franz auch mit seinem Vater und seiner Geschichte zu beschäftigen. Napoleon lebt ja immerhin noch. Was Vater allerdings nicht verhindern kann, ist, daß der Franz Thesen und Merksätze in sein Gedankengut übergehen läßt, die sehr nach Verherrlichung jedweden Krieges riechen.
Des Herzogs immer wieder geäußerter Stoßseufzer war ja auch: „Ich werde wohl nie eine Schlacht lenken!“
Aber, pochte und pocht es in mir voller brennender Ungeduld, wann werde ich es ihm erzählen können? Alles! Wird er mir dann noch zuhören? Zuhören wollen? Was wird, wenn ich das erste mal über alles spreche? Über uns? Wird es das ‚uns’, das ‚wir’ dann noch geben? Wird er mir folgen, so wie ich jetzt vermeine, er folge mir? Ist es ein Wahn? Ein Wahnsinn? Beim Abschied sagte er aber dann doch etwas, das mir höchsten Mut und tiefste Verzweiflung antat: „Weiß er, Joseph Moritz, ich mag ihn sehr. Wirklich sehr.“
Mein Herz war dem Tode nahe vor lauter innerem Druck. ‚Zerspring‘ nicht’, bat ich, ‚nicht jetzt. Nicht gerade jetzt. Bitte!’
Er aber fuhr fort: „Weil er der einzige ist, der ganz normal mit mir redet. Ich bin sehr froh.“
Er wollte schon gehen, hielt aber nachdenklich noch einmal inne: „Das heißt, ich weiß ja nicht, ob das normal ist. Jedenfalls ist es von ihm so gesprochen, wie es mir gefällt. Sehr gefällt. Ist das nun seltsam, oder nicht?“
Und damit ging er mit einem kleinen, aber sehr vertraulichen Abschiedswink.
Hitze und Kälte. Als er das sagte und jetzt. Was aber bleibt mir? Er ist mir so nahe wie noch nie. Und ich bin von ihm so weit weg, wie ich noch nie gewesen bin, seit wir uns kennen. Was ist das aber denn? Entferne ich mich von ihm im gleichen Maße, in dem ich vermeine, ihm näher zu kommen? Darf ich nicht drängen? Vielleicht sollte ich nicht drängen. Soll ich einfach die Jahre kommen lassen? Die Jahre. Wieviele sind es noch, bis er erwacht? Fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre? Ich muß wohl stillhalten, damit er nicht erschrickt, wenn er erwacht. Und mich wirklich sieht.