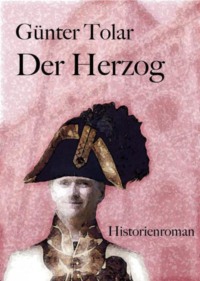Kitabı oku: «Der Herzog», sayfa 7
Der Herzog war’s, der neben mir Halt gemacht hatte, in kleiner Distanz umzingelt von seinen vier Wachen, Collin neben ihm, der mich aufmerksam betrachtete.
Der Herzog hatte geseufzt und sprach jetzt halb ernst weiter: „Und ich muß dann wieder erwägen, ob ich die Strafe durchführe oder nicht. Also sei er gut, und erzähl’ er nichts daheim, ja?“
Collin lächelte jetzt höflich und verbeugte sich leicht: „Guten Tag, Herr Graf!“
Ich nickte nur zurück, da ich ja nicht sicher wußte, ob es Collin war.
Der Herzog blickte sich zu ihm um: „Der Collin -“
- also war er es -
„- hält zu mir. Der ist ein Dichter und kein Lehrer.“
Collin lächelte und verbeugte sich: „Es wäre allerdings gut, wenn Eure Durchlaucht nicht zu viele Mitwisser hätten, ich wäre sonst verpflichtet...“
„Der junge Graf Dietrichstein ist mein Freund, da gilt das alles nicht.“
Jetzt sah der Herzog mich an: „Oder?“
Ich stotterte nur: „Ja, ja, Durchlaucht.“
„Er ist verwirrt“, lächelte der Herzog, „kein Wunder, er hat ja eben erst erfahren, daß ich sein Freund bin. Das kann einen schon verwirren!“
Damit ging er mit einem Ruck weg, winkte abwesend noch leicht mit der Hand zu mir, und schritt weiter.
Da stand ich nun, mit rotem Kopf, mit meinen siebzehn Jahren, völlig geschlagen von diesem Herzog mit seinen - ja, es sind sieben Jahre. Hoch intelligent, liebenswürdig, bezaubernd, mit seinen blonden Locken.
Ich bin verwirrt, wenn ich jetzt an ihn denke, weil ich in eine Schwärmerei verfalle. Ich spüre eine Schwärmerei in mir. Eine kleine Hitze tief drinnen.
Ich muß mir das zu Hilfe rufen, was Vater über ihn sagt: Er liebt es, seine Lehrer zu ärgern, plötzlich und überraschend. Er ist ungestüm, nervös und sehr ungehorsam. Wenn er seine Lehrer ärgert und sieht, daß sie sich wirklich ärgern, dann sagt er: „Die Faulheit reitet mich!“
Dennoch, die Schwärmerei bleibt. So ein kleiner - mir fällt nichts ein; bringt einen ganz durcheinander, der Bub.
Einige Tage nach dieser schwärmerischen Begegnung hat Joseph Moritz seinen Vater in ein Gespräch über den Herzog verwickelt.
Ich mußte einfach das Bild wieder aus mir herausbringen und erzählte meinem Vater von der Begegnung auf der Bastei, ohne allerdings die Dinge zu erwähnen, um deren Verschweigen mich der Herzog gebeten hatte.
Mein Vater schien fast froh, einmal ein wenig über den Buben sprechen zu können. Es war nicht viel Erfreuliches: „Sein einziges wirkliches Interesse sind militärische Dinge. Das wird schon fast zur Leidenschaft.“
Also doch viel vom Vater Napoleon?
„Das Waffenhandwerk ist zweifellos das einzige, das er gern ergreifen würde. Alle seine Interessen deuten darauf hin, und man wird es bedauern müssen, daß man solchen Anlagen nicht entgegenkommen kann.“
Ich nickte. Da waren vor allem die Erzherzöge, die alle zuerst Regimenter bekamen.
„Zerstreut ist er, gleichgültig, flüchtig, unbesonnen, voller Widerspruchsgeist...“
Ich sehe den Buben vor mir. Plötzlich an einen anderen Hof gebracht. Aus Frankreich in ein deutsch sprechendes Land; niemals hat er seinen Vater gesehen; seine Mutter regiert in Parma, sie hat keine Zeit für ihn; nur Männer erziehen ihn; keine mütterliche Güte und Wärme; keine Spielgefährten...
Das heiße Bild verschwindet nicht in mir. Der Vater hat meine Gedanken erraten: „Ich schreibe seiner Mutter immer wieder, daß die Gefühlswelt des Prinzen gestärkt werden müßte, und was gäbe es denn Heiligeres für ihn als die Liebe seiner Mutter. Aber die Erzherzogin ist in Parma mit Arbeit überhäuft.“
Ja, dachte ich für mich, aufgebracht, im Bette mit dem Neipperg.
„Der Neipperg hat geantwortet: die Fürsorge Ihrer Majestät ist mehr denn je durch ihre Untertanen beansprucht.“
Ja, wogt es in mir, sie macht Bastarde; macht sich selber immer neue Untertanen. Das letzte, von dem ich weiß, ist die kleine Albertine Montenuovo – welch’ läppische Übersetzung des Namens Neipperg. Eine Tarnung nur für die ganz dummen.
Und Napoleon lebt noch.
Das Bild ist nicht aus mir heraus. Arme, kleine Durchlaucht. Wenn mein Vater wenigstens meine Mutter hin und wieder an den Herzog heranließe. Aber das hat Metternich nicht so bestellt. Ich werde den Buben nie wieder gleichgültig ansehen können.
Spuren? Ja, hier sind sie zu finden. Zum ersten Mal unwiderlegbar. Joseph Moritz hat den Herzog von jetzt an bis an ihrer beider Lebensende nie mehr vergessen.
Ich möchte den Buben wiedersehen. Ich muß den Buben wiedersehen.
So hat Joseph Moritz schon etwa zwei Wochen später geschrieben.
Eingedenk, daß es das letzte Mal ein Dienstag Spät-Nachmittag gewesen war, daß ich den Herzog auf der Bastei zu treffen das Vergnügen hatte, fragte ich meinen Vater, allerdings etwas rundherum: „Geht der Herzog immer mit dem Collin spazieren?“
Mich interessierte der Collin natürlich überhaupt nicht.
„Zumeist“, antwortete Vater, „manchmal auch mit dem Foresti. Einer von den zweien ist es immer.“
Gut, dachte ich mir, heute ist Dienstag.
„Aber heute nicht“, fiel da dem Vater ein. „Ihre kaiserliche Hoheit ist hier und hält Hof.“
Ich hatte nicht sogleich verstanden, also vervollständigte Vater die Information recht derb: „Marie Louise, unsere Mutter aus Parma ist hier.“
Jetzt wußte ich es aber schon.
Hier wagen wir einen Vorgriff.
Joseph Moritz konnte ja über den Besuch der Herzog-Mutter nicht mehr berichten, als dass an diesem Dienstag ihretwegen der Basteien-Spaziergang des Herzog ausfiel.
Insgesamt war sie ja von 1818 bis 1832 nur sieben Mal in Wien. Und da sah sie ihren Sohn immer nur kurz und förmlich. Dieser erste Besuch aber hat den Herzog sehr beeindruckt. Es war am 21. Juli 1831, am Todestag Napoleons, da sprachen der Herzog und Joseph Moritz über die Mutter; und da hat der Herzog von diesem ersten Besuch erzählt.
Franz ist in diesen Tagen sehr elegisch. Er spricht viel von früher, beklagt, wie schon so oft, daß er nicht einmal wisse, wie seines Vaters Stimme geklungen habe.
„Wie hat er gesprochen?“, fragte er mich. „Im Jahr 1809 hast du schon gelebt. Hast du ihn nie gehört?“
„Damals war man froh, wenn man ihn NICHT sah“, antwortete ich vorsichtig. „Und ich habe ihn nie gesehen, weil mein Vater ihn nicht...“
Hier unterbrach ich mich, nicht wissend, wie ich mich ausdrücken sollte.
„Nicht sehen wollte?“, fuhr mir Franz hinein. „Ihn wohl haßte?“
„Nicht haßte“, verneinte ich, „wir gehören dem Hochadel an. Und der war eben auf Distanz. Damals!“
„Ja, ja“, beschwichtigte mich Franz und legte die Hand auf meine Schulter. Dabei blickte er an mir vorbei in die Ferne.
„Ich weiß ja kaum mehr“, sagte er dann mit tiefer Resignation, „wie die Stimme meiner Mutter klingt. Und die - lebt ja noch.“
Grimm sprach aus ihm. Sehnsucht. Nicht-Begreifen. Wehmut. Dann drückte er fest meine Schulter und sah mich an: „Warum rede ich mit dir? Warum nicht ebenso mit meiner Mutter?“
Und wieder entfernte sich sein Blick.
„Ihre Kaiserliche Hoheit, die Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla - so hat mein Hofmeister gerufen. Und dann ist sie hereingekommen. Eine prachtvolle Frau. Mit einem furchtbar schweren Kleid, das bei jedem ihrer energischen Schritte erst nachwippte. Weißt du, so...“
Er ließ mich los und wackelte mir den Gang seiner Mutter vor, wobei er die Arme vorne und hinten schräg von sich weghielt; er wollte damit wohl den Umfang des Kleides imitieren. So schob er sich ruckartig durch den Raum. Er sah recht komisch aus, wie er da seinen Unterleib geziert und doch voller Energie gleichsam vor sich herschob. Ich liebe ihn so. Zu lachen wagte ich nicht. Nicht einmal zu lächeln. Er hatte keine Mutter, also spielte er sie. Und jetzt war sie da. Er blieb stehen und blickte vor sich hinunter, als stünde jemand kleinerer vor ihm: „Also das ist er geworden, hat sie gesagt, und mich sehr von oben angeschaut. Sehr von oben. Sie hat sich sogar noch zurückgeneigt - -“
Franz neigte sich zurück und blickte jetzt noch mehr von oben nach unten.
„- - und hat mich noch mehr von oben angeschaut.
Wollen Sie nicht Platz nehmen, Frau Mutter, habe ich recht förmlich gesagt.
Und wir haben Platz genommen.“
Franz nahm jetzt auch Platz, an dem anderen Ende des Sofas, auf dem ich saß. Ich war jetzt gleichsam er, der Herzog von damals. Auch jetzt saß er aufrecht, sogar etwas zurückgeneigt, um den Blick von oben herab beibehalten zu können.
„Ich setzte mich in der gelernten Haltung hin, blickte zum Grafen -“
- er meinte jetzt meinen Vater -
„- der ist dort drüben gesessen, er nickt, also ist meine Sitzhaltung in Ordnung und ich konnte in ihr erstarren.
Mhm, sagte sie, gute Haltung. Und zum Grafen, guter Lehrer, mhm.
Der Graf verneigte sich und sagte irgendetwas Nettes über mich.
Wir haben dann über das Lernen gesprochen, über die Fortschritte; sie sprach von sich selber, von der vielen Arbeit in Parma. Eine arme Frau, die sie sei, die für ihre Existenz im fremden Land hart arbeiten müsse. Vom Vater hat sie nicht gesprochen, und ich habe so darauf gewartet. Sie weiß wohl, wie die Stimme meines Vaters geklungen hat. Sie hat gehört, wenn er etwas Wichtiges sagte. Historisches. Bedeutendes. Wenn er eine Schlacht plante.“
„Die wird er sicher nicht mit ihr besprochen haben“, warf ich ein.
„Doch, doch“, beharrte er, „er hat. So eine Schlacht läßt einen nicht los.“
Und nach einer kleinen Pause sprach der Franz leise weiter: „Und er hat ihr Liebkosungen ins Ohr geflüstert. Sie hat seinen heißen, feuchten Atem in ihrem Ohr gespürt, es hat sie gekitzelt. Und er hat -“
Franz hielt inne. Er war bewegt. Atmete tief durch, dann sprach er weiter, wobei er unverwandt meinen Bauch anstarrte.
„Die ganze Zeit, während wir geredet haben, habe ich an ihren Bauch gedacht, in dem ich drinnen gewesen bin, von meinem Vater -“
Als wollte ihm das Wort nicht einfallen. Oder als wollte es nicht über seine Lippen. Nicht aus seinem geöffneten Mund hinaus.
„- hineingespritzt.“
Und immer starrte er auf meinen Unterleib.
„Ich dachte an ihre Scham, durch die ich herausgekrochen bin unter dem dicken, schweren Kleid - “
„Du warst damals acht Jahre alt“, erinnerte ich ihn.
Franz aber reagierte sehr heftig: „Ich habe damals schon gewußt, daß die Kinder den Weibern aus dem Bauch kriechen. Ich weiß es genau, daß ich es damals schon gewußt habe.“
Ich war zutiefst verwirrt und muß wohl auch recht erschrocken dreingeschaut haben. Der Franz blickte nämlich plötzlich auf, mir direkt ins Angesicht, lächelte, ja lachte sogar fast, rückte ganz nahe zu mir herzu, schnippste mit seinem Zeigefinger und seinem Daumen genau dorthin auf meiner Hose, wo er vermuten durfte, daß ich empfindlich bin, und sagte: „Wie konnte ich nur! Wie konnte ich nur in dieser reizenden Hose die Scham meiner Mutter erstarren. Was bin ich doch für ein Ferkel, nicht wahr?“
Kehren wir zurück in das Jahr 1818.
Joseph Moritz hat seine Dienstag-Spät-Nachmittag-Spaziergänge ab nun mit denen des Herzogs koordiniert. Er hat uns noch einige Begegnungen geschildert.
Kühl ist es geworden. Von gestern auf heute. Sehr kühl sogar für Anfang September. Ich habe die Kühle unterschätzt und mich nicht warm genug angezogen. Ein unguter, feuchter Wind blies über die Bastei. Alle sonstige Lieblichkeit war heute plötzlich häßlich in der Kälte, in der Feuchte.
Ich fror. Ich friere jetzt nicht mehr. Wie es dazu kam? Mein Wams und meine Hose waren innen kalt, wo ich an das Seidenfutter anstieß. So versuchte ich mich ganz klein zu machen in meinem Gewande, um die Wände nicht zu berühren. Das konnte mir aber nur besonders gut beim Stehen gelingen.
Als ich wieder so dastand und in die graue feuchte Vorstadt hinausblickte, hörte ich die Stimme neben mir.
„Er friert auch, das sehe ich.“
Ich wendete mich um und verbeugte mich sofort. Der Herzog stand da. Lächelnd und sichtbar auch fröstelnd. Sein heutiger Begleiter war der Hauptmann Foresti, dessen rotes Gesicht nicht den Eindruck von Frieren vermittelte, sondern eher von innerer Hitze zeugte, woher immer sie auch kommen mochte.
„Schön, daß wir den gleichen Ausgeh-Rythmus haben“, sagte der Bub.
„Zufall“, beeilte ich mich zu bemerken, „nur Zufall, Durchlaucht!“
„Dann wollen wir dem Zufall aber dankbar sein und ihn einen guten Freund darob heißen.“
Ich verbeugte mich, heiß vor Freude.
Der Herzog blickte mich aufmerksam an: „Jetzt hat er gar einen roten Kopf bekommen. Das bedeutet Hitze, nicht?“
Er fragte jetzt den Foresti.
Der verbeugte sich leicht und meinte: „Wir wollen umkehren, Durchlaucht.“
Der Herzog nickte und wandte sich zum Gehen.
Da drehte er sich noch einmal um: „Übrigens, Sein Herr Vater ist auch für meine Gesundheit verantwortlich. Sag’ er ihm, er soll besser aufpassen. Auf uns beide!“
Er winkte leicht, zog sich in sein Wams zurück, und ging Richtung Burg davon.
Mir aber war nun nicht mehr kalt. Bis zu Hause nicht. Bis jetzt nicht. Da erwächst mir ein herzerwärmender Freund. Noch kein Mensch hat mich gewärmt. Meine Mutter vielleicht? Vielleicht. Aber nicht so, wie der Herzog. Nicht so!
Niemals hat ihn so ein Mensch erwärmt. Wir geben die Spurensuche auf. Denn jetzt haben wir es schon längst nicht mehr nur mit Spuren zu tun. Jetzt sind wir schon mitten im Spiel, mitten im ersten Akt der Tragödie. Joseph Moritz und der Herzog haben aneinander Gefallen gefunden. Den Unterschied von zehn Jahren empfindet keiner der beiden als störend. Joseph Moritz überbrückt den Unterschied durch den schuldigen Respekt, und der Herzog tut dasselbe mit der durchlauchtigsten Herablassung. So kommen sie einander durch den Standesunterschied bedingt entgegen. Standesunterschied, der verbindet, auch so etwas kann es geben.
Es folgen Tage, an denen Joseph Moritz gar nichts über den Herzog schreibt. An vielen Tagen schreibt er überhaupt nichts. Aber die Begegnungen mit dem Herzog scheint er alle zu vermerken. Da Joseph Moritz auch die Dienstage vermerkt, an denen er den Herzog nicht trifft, dürfte der Schluss gerechtfertigt sein, dass er wirklich alle Begegnungen erwähnte. Einmal kürzer, einmal länger.
Liebe Dienstags-Gewohnheit. Heute regnet es. Noch immer. Bin spazieren gegangen. Dennoch. Der Herzog mit einem grantig ihn antreibenden Collin über die Bastei gestürmt wie sein Vater zur Schlacht - und zurück. Kurz gegrüßt und eine Geste gemacht, die mir mitteilte, ich darf nicht stehenbleiben. Aber er lächelte.
Ein andermal.
Der Schneider-Hans war heute auf der Bastei. Allein flanierend. Hin sah er mich nicht, aber als er zurück ging und sich eben zum wiederholten Hin-Gehen umwandte, da erblickte er mich.
„Oh, Herr Graf“, rief er und schien zu erröten. Genau sah ich es nicht, aber seine Augen bekamen einen verlegenen Glanz, so als hätte ich ihn bei etwas ertappt.
Nun, ertappt war er ja. Wozu geht er denn neuerdings auf die Bastei? Auf und ab? Denn das ging er. Auf und ab. Auf – hab’ ich ihn gesehen, ab – hab’ ich ihn gesehen, und jetzt eben wieder auf...
Ob er sich neuerdings leicht auch zur Schau stelle, wollte ich soeben giftig fragen.
Da hörte ich die Stimme: „Der Herr Graf heute in Gesellschaft?“
Der Herzog und Foresti standen neben uns. Mit leicht geöffnetem Mantel, weil es recht warm war hier in der Sonne. Oder war mir nur warm ob der Situation?
„Mein Schneider, Durchlaucht“, versuchte ich mich zu entschuldigen.
Er betrachtete den Hans, der sich, den Herzog wohl erkannt habend, tief verbeugte: „Ein Schneider, so hübsch wie das, was er schneidert.“
Dabei deutete er auf mein Wams. Ich trug das hellblaue mit den Ärmel-Bändern.
„Durchlaucht“, gab sich der Hans geehrt, „das schönste ist immer noch der Mensch selber.“
„Das verhüllt er aber sehr hübsch“, sagte er, indem er noch einmal mein Wams von oben bis unten musterte.
‚Hübsch’ ist wohl ein Lieblingswort des Herzogs derzeit.
Der sah sich eben den Hans an: „Vielleicht werd’ ich auch einmal ein so hübscher Mann. Ob er mir dann was schneidern wird?“
„Es wäre mir eine Ehre, Durchlaucht“, verbeugte sich der Hans nun noch einmal.
Ich betrachtete mit einem schnellen Blick den schön gerundeten Hintern des Hans, der beim Verbeugen so besonders formschön zur Geltung kam. Diese Devotion einmal bei mir, dachte ich für mich. So gefällig und bereit, Befehle zu empfangen einmal bei mir. Aber er liebt ja Kugelwaden. Ein Kugelweib. Wo mochte sie wohl sein? Daheim? Die Werkstatt sauberfegend? Oder hatte er sich nicht mehr? Warum stellte er sich denn zur Schau? Und er gefällt ja nicht nur mir, er gefällt auch dem Herzog.
Der Herzog: Der war weg. Ich verstimmt.
Auch der Hans hat sich schnell verabschiedet.
Ein Beispiel noch.
Der letzte Dienstag vor Weihnachten. Ich hätt’ ihm so gerne eine frohe Weihnacht gewünscht. Aber er war nicht da. Alles für heute aufgespart. Aber er war nicht da. Die ganze Freude auf heute konzentriert. Aber er war nicht da.
Er war nicht da.
Wie allein ich doch bin. Immer an ihn denkend. Wenn man mit jemand ist, läßt alle Spannung nach. Wenn man aber andauernd an jemand denken muß, weil er nicht da ist, dann läßt die Spannung nicht nach. Nie.
Ich Tölpel, bin ich doch glatt verliebt!
Mit diesem Geständnis wollen wir das Jahr 1818 beendet lassen.
KAPITEL 8
Im Jahr 1827 widmete Joseph Moritz aus Anlass von des Herzogs 16. Geburtstag sich in seinem Tagebuch einem höchst eigenen Rückblick.
Heute wird der Franz 16 Jahre alt. Ein Fest, an dem ich auch in diesem Jahr nicht teilnehmen darf. Da erscheint Seine Majestät persönlich. Und die Erzherzöge, die dem Franz nicht gram sind. Einige sehen in ihm ja immer noch den Napoleon, in dessen Schatten sie stehen. Nicht bei jedem Erzherzog erscheint der Kaiser zum Geburtstag; so hat es mir mein Vater erzählt. Beim Franz aber kommt er. Weil der Franz keine Mutter hat. Und keinen Vater. Im vorigen Jahr war die Mutter da, glaube ich. In diesem Jahr hat sie wegen dringender Geschäfte nur schriftlich gratuliert und ermahnt. Der Franz hat geweint, als er mir den Brief zeigte gestern. Und mein Vater ist sehr bitter darüber: „Die alte Schlampe!“, hat er gesagt.
Der du dies liest, verrat’ ihn nicht, ich bitt’ ihn!
Hätten wir den Satz auf die Bitte des Joseph Moritz hin weglassen sollen?
Franz wird heute 16 Jahre alt. Genauso alt, wie ich es war, als ich ihn zum ersten Male sah. Den Buben. Der jetzt ein Mann wird. Schon geworden ist.
Wie bin ich ihm doch damals nachgegangen. Jeden Dienstag auf die Bastei. Auf und ab gelaufen. Bis der Franz gekommen ist. Und wenn er manchmal nicht gekommen ist, dann bin ich hinüber zur Burg und habe, nicht wissend, wo ich hinstarren sollte, alle Fenster angestarrt, hoffend, einen Blick von ihm zu erhaschen. Seinen Schatten hinter einem der Fenster zu erspähen.
Ich glaube, das habe ich damals, als es war, nicht aufgeschrieben, daß ich zumindest eine Stunde lang vor der Burg geschmachtet habe.
Nein, hat er nicht geschrieben.
Als ob der Franz nichts anderes zu tun gehabt hätte, als in einem seiner Fenster zu posieren.
Heute weiß ich, daß ich ja die ganz falsche Fassade angestarrt habe. Dort, wo ich hingeschmachtet habe, befinden sich seine Gemächer gar nicht.
Ich habe viel geweint damals. Und heute, wo ich nicht beim Fest sein darf, fühle ich mich dem Joseph Moritz von damals sehr nahe. Mir ist zum Weinen. Aber ich weine nicht. Ich weiß, daß meine damals so heimliche Liebe heute so laut sein darf, daß der Franz sie vernimmt und weiß.
Dabei war das damals gar nicht heimlich.
Der Franz hat es mir erst neulich anvertraut: „Ich entsinne mich, wie wir uns die ersten male gesehen haben. Da habe ich eine Zuneigung zu dir gefaßt, die bis heute durch nichts verdrängt, durch nichts erreicht, die nichts ähnlich ist als nur sich selber. Wenn das die Liebe ist, dann ist sie’s eben. Und ich bin froh darum. Wei1 ich mich mit dir nicht fürchten muß.“
Weiß der Franz denn, von was er spricht, wenn er von der Liebe spricht? Weiß er von seiner Liebe? Weiß er von meiner Liebe? Wenn wir Körper an Körper sind, dann weiß er es. Dann weiß ich es. Nicht alles, was man weiß, muß gesagt werden. Dann ist die Liebe eben nicht ausdrückbar. Unsere Liebe. Ausdrückbar. Welch häßlich’ Wort: Aber der Taumel, wenn wir einander erwärmen, diese kichernde, unvorstellbare Freude... ist das alles Liebe?
Da ist unser eigenwilliger Joseph Moritz mit seinem verdrehten und sich immer mehr verdrehenden Innenleben. Er weiß sehr wohl, was die Liebe ist. Und der Herzog weiß es auch. Joseph Moritz ist schwul. Die Zeit damals hatte vielleicht kein so hässliches Wort für diese Form der Sexualität. Dennoch, seine Ausrichtung war ja wohl eindeutig.
Als Josef Moritz diese Zeilen schreibt, ist „der Bub“ 16 Jahre alt, Joseph Moritz 26. Joseph Moritz macht alles, was er für sich unter dem Begriff Liebe subsummiert am Herzog fest. Macht er damit den Herzog zum Schwulen? Macht er ihn? Dichtet er ihn? Formt er ihn sich zurecht? Wirklich oder in seiner schriftlich niedergelegten Phantasie? Deckt er alle Wallungen der Zuneigung, die vom Herzog auf ihn zuströmen, sofort mit seinem ganzen Körper zu? Okkupiert Joseph Moritz den Herzog, indem er die Grenzen dicht macht? Indem er in Sachen Liebe das Gesichtsfeld des Herzogs klein hält? Einschränkt, bis der Herzog nur noch ihn sieht, Joseph Moritz? Nur noch ihn liebt, Joseph Moritz?
Sicher ist, dass der Herzog nicht mit allzu viel Liebenswertem umgeben war. Dass Liebenswertes von ihm sogar ferngehalten wurde, zumal er ja einerseits noch sehr jung war, andrerseits auch sicherlich nicht - hierarchisch gesehen - der Mensch war, der einfach so am Aristokraten-Heiratsmarkt angeboten werden konnte. Da musste überhaupt viel Ratlosigkeit geherrscht haben, wenn sich einer gedanklich der Frage nähern wollte, wer denn dem Herzog eigentlich ebenbürtig wäre. So war man vielleicht sogar recht froh, dass der Herzog so gar kein Verlangen äußerte und kundtat; wohl, weil er von dem, was ihm Joseph Moritz zu bieten imstande war, voll befriedigt war. So gesehen bekommt Joseph Moritz sogar fast eine historische Dimension. Er hat die damalige Welt vor einigen Problemen bewahrt, die sicher gekommen wären, hätte der Herzog überhaupt zu leben begonnen. Aber das Schicksal hat das ja verhindert und den Herzog – wie viele sagten und sagen - rechtzeitig sterben lassen.
Aber noch leben wir ja. Die Antworten auf all diese Fragen finden wir hier und jetzt sicher nicht, wie diese Fragen restlos wohl nie beantwortet sein dürften. Müssen wir doch auch noch immer befürchten, dass das ganze Tagebuch des Joseph Moritz Dietrichstein im Goethe’schen Sinn Dichtung und Wahrheit ist. Gedichtete Wahrheit. Wahr daran ist mit Sicherheit der Joseph Moritz. Wahr in allen Phasen und Eigenschaften, die er von sich selber schreibt. Es kann aber durchaus sein, dass Joseph Moritz sich in diesem Tagebuch den Traum erfüllte, indem er seine Wahrheit in dichterische Form goss. Oder aber alles gänzlich dichtete. Erdichtete. Erdachte. Sich ausdachte. Erträumte. Aber sich selber sicher nicht. Er war. Er war so. Aber alles andere?
Vielleicht hat er so lang geträumt, bis er dann nach innen zusammengekracht ist. Implodiert. Zu großer Druck von außen und zu kleiner Gegendruck von innen. Implodiert. Eingegangen.
Heute sieht das, was ich da Tag um Tag oder Woche um Woche oder Wiedersehen um Wiedersehen beobachtet hatte, in zusammengeraffter Sicht viel aufregender aus.
Auf der Bastei, oder bei einem der Ausritte in den Prater, wo die Pferde stehen gelassen wurden und man sich spazierend erging - immer gab es eine Veränderung am Franz. Er wuchs stetig. War er bei unserem ersten Zusammentreffen noch ein kleiner, gerade eben mündig gewordener Bub gewesen, so wuchs er dann sehr schnell zum Knaben. Erst bekam er furchtbar lange Beine, dann verlängerte sich auch sein schmaler Oberkörper. Heute ist er so groß wie ich, und es sieht ganz so aus, als würde er noch weiterwachsen. Mit großer Anteilnahme beobachte ich das unmerkliche Männlich Werden seiner Stimme; da war und ist kein Stimmbruch wie sonst, nein, die Stimme wurde einfach tiefer, härter, zuerst rauer, dann aber fester. Ein weiter Weg war das, denn der Bub Franz hatte einen sehr hellen Knaben-Sopran, wie mein Vater es ausdrückte; nur leider nicht sehr musikalisch. Mein Vater sprach sogar von „grauslicher Unmusikalität“.
Den Flaum auf seiner Oberlippe bemerkte ich erst, als er schon recht vorhanden war. Zuerst hatte man ihn nicht gesehen, weil er blond war wie sein lockiges Haupthaar. Als ich aber dann den Flaum bemerkt hatte, gedachte ich mit Erregung der Stellen an Franzens Körper, die sich jetzt auch mit Haaren zu schmücken begannen.
Im Sommer, bei vorne offenem Hemd, sah ich, dass seine Brust, so weit mein Auge eben reichte, unbehaart war. Heute weiß ich es ja. Aber damals, da hat mich jeder Millimeter, den ich weiter blicken durfte, Säfte gekostet.
Und dann, bei einem Ausritt, in der Nähe des Lusthauses im Prater, da sprangen wir von unseren Pferden und der Franz machte eine kleine, aber seltsame Verrenkung. Die rührte daher, dass er eine Knaben-Erektion hatte, die sich unter und auf der Hose überdeutlich und wahrhaft riesengroß abzeichnete. Franz versuchte dies zu verbergen, bemerkte aber meinen scheuen Blick, gab das Verbergen auf, hielt sich die Hände bedeckend über die ganze Länge und lächelte achselzuckend: „Das Gebeutel auf dem Pferd, was soll ich machen?“
Es war eigenartig. Ich schämte mich auch nicht. Wir blickten an uns selbst hinunter, dann dem anderen dorthin - lächelten - und waren eins. Alles war so einfach. Einfach in Ordnung.
So viele Wimmerln - wir nannten sie so - verunzierten damals sein Antlitz, vor allem seine Stirne. Es war die Zeit, in der sein Gesicht das Knabenhafte verlor und sich in den Ernst der Männlichkeit kantete und härtete. Viel Liebliches und Liebes ging da jetzt verloren, zumal, wenn der Franz damals ernst dreinschaute, war eine unergründliche und undurchschaubare Nachdenklichkeit in seinen Zügen, in seinen Augen, um seinen Mund herum, der ebenfalls eine Nuance schmaler zu werden begann. Er blickte, wenn er ernst schaute, immer in die Ferne oder an einem vorbei. Nur ganz selten einem direkt in die Augen. Wenn er ernst blickte. Wenn er aber lächelte oder lachte, dann war’s, als zündete da jemand ganz schnell ein wärmendes Licht an, so viel konnte er strahlen. Aber damals lachte er nicht so viel wie früher. Die vormalige Fröhlichkeit war jetzt einem leichten Sarkasmus, einer Neigung zu spöttischen Bemerkungen gewichen. Er sprach damals auch immer sehr schnell und kurz und etwas abgehackt. Und das Lächeln kam oft nicht von einer inneren Bewegung, sondern war nur äußerlicher Begleiter seines manchmal recht unfeinen Spottes. Warum habe ich das damals, als es war, nicht geschrieben? Habe ich es damals nicht bemerkt? War es damals zu unwichtig, um geschrieben zu werden? Warum ist es dann heute so wichtig, dass ich es schreibe? Schreibe ich mir den Franz von damals ein zweites Mal? Ich habe das von damals nicht gelesen.
Aber wir, Joseph Moritz, wir haben es gelesen, das von damals. Du hast das, was du heute da beschreibst, damals wirklich nicht beschrieben. Du schreibst also den Herzog heute nicht ein zweites Mal, sondern das, was du da schreibst, ist wirklich das erste Mal. Wir werden übrigens dieser Erscheinung noch einige male begegnen, dass Joseph Moritz Monate oder Jahre später Ereignisse zusammenfasst, die er damals, zum Zeitpunkt ihres Stattfindens nicht einmal erwähnend gestreift hat.
Soll ich heute nachmittag zum Franz gehen? Hat er nicht gesagt, er würde mir eine Nachricht schicken? Wie kann ich das nur vergessen: Ich gehe nicht hin. Mit einer Unachtsamkeit entdeckte glatt noch jemand den Weg. „Den üblichen Weg“, wie Franz ihn nennt. Und der ***, der wird auch entdeckt!
Noch müssen wir fragen: Ist dieser *** gleichbedeutend mit dem Diener Jakob? Dem sind wir ja schon einmal begegnet. Zu dem jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. In einigen Passagen, die wir hier noch nicht zitiert haben, kommen aber deutliche Hinweise vor, die den Schluss zumindest bisher - zulassen, dass es sich hier um den besagten Jakob handelt.
Franzens „liebster und bester“ hat uns recht kühlen Kaffee gereicht.
„Ich hab’ so lang warten müssen, bis der Hofmeister anderweitig war“, hat er uns erklärt.
Franz hat ihn recht lieb angeschaut und gesagt: „Ist schon gut. Ich darf ja eh noch keinen Kaffee trinken. Und wenn er unserem Gast zu kühl ist, dann werden wir ihn halt anderweitig erwärmen.“
„Den Gast oder den Kaffee?“, fragte ich dümmlich.
„Dann schon lieber den Gast“, lachte der Franz.
Im Hinausgehen hörte ich auch den „liebsten und besten“ lachen.
Als ich aber hinblickte, war er schon draußen.
„Unser“ Gast hat der Franz gesagt, und „wir“ werden ihn anderweitig aufwärmen. Das war kein Pluralis Majestatis. Das war ein geheimes Einverständnis.
Fast mag es meinem Herzen ein Brennen verursachen, daß da einer ist, der immer um den Franz sein darf. Und der auch versteht, daß der Franz und ich uns treffen. Und der auch weiß, warum wir uns treffen. Warum versteht er es? Hat der Franz es ihm gesagt? Weiß er? Ahnt er? Oder ist er dem Franz gar so nahe wie ich? Viel Unruhe verschafft er mir ja, der hübsche Bursche in seiner reichlich engen Livree. Jetzt gebrauche ich schon des Franzens Wort „hübsch“ wie er.
Das Zitat 'liebster und bester' nimmt Joseph Moritz von der Geburtstagsfeier, bei der er sich von einem der Diener Kaffee nachschenken ließ und den ihm dann der junge Herzog, damals noch 'Hoheit', als Jakob, seinen 'liebsten und besten' vorstellte.
Alle weiteren Hinweise ergänzen und vervollständigen nur: Es ist ein Diener, er trägt Livree. Er ist der Vertraute, der den 'üblichen Weg' zu ebnen und zu bewerkstelligen imstande ist. Wir nehmen also mit Fug und Recht an, es ist der Jakob.