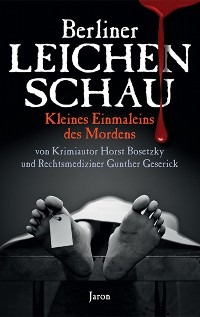Kitabı oku: «Berliner Leichenschau», sayfa 4
Als Rechtsmediziner wusste Schwarz: Der Kopf war unbedingt zu schützen! Wenn er die Radfahrer ohne Helm durchs Gelände rasen sah oder mitansehen musste, wie sie in der Stadt zwischen Autokolonnen und über rote Ampelkreuzungen manövrierten, konnte er nur den Kopf schütteln. Er kannte sogar Fachkollegen, die einen Schutzhelm beim Radfahren leichtsinnig ablehnten. »Wie das aussieht! Und außerdem schwitzt man darunter!«, argumentierten sie. Dabei wusste doch heute jedes Kind, wie verletzlich das menschliche Gehirn war. Ein einfacher Sturz mit dem Rad reichte für schwere, mitunter tödliche Hirnverletzungen. Das galt auch für den Sturz von Fußgängern etwa bei Glatteis. Bei Gewalttaten, die mit bleibenden oder tödlichen Hirnschäden endeten, reichte das Spektrum von Raubüberfällen mit Umstoßen von alten Damen bis zu Attacken mit Baseballschlägern oder den ungeheuerlichen Tritten auf den Kopf eines am Boden liegenden Opfers. Vor allem die letztgenannten Taten hatte er in den siebziger und achtziger Jahren noch nicht gesehen.
Schwarz war sich mit vielen Fachkollegen einig, dass die Schwelle zur Anwendung brutalster Gewalt in den letzten Jahren deutlich gesunken war. Ebenso beobachtete er mit Sorge, dass die Gewalttaten häufig grundlos oder aus nichtigem Anlass entstanden. Und das gezielte Treten oder Springen auf den Kopf eines wehrlosen Opfers, dazu noch mit harten und schweren Stiefeln, war eine ganz neue Art der Gewalt. Mit anderen Rechtsmedizinern hatte Schwarz seit Jahren in Wort und Schrift diese Entwicklung angeprangert. Inzwischen war die Erkenntnis auch bei den tolerantesten Gutmenschen in der Justiz und Politik angekommen.
Als Schwarz mit dem Wagen in seine Grundstücksauffahrt einbog, musste er schmunzeln. Er würde bei der nächsten Radtour wie jedes Mal den Schutzhelm tragen, und seine Enkeltochter würde wie immer ausrufen: »Opa, wie siehst du denn aus!«
Hang down your head,
Tom Dooley
Die HWD galt bei Firmen und Behörden als gute Adresse, und die Medien hatten bislang auch nur Erfreuliches von ihr zu berichten gewusst. Alle dachten, der Firmenname würde sich von den Initialen des Eigentümers Hans-Werner Damretzky herleiten, doch im Handelsregister war HWD, Hazardous Waste Disposal vermerkt – auf Deutsch Sondermüllentsorgung. Damretzky, geborener Berliner, hatte einige Jahre in den USA am Massachusetts Institute of Technology studiert und war dort auf die Idee einer Firmengründung gekommen. Er war ein Macher, liebte »Top-down-Entscheidungen« und legte keinen großen Wert auf langes Palaver mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Organisationsklima war trotzdem gut, man lobte seine soziale Einstellung und dass er immer um das Wohl seiner Mitarbeiter besorgt sei. Wenn etwas zu besprechen war, ließ er seine Angestellten zu sich ins Büro kommen, und zwar möglichst einzeln.
Nun war es kurz vor Feierabend, und er hatte noch einen Termin mit Simon Mächtig, seinem Diplom-Ingenieur für das Altlampen-Recycling. Und schon wurde der von Damretzkys Sekretärin gemeldet. Das Thema ihres Gesprächs beschäftigte Simon Mächtig und seinen Chef bereits eine ganze Weile.
»Hat endlich irgendjemand eine Idee gehabt, wie wir das Quecksilber aus den Energiesparlampen so recyceln können, dass es sich rechnet?«, wollte Damretzky wissen.
»Nein, leider noch nicht«, musste Mächtig zugeben.
Damretzky wurde energisch. »Dann soll Tom Dooley endlich eine Deponie ausfindig machen, die preiswerter ist als die, die wir jetzt haben!«
Mächtig winkte ab. »Der ist doch mit seinen Nerven längst am Ende.«
Eigentlich hieß der Mann, der für die Verbringung des eingesammelten Sondermülls auf Deponien in halb Europa zuständig war, nicht Tom Dooley, sondern Thomas Duhler, aber das wussten einige der HWD-Leute gar nicht.
»Depressiv ist er doch nur geworden, weil Sie ihm die Doreen Reger weggeschnappt haben«, sagte Damretzky.
»Schön wär’s!«, rief Mächtig, der nicht nur so hieß, sondern wirklich die Figur eines Diskuswerfers hatte. »Noch ist es mir nicht ganz gelungen, aber ich bin guter Hoffnung.«
»Na, besser Sie als die Doreen!«, erwiderte Damretzky lachend.
Sie besprachen noch einiges Dienstliche, dann verabschiedete sich Mächtig. Damretzky wartete noch, bis ihm seine Sekretärin die letzten Briefe zur Unterschrift vorgelegt hatte, dann machte er sich auf den Heimweg. Das Bürogebäude stand in der Breite Straße in Pankow, und bis zu seiner Villa in Woltersdorf waren es über 43 Kilometer, was ohne Stau eine halbe Stunde Fahrzeit bedeutete. Auf dem Zubringer zum Berliner Ring hatte er es fast bis zur Auffahrt Buch geschafft, als ihm einfiel, dass er das von Mächtig reparierte Fahrrad seines Sohns vergessen hatte. Das stand jetzt im Heizungskeller unter dem Bürotrakt. Also wendete Damretzky und raste zurück nach Pankow.
Alle hatten schon Feierabend gemacht. Er fluchte vor sich hin, weil er, um in den Keller zu gelangen, unzählige Schlüssel brauchte und die nicht sofort finden konnte. Endlich war er am Ziel. Die Tür zum Heizungskeller war nicht abgeschlossen, und das Licht brannte auch noch. Er ärgerte sich über die Schusseligkeit seiner Leute. Doch was er dann sah, ließ ihn erstarren.
Thomas Duhler stand auf einem Hocker und hatte sich um den Hals einen Strick gelegt, den er gerade über eines der dicken Heizungsrohre zu werfen suchte.
»Sind Sie verrückt geworden, Duhler? Runter da!« Damretzky half dem schmächtigen Duhler vom Hocker herunter und sprach beruhigend auf ihn ein. »Es wird alles wieder gut, Tom.«
»Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.«
»Doch, Sie müssen sich nur helfen lassen! Ich bringe Sie in eine psychiatrische Klinik.«
Ein gutes halbes Jahr nach dieser Szene, die, als sie bekannt geworden war, Damretzky viel Sympathie eingetragen hatte, war der Arbeiter Rico Strenkel mit einem Lastwagen der Firma HWD auf dem Weg nach Marzahn, wo man in der Nähe der S-Bahn nach Ahrensfelde eine Halle zur Zwischenlagerung allen möglichen Sondermülls angemietet hatte. Diesmal waren es die Abfälle verschiedener Nordberliner Krankenhäuser. Neben Strenkel hockte der Student Tinko Callenberg, der sich Semester für Semester einiges dazuverdienen musste, um über die Runden zu kommen.
»Tinko – wat is’n dit eijentlich für’n komischer Name?«, fragte Strenkel, als sie hinter dem S-Bahnhof Gehrenseestraße in die Bitterfelder Straße abbogen.
»Tinko ist der Titel eines Buches von Erwin Strittmatter, und einen Film hat’s auch gegeben. Das war so Mitte der fünfziger Jahre. Meine Mutter ist derart auf den Tinko abgefahren, dass sie mich auch so genannt hat.«
»Strittmatter?« Der Fahrer sah ihn an. »Nie jehört.«
»Er hat die Romantrilogie Der Laden geschrieben.«
»Ick kenne nur Bin Laden.«
»Pst!«, machte Tinko Callenberg und tat erschrocken.
Strenkel grinste. »Ick mach mir eha bei Pst! verdächtig.«
»Wieso’n das?«
»Na, weil det ’n janz bekannter Puff inne Brandenburgischen Straße is, und wenn meine Alte det hört, dann is Polen offen.«
Tinko Callenberg, der Ethnologie, Kultur- und Kommunikationswissenschaften studierte, ging nun der Frage nach dem Ursprung dieser Redewendung nach. Er ärgerte sich, dass er auf keine schlüssige Antwort kam, und schickte eine SMS an seinen Tutor.
Wenig später kam die Antwort: »Dann ist Polen offen« stammt vermutlich aus der Zeit, als der polnische Adel untereinander heillos zerstritten war und keine effektive Zentralmacht zuließ. Damals war Polen offen für das Eingreifen fremder Mächte.
Tinko Callenberg freute sich, wieder eine Bildungslücke geschlossen zu haben.
Strenkel, der öfter Touren nach Polen unternahm, fing an zu singen: »Jeszcze Polska nie zgine˛ła!«
»Wie?«
»Noch ist Polen nicht verloren.«
Damit waren sie an der Wolfener Straße angekommen, in die sie links abbiegen mussten. Wenig später hielten sie vor der Lagerhalle der HWD in dieser gottverlassenen Gegend.
Sie öffneten die Plane ihres Wagens und machten sich, bevor sie das Hallentor aufschlossen, erst einmal daran, den Container von der Ladefläche zu heben. Sie hatten ihn aus dem Keller eines Krankenhauses abgeholt.
»Wenn ich mir vorstelle, was da alles so drin ist …« Tinko Callenberg schüttelte sich. »Blut, Eiter, rausgeschnittene Gallenblasen und Lungenflügel, amputierte Arme und Beine …«
»Man müsste ’n Kannibale sein«, meinte Strenkel. »Mann, wär det ’n Festessen!«
»Hör auf!«, rief Tinko Callenberg. »Ab heute bin ich Vegetarier!«
Als alle Abfallcontainer auf der Straße standen, schloss Strenkel das Hallentor auf und schob die beiden gewaltigen Schiebetüren zur Seite. Schnell hatte er den Lichtschalter gefunden, und sie konnten die Container in die Halle rollen. Hier stank es so gewaltig, dass Tinko Callenberg sein T-Shirt hochriss, um sich den Stoff vor die Nase zu halten.
Sie arbeiteten so konzentriert, dass es mehrere Minuten dauerte, bis Strenkel den Toten in der hintersten Ecke der Halle entdeckt hatte. Der baumelte an einem Strick, der über einem der Dachbinder hing.
»Mensch, det is ja Tom Dooley!«, schrie Strenkel.
Gunnar Granow hatte wieder einmal mächtigen Zoff mit seiner Tochter Sarah, die partout nicht einsehen wollte, warum sie schon um halb zehn ins Bett gehen sollte.
»Wenn du nicht zeitig schlafen gehst, kommst du morgen früh wieder nicht hoch.«
»Das ist doch meine Sache!«, rief die Fünfzehnjährige. »Ich weiß doch selber, wie viel Schlaf ich brauche.«
»Nein, das weißt du eben nicht. Sonst würde ich nicht andauernd von deiner Klassenlehrerin zu hören bekommen, dass du Aufmerksamkeitsdefizite hast und neulich in Deutsch sogar eingeschlafen bist.«
»Das lag an diesem dämlichen Schimmelreiter von Storm.«
Jetzt kam Granows Frau Verena aus ihrem Arbeitszimmer, in dem sie noch gesessen und Diktate korrigiert hatte, und blaffte: »Meint ihr, dass ich mich bei diesem Lärm konzentrieren kann?«
Granow nickte. »Ja, das meine ich. Du bist doch Meisterin im Multitasking. Du korrigierst deine Hefte, gießt deine Blumen, hörst Nachrichten, verfolgst unser Streitgespräch …«
»Willst du mich auf die Schippe nehmen?«
»Mama, in der Schule hätte ich dafür ein Ugs. gekriegt!«, rief Sarah. Die Abkürzung für ›umgangssprachlich‹ stand des Öfteren am Rande ihrer Aufsätze und gab Punktabzüge.
Verena verlor nun völlig die Contenance und kehrte mit einem unüberhörbaren »Ihr könnt mich mal!« an ihren Schreibtisch zurück.
Granow wollte darauf eine Bemerkung machen, die wegen ihres obszönen Inhaltes mindestens drei Ugs. verdient hätte, unterdrückte sie aber, um die sittliche Reife seiner Tochter nicht weiter zu gefährden. Trotzdem drohte sich alles weiter aufzuschaukeln, da erreichte ihn ein Anruf seines Kollegen vom Dienst.
»Wir haben einen wohl etwas suspekten Selbstmordfall in Marzahn. Wolfener Straße, in der Lagerhalle der HWD. Da hat sich einer aufgehängt. Fahr bitte mal hin und sieh dir die Sache an!«
Granow stöhnte vernehmlich. »Das sind von Kladow fast vierzig Kilometer, und dafür brauche ich ’ne Dreiviertelstunde. Kann Theresa das nicht alleine machen? Die wohnt doch gleich um die Ecke.«
»Du, das ist die Sondermüllentsorgung, eine heikle Branche. Da wollen wir uns nachher nichts vorwerfen lassen.«
»Gut, ich mache mich auf den Weg.«
Granow sagte seiner Frau Bescheid, holte seinen Wagen aus der Garage und fuhr los. Es ging durch ganz Berlin hindurch, über den Potsdamer Platz hinweg und hinter dem Alex die Greifswalder Straße hinauf nach Weißensee. Vom Gefühl her war er schon längst nicht mehr in Berlin. Eine gefühlte Ewigkeit war vergangen, als er über die Märkische Allee endlich die Trusetaler Straße erreicht hatte. Theresa Marotzke stand schon am Straßenrand. Granow kurbelte die Fensterscheibe hinunter.
»Was kostet’s heute?«
»Bei mir haste nur als Transsexueller ’ne Chance.«
Granow lachte. »Wenn Verena weiterhin so grantig zu mir ist, sehe ich das als echte Alternative an.«
»Gut, wenn du alle Operationen hinter dir hast, sprechen wir uns wieder.« Theresa Marotzke stieg zu ihm in den Wagen.
Granow spielte an seinem Navi herum. »Wolfener Straße … Hat also Mutter Wolffen auch ihre Straße bekommen.«
»Ick kenne nur det Wolfen, wo meine Frau herkommt«, erklärte Theresa Marotzke. »Aber wer is Mutta Wolfen?«
»Mutter Wolffen – mit zwei F – ist eine resolute Wäscherin bei Gerhart Hauptmann.«
»Muss man det wissen?«, fragte Theresa Marotzke. »Na jut … Weeßte schon wat über den, der sich da uffjehängt hat?«
Granow verneinte und las vom Display seines Navis ab, dass sie nur zwei Kilometer bis zur Halle der HWS zu fahren hatten. »Zur Wuhletalstraße, dann über die S-Bahn rüber, und schon sind wir da.«
Wer sie an Ort und Stelle begrüßte, war Charly Packebusch, 28 Jahre alt, umtriebiger Polizeireporter, zwanghaft locker und unersättlicher Frauenheld.
»Wer ist denn der Arme?«, fragte Theresa Marotzke.
Charly Packebuschs Antwort bestand darin, dass er die ersten Zeilen eines Songs zum Besten gab, den 1958 das Kingston Trio zum Welthit gemacht hatte:
Hang down your head, Tom Dooley
Hang down your head and cry
Hang down your head, Tom Dooley
Poor boy, you’re bound to die.
Granow verstand den Zusammenhang nicht. »Wie kommst du denn darauf?«
»Weil der, der sich erhängt hat, Thomas Duhler heißt, ihn in der HWD, der Sondermüllentsorgung, aber alle Tom Dooley genannt haben.«
Prof. Dr. Schwarz, der Rechtsmediziner, war auch schon an der HWD-Lagerhalle angekommen und trat zu den Kommissaren.
Granow begrüßte den Professor herzlich und fragte: »Hast du schon was herausgefunden?«
»Nein, aber es sieht wirklich ganz nach einem Selbstmord aus, denn es ist ein Abschiedsbrief vorhanden.«
***
Schwarz hatte aus dem Kofferraum seines Wagens eine Decke geholt, die er neben der Leiche ausbreitete. Der tote Thomas Duhler lag nämlich auf dem ziemlich verdreckten Fußboden der Halle. Die Zeugen Callenberg und Strenkel hatten als Erstes den Notarzt gerufen. Nachdem der eingetroffen war, hatten sie gemeinsam den Hängenden abgeschnitten und auf den Boden gelegt. Nach der Feststellung des Todes hatte der Notarzt die Polizei verständigt.
Prof. Schwarz kniete sich neben den Leichnam, um ihn untersuchen zu können. Er meinte zu Granow und Marotzke: »Ich hätte den Toten lieber in der Originalsituation gesehen. Lage des Stricks über dem Balken, Höhe der Füße über dem Boden, Position des danebenstehenden Hockers, Zustand der Kleidung – na, ihr wisst schon. Aber Lebensrettung geht nun mal vor Spurensicherung. Insofern konnte der Notarzt gar nicht anders handeln.«
Zuerst prüfte Schwarz die Zeichen des Todes. Die Totenstarre war erst leicht ausgeprägt, an den abhängigen Partien des Liegenden bildeten sich zarte Totenflecke, und in den Achselhöhlen fühlte er noch eine deutliche Körperwärme. Zu den Kriminalpolizisten gewandt, sagte Schwarz: »Der Mann ist noch nicht lange tot. Ich vermute, der Tod ist heute früh eingetreten. An den Füßen sind keine Totenflecke sichtbar, die waren offenbar noch nicht ausgeprägt oder haben sich nach dem Niederlegen der Leiche umgelagert. Also hat er nicht lange gehangen. Und die Körpertemperatur passt auch dazu.«
Dann inspizierte der Rechtsmediziner alle Körperregionen, besonders gründlich Kopf und Hals. Als er die Leiche umwendete, stutzte er. »Das gefällt mir gar nicht«, murmelte Schwarz. Und die beiden Kriminalisten beugten sich zu ihm. »Seht mal, da sind Teile seines schulterlangen Kopfhaars in den Strang eingebunden. Da läuten bei mir die Alarmglocken. Ich werde die Leichenschau hier also doch gründlicher durchführen als geplant. Unter Umständen muss sich die Spurensicherung den Fundort ansehen.«
Ehe er mit der Untersuchung fortfuhr, steckte er beide Hände des Toten zur Sicherung von Spuren in Spezialtüten. An der Lage des Strangwerkzeugs konnte Schwarz nichts Auffälliges entdecken. Der Aufhängepunkt war im Nacken. Eine angedeutete zweite Strangmarke konnte durch Verrutschen des Strangs beim Erhängungsvorgang erklärt werden. Anders verhielt es sich mit den zahlreichen punktförmigen Blutungen, die Schwarz in der Gesichtshaut, vor allem in den Augenlidern und -bindehäuten sowie der Lippen- und Mundschleimhaut entdeckte. Er richtete sich auf, wobei er leicht das Gesicht verzog, als er den Rücken streckte.
»Das kenne ich«, meinte Granow. »In unserem Alter haben doch fast alle mit dem Rücken zu tun.«
Und Theresa Marotzke fügte augenzwinkernd hinzu: »Professor, Sie sollten besser mal zur Rückenschule gehen und mit hübschen Mädchen rhythmische Gymnastik machen, als sich immer nur über Leichen zu beugen.«
»Das ist keine schlechte Idee«, erwiderte Schwarz. »Tatsächlich ist die stundenlange unphysiologische Haltung am Sektionstisch Gift für die Wirbelsäule. Dazu kommt noch die Arbeit am Mikroskop und am Rechner. Aber wie soll ich die umgehen? Opfer müssen gebracht werden. Und was soll ich in der Rückenschule? Die hübschesten Mädchen gibt’s doch bei der Berliner Kripo!«
Theresa Marotzke bedachte ihren Kollegen mit einem verschmitzten Blick, als wolle sie sagen: Wenigstens einer, der das bemerkt!
»Aber zurück zu unserem Toten«, sagte Schwarz. »Hier stimmt etwas nicht, denn nach meiner Erfahrung binden Selbstmörder ihr Kopfhaar nicht in den Strick ein – egal, ob Mann oder Frau. Und die Stauungsblutungen im Gesicht passen auch nicht zum Erhängen, schon gar nicht in freier Suspension. Allerdings kann ich keine Kampf- oder Abwehrspuren an dem Toten finden. Und außerdem ist da noch der Abschiedsbrief. Ich habe einen ähnlichen Fall vor Jahren schon einmal gehabt – es ist Vorsicht geboten! Wir müssen eine Sofortobduktion machen, und die Kriminaltechnik soll den Fundort wie auch den Abschiedsbrief gründlich unter die Lupe nehmen.« Zum Abschluss machte Schwarz noch einige Fotos von der Leiche und skizzierte die wichtigsten Befunde in seinem Notizbuch.
Granow und Marotzke verabredeten sich mit Prof. Schwarz für dreizehn Uhr im Rechtsmedizinischen Institut an der Charité. Granow versprach, in der Zwischenzeit den Staatsanwalt zu informieren. Schwarz fuhr indes sofort Richtung Mitte in sein Institut.
»Hallo, Frau Meißner, da bin ich wieder!«, begrüßte der Rechtsmediziner seine Sekretärin. »Wir müssen um ein Uhr sezieren. Seien Sie doch so nett und kochen mir einen Kaffee und schmieren mir ein Brötchen! Ich kann mich dann vorher noch etwas stärken und dabei meine Mails durchsehen.« Aus seinem Büro informierte er die Rechtsmedizinerin Frau Dr. Schöneberg und den Sektionsassistenten über die geplante Obduktion.
Schwarz hatte kaum den letzten Bissen hinuntergeschluckt, da klopfte es. Staatsanwalt Rühl stand in der Tür und nickte freundlich. »Professor Schwarz, ich wollte mich vor Beginn der Sektion noch schlau machen, worum es eigentlich geht.«
»Herr Staatsanwalt, es geht um einen Erhängten mit Abschiedsbrief, bisher ohne Kampf- oder Abwehrspuren, aber einige Befunde lassen mich am Suizid zweifeln. Die Details zeige ich Ihnen im Saal. Ich warte nur noch auf den Toten«, erwiderte der Professor.
»Der ist gleichzeitig mit mir auf ihr Gelände gefahren«, meinte Staatsanwalt Rühl, und Schwarz musste grinsen.
Als der Rechtsmediziner mit dem Staatsanwalt in den Sektionssaal trat, lag der Leichnam schon auf dem Tisch. Granow und Marotzke von der Mordkommission sprachen mit dem Sektionsassistenten, und Frau Dr. Schöneberg zog gerade ihre Hygienekleidung über.
Auch Prof. Schwarz kleidete sich vorschriftsmäßig ein, um dann unverzüglich mit dem Diktat des Sektionsprotokolls zu beginnen: »Teil A: Äußere Besichtigung.« Zwischendurch wurden mehrfach fotografische Aufnahmen gemacht, wobei Schwarz auf manches Detail hinwies. Kopf und Hals mit dem Strang wurden aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert. Dann wurde der Strang abgenommen, vermessen und nach Anfertigung von Klebebandabdrücken einzeln aufbewahrt. Ebenso wurden Abdrücke von den Handinnenflächen des Opfers angefertigt. Die freigelegte Strangmarke am Hals wurde intensiv mit dem Operationsmikroskop betrachtet, gründlich beschrieben, vermessen und mit angelegtem Maßstab fotografiert.
Nach Beendigung der äußeren Leichenschau wurde die »Innere Besichtigung« begonnen. Schwarz diktierte die inneren Befunde für das Sektionsprotokoll, den Teil B, während die Ärztin die Sektionsschnitte ausführte. Schwarz regte an, beide Arme in voller Länge zu präparieren. Die freigelegten Weichteile waren ebenso unversehrt und frei von Unterblutungen wie die Hautoberfläche.
Zum Abschluss der Leichenöffnung diktierte Prof. Schwarz das »Vorläufige Gutachten« des Sektionsprotokolls von Thomas Duhler:
I. Sektionsergebnis Leichnam eines bekannten, 39 Jahre alten, 178 cm großen und 81 kg schweren Mannes. Näher beschriebenes Seil am Hals des Leichnams, im Nacken verknotet. Symmetrisch angeordnete Strangmarke der Halshaut, an der Vorderseite tief eingesunken und vertrocknet, nach hinten deutlich ansteigend. Darunter eine zweite angedeutete Strangmarke mit mehr horizontalem Verlauf. Mehrfache Brüche von Zungenbein und Schildknorpel mit Zertrümmerung beider Schildknorpelplatten, sämtlich massiv unterblutet. Kräftige Unterblutungen von Halsmuskulatur und Schilddrüse. Starke livide Verfärbung und Dunsung der Gesichtshaut mit zahlreichen punktförmigen Blutungen, besonders ausgeprägt in den Augenlidern und -bindehäuten sowie in der Lippen- und Mundschleimhaut. Unterblutete Zahnkontur-Abdrücke der Unterlippe über den Frontzähnen. Leichte Überblähung der Lungen. Schaumige, blutige Flüssigkeit in der Luftröhre und ihren Ästen. Älteres Magengeschwür vor dem Magenausgang. Leichte Leberverfettung. Mehrere bis erbsgroße Gallensteine in der Gallenblase.
Geringe allgemeine Arteriosklerose.
II. Todesursache: Halskompression
III. Die quantitative chemische Alkoholbestimmung nach zwei Methoden ergab im Schenkelblut mit 1,4 mg/g Ethanol und im Urin mit 1,7 mg/g eine deutliche alkoholische Beeinflussung zum Zeitpunkt des Todeseintritts.
IV. Als Todesursache ist eine schwere Halskompression festzustellen. Es fanden sich keine wesentlichen vorbestehenden krankhaften Veränderungen, die unmittelbar mit dem Todeseintritt in Zusammenhang stehen könnten. Die inneren Halsverletzungen und die massive Blutstauung im Kopfbereich sind nicht durch ein typisches Erhängen zu erklären. Vielmehr muss der Erhängung eine massive Halskompression vorausgegangen sein. Diese könnte sowohl durch Würgen als auch durch Drosseln erfolgt sein. Die beschriebene zweite (mehr horizontale) Strangmarke kann Folge eines vorausgegangenen Drosselns sein. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Würgen. Da keine charakteristischen Würgemale vorliegen, kann das Würgen mit Handschuhen, mit einer Halsbedeckung oder mit dem Unterarm (»Schwitzkasten«) erfolgt sein.
V. Die Sektionsbefunde sprechen für eine Tötung von fremder Hand.
VI. Die Klebebandabdrücke von den Händen des Leichnams werden mikroskopisch auf Faserspuren des Stranges untersucht.
VII. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung von Körperflüssigkeiten, Mageninhalt und Organmaterial wird nachgereicht.
VIII. Die Obduzenten behalten sich ein endgültiges Gutachten ausdrücklich vor.
IX. Prof. Dr. med. Robert Schwarz, Dr. med. Lisa Schöneberg
Noch im Sektionssaal wandte sich Schwarz an den Staatsanwalt und die Kriminalpolizisten. »Es kann jetzt keine Zweifel mehr geben, Duhler hat sich nicht erhängt. Die schweren inneren Halsverletzungen, vor allem des Kehlkopfgerüsts, sind nicht durch einen Erhängungsvorgang zu erklären, sondern durch eine Halskompression von fremder Hand entstanden. Allerdings haben wir keine Kampf- oder Abwehrverletzungen gefunden. Entweder erfolgte der Angriff überraschend, oder das Opfer war aufgrund der Alkoholisierung in seiner Abwehrfähigkeit eingeschränkt. Zu dieser Frage müssen wir noch die toxikologischen Resultate abwarten. Die starken Stauungserscheinungen im Kopfbereich weisen darauf hin, dass der Mann bis zum Tode gewürgt oder gedrosselt und dann als Leiche aufgehängt wurde. Bei einem vitalen Erhängungsvorgang hätten wir außerdem Dehnungsblutungen in den Bandscheiben der Lendenwirbelsäule erwartet – das war hier aber nicht der Fall. Da am Fundort keine Schleifspuren auffielen, könnte der leblose Duhler in die Halle getragen oder mit einem Fahrzeug transportiert worden sein. Aber wie kam er in die Erhängungsposition? Der Dachbalken muss kriminaltechnisch danach untersucht werden, ob Schürfspuren von dem Strang auf das Hochziehen des Leichnams hinweisen. So weit unsere erste Einschätzung.«
Fast gleichzeitig fragten der Staatsanwalt und Dr. Schöneberg: »Und wie soll man den Abschiedsbrief erklären?«
Da schlug Granow vor: »Lassen wir den doch von einem Schriftsachverständigen prüfen! Vielleicht ist es ja eine Fälschung.«
Rühl nickte und meinte: »Das wäre auf jeden Fall ein cleverer Täuschungsversuch.«
Und Schwarz fügte hinzu: »Es gibt sicher noch andere Erklärungen. Ich hatte vor Jahren so einen Fall. Bei einem Bier könnte ich Ihnen einmal die ganze Geschichte erzählen.«
Granow, Marotzke und Dr. Schöneberg warfen sich einen raschen Blick zu. Sie kannten die Vorliebe des Professors zur Genüge, ähnlich gelagerte Fälle aus der Vergangenheit ausgiebig vorzutragen. Mitunter hatten sie einen zaghaften Versuch gestartet, einer Anekdote mit dem Hinweis »Die Geschichte kennen wir schon« zu entgehen. Meist waren diese Versuche jedoch zum Scheitern verurteilt. Warum sollte es ihnen besser gehen als dem Auditorium in Schwarz’ Vorlesungen? Wobei es einen Unterschied gab: Die Studierenden waren meist an den forensischen Anekdoten mehr interessiert als an reinen Fakten. Nicht zuletzt wegen der geschickten Vermischung von Fachwissen mit spektakulären Fällen waren die rechtsmedizinischen Vorlesungen von Prof. Schwarz so beliebt.
Als der Staatsanwalt sich verabschiedete, nutzten auch Gunnar Granow und Theresa Marotzke die Gelegenheit zum Rückzug und schüttelten Schwarz die Hand, nicht ohne den Hinweis, zu dem Fall in Verbindung zu bleiben.
Schwarz verabredete mit seiner Kollegin das weitere Vorgehen. »Machen Sie in der toxikologischen Abteilung Druck! Die sind zwar völlig überlastet, aber der Fall hat Priorität.« Dann griff er sich die Objektträger mit den Klebebandabdrücken und ging in sein Büro. Er wollte umgehend wissen, ob sich an den Handflächen des Opfers Faserspuren von dem Strangwerkzeug fanden. Nach fast zwei Stunden hatte er alle Objektträger unter dem Mikroskop durchgemustert, rieb sich die strapazierten Augen und brummte zufrieden vor sich hin: »Wusste ich es doch! Es ist alles negativ – der angebliche Selbstmörder hat den Strick nie in den Fingern gehabt.« Anschließend griff er zum Telefon, um der Mordkommission die neuerliche Bestätigung der Mord-Hypothese durchzugeben.
***
Aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es so schön hieß, hätte man es bei Staatsanwaltschaft und Kripo vorerst gern bei der Lesart vom Selbstmord in der Sondermüllhalle belassen. Doch Charly Packebusch war ein zu gerissener Polizeireporter, als dass er die Sache nicht irgendwie mitbekommen hätte, und so mussten sie am übernächsten Morgen in seiner Zeitung lesen, dass Thomas Duhler in Wahrheit ermordet worden sei.
Granow fluchte gewaltig, konnte aber nicht anders, als die Dinge so zu nehmen, wie sie waren. Bevor er sich in der HWD umhörte, wollte er erst einmal mit der Mutter des Ermordeten sprechen. Solche Beileidsbesuche waren immer furchtbar belastend, und er konnte sie auch nur unter Aufbietung aller professioneller Routine durchstehen. Zum Glück hatte er jetzt Theresa Marotzke an seiner Seite, und so fuhren sie in seinem Wagen zu Ute Duhler nach Mitte in die Holzmarktstraße.
»Hinter der Janovenwitzbrücke rechts«, sagte Theresa Marotzke, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte und die Fahrroute bestimmte.
Granow staunte. »Wieso denn das? In der Holzmarktstraße sind doch die Hauseingänge alle hinten, da fahre ich lieber geradeaus und dann rechts irgendwo in eine Seitenstraße rein.«
»Das stimmt, aber ich will in der Holzmarktstraße noch schnell in meine Tanzschule und mich für einen neuen Kurs anmelden.«
»Mir reicht es schon, wenn mir meine Familie auf der Nase rumtanzt«, brummte Granow und hielt da an, wo Theresa es gern haben wollte.
Nachdem dies erledigt war, machten sie sich auf die Suche nach der Wohnwabe von Ute Duhler. Als ihnen geöffnet wurde, waren sie erleichtert, denn die Trauernde hatte eine Reihe von Freundinnen um sich, die ihr in diesen schweren Stunden beistehen wollten. Schnell waren die nötigen Sätze des Mitgefühls gesagt, dann konnten die Kommissare Fragen zu Thomas Duhlers Umgang und Interessen stellen.
Was die HWD betraf, musste Ute Duhler nicht lange nach einer Antwort suchen. »Mein Sohn war mit seiner Firma verheiratet, das kann man schon so sagen.«
»Und hatte er eine Frau oder eine Freundin?«, hakte Granow nach.
»Na, die Doreen Reger, eine seiner Kolleginnen, die hätte ich mir schon als Schwiegertochter gewünscht. Aber da war ja auch noch ein Konkurrent, der Simon Mächtig.«
Das war das Interessanteste, was sie von Ute Duhler erfuhren, und daraus ließ sich schnell die erste griffige These formulieren.
»Es könnte sich um eine klassische Beziehungstat handeln: Um diese Doreen für sich zu haben, bringt Simon Mächtig seinen Rivalen Thomas Duhler um, das heißt, er erwürgt ihn und hängt ihn dann auf, um mit Hilfe des gefälschten Abschiedsbriefs einen Selbstmord vorzutäuschen.«
Bei der HWD in Pankow meldeten sie sich zuerst im Büro des Firmeninhabers. Hans-Werner Damretzky war deutlich anzusehen, wie sehr ihn die ganze Sache bedrückte.
»Für mich ist das der Super-GAU«, klagte er. »Mein wichtigster Mitarbeiter soll ermordet worden sein, und womöglich suchen Sie den Täter auch noch in den Reihen seiner Kollegen!«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.