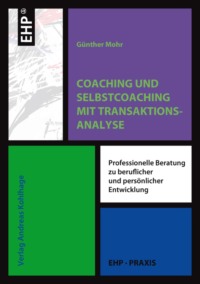Kitabı oku: «Coaching und Selbstcoaching mit Transaktionsanalyse», sayfa 3
Das Werte-Vernunft-Gefühle-Modell
Oft wird in der TA-Praxis auch damit gearbeitet, dass das Eltern-Ich eher von Werten, das Erwachsenen-Ich von Vernunft , das Kind-Ich von Gefühlen bestimmt gesehen wird. Dies ist eine Art verkürztes Funktionsmodell und ist theoretisch nicht konsistent.
Dennoch entspricht es als Vorstellungsbild auch landläufiger Plausibilität, dass die wertemäßige Orientierung etwas mit dem Elternhaus (»Kinderstube«) zu tun hat, dass Kinder eher gefühlsmäßig reagieren und dass Vernunft ein erwachsenes Lernprodukt ist. Es ist auch dann eine interessante Landkarte, wenn es um so genannte Ausschlüsse von Ich-Zuständen geht (z.B. jemand lebt keine Gefühle; jemand bezieht sich nicht auf Werte). Es wäre eine interessante Überlegung, die drei Ich-Zustands-Perspektiven (Herkunft, Ausdrucksqualität und Werte-Vernunft -Gefühle) in Verbindung zu sehen. Dann wäre zu fragen, wie eine kritische innere Stimme (kritisches Eltern-Ich) von den eigenen Eltern (Herkunft smodell) erworben wurde und so ein bestimmtes Wertesystem zeigt. Da solche Zusammenhänge nicht selten der Fall sind, werden von manchen Autoren alle drei Perspektiven mit Eltern-Ich bezeichnet. Sie sind aber unterschiedliche Blickrichtungen auf die Persönlichkeit eines Menschen. Für die Praxis des Coachings gilt es, jeweils die Perspektive zu nutzen, die als »Landkarte« für eine Lernaufgabe eines Menschen am ehesten passt.
Das Lebensplan-(Skript)-Modell
Das Lebensskript-Modell ist ein die tiefenpsychologische Seite der Transaktionsanalyse charakterisierendes Modell. Aber auch bei der tiefenpsychologischen Perspektive gilt der Grundsatz der Transaktionsanalyse, dass Aspekte der Person immer in ihren Transaktionen sichtbar werden oder sichtbar gemacht werden können, und nicht generalisierte Annahmen sind, wie sie für andere tiefenpsychologische Konzepte schon einmal gelten (z.B. Freuds »Ödipus-Komplex«, Adlers Minderwertigkeitserleben).
Der geniale Grundgedanke des Skriptes ist, dass sich Menschen in ihren prägenden Jahren individuell einen Grundreim aufs Leben machen. Dieser Reim aufs Leben beinhaltet wie in einem Drehbuch – deshalb Skript – die wesentlichen Themen, mit denen dieser Mensch sich im Leben herumschlagen wird, die wesentlichen Typen von Beziehungspartnern, die er/sie anlockt und sogar mögliche Formen des Lebensendes. Sie werden sagen: »Dann ist ja alles vorbestimmt.«
Eric Berne übernahm die Vorstellung, dass man das Leben eines Menschen so betrachten kann, als laufe es nach einem bestimmten Muster ab, wie nach einen unbewussten »Lebensplan«: dem Skript.

Die Theatermetapher: Das Skript beschreibt das Leben wie eine Rolle im Theater. Es gibt Rollen aus dem Drama, aus der Tragödie, aus der Komödie, aber auch Rollen ohne besondere Ausprägungen.
Die Skriptanalyse im Coaching betrachtet spezielle für einen Menschen sehr charakteristische Muster aus Einstellungen, Fühlen und Verhalten. Menschen erwerben in ihren ersten Lebensjahren diese individuell grundsätzliche Perspektive auf das Leben. Jedes Individuum entwickelt so ein ihm sehr eigenes Muster eines Denk- und Gefühlsapparates, das wiederum mit bestimmten Verhaltensweisen verbunden ist. Kultur, Familie, eigene Anlagen nehmen ebenfalls Einfluss auf die Tönung dieses Instrumentes, mit dem ein Mensch dann durch das Leben geht und das nach Bestätigung seiner selbst sucht. Bei den meisten Menschen fällt dieses Persönlichkeitskostüm aus Denken, Fühlen und Verhalten nicht sonderlich auf, weil es zu den Erwartungen der Umwelt passt. Aufmerksam wird man auf diesen Teil menschlichen Funktionierens nur durch sehr auffällige Persönlichkeiten. Die werden dann als nicht »normal« beschrieben. Dass der Mechanismus der Kostümbildung aber bei jedem Menschen in frühen Jahren am Werke ist, wurde durch die Arbeiten zu den Lebensleitlinien von Alfred Adler und das Konzept zum Lebensskript von Eric Berne populär. Die TA geht in der Folge Bernes davon aus, dass der Mensch sich im Alter von etwa drei bis acht Jahren für ganz bestimmte Themen entscheidet, unter denen sein Leben dann steht. Das Kind kreiert das so genannte Lebensskript, eine Art unbewusstes Lebensdrehbuch, als Reaktion auf bestimmte Anforderungen, Erwartungen und Verhaltensweisen in der von ihm wahrgenommenen Welt, insbesondere seiner direkten sozialen Umwelt, der Familie. Die Entscheidung für dieses Lebensdrehbuch wird aus Sicht der TA aufgrund der altersspezifischen inneren Entscheidungsprozesse, d.h. auch der kindtypischen Informationsverarbeitung wie magisches Denken, Identifikation mit Märchengestalten etc. gefällt. Sie beruht bei der äußeren Stimulanz des Kindes sehr stark auf dem nonverbalen Verhalten, der Stimmung der Eltern dem Kind gegenüber. Viele Familienforscher (Hellinger, Weber) gehen heute sogar von einem Mehrgenerationenansatz aus. Die dabei angenommene Gleichgewichtstendenz von Familien- bzw. Sippensystemen beinhaltet, dass immer wieder bestimmte Rollen zu besetzen sind. Wenn in einer Familie ein Unrecht geschehen ist, z.B. eine Person wurde ausgestoßen, kann die Erziehung unbewusst ein Kind dahin bringen, die Rolle dieser Person zu übernehmen oder das Unrecht wieder gutzumachen. Es kann auch sein, dass ein »schwarzes Schaf« in der Familie, über das die Erwachsenen immer nur hinter vorgehaltener Hand sprechen, zur interessanten Identifikationsfigur für das Kind wird. Neben dieser Möglichkeit, ein Lebensmanuskript (Rollenbuch, Drehbuch) anzunehmen, gibt es noch einen anderen Ansatz: Jedes Kind ist auf die Liebe seiner Eltern angewiesen. Es würde ohne diese nicht leben können. Wir sind eine phylogenetische Frühgeburt, die auf die gelebte Liebe und Hilfe anderer Menschen angewiesen ist. Wenn das Kind diese Liebe nicht so einfach bekommt, wird es alles tun, was ihm die maximale Zuwendung sichert. Oft muss es dabei schmerzhafte Gefühle unterdrücken. Bei seltener Umarmung leitet ein Kind aus diesem Umstand vielleicht ab: Ich bin nicht liebenswert, also zeige ich lieber nicht, was ich eigentlich will (Petersen, 1980, 268). Das Lebensskript wird allgemein als sehr beständig angenommen. Versuche, das Gegenteil in einer Art Gegenskript zu leben (»counterscript«), sind nicht Erfolg versprechend (James & Jongeward, 1974, 111). Für das Skript sind intelligente Lösungen und Alternativen erforderlich. Hier liegt die positive Weiterentwicklung eines Menschen im Bewusstwerden der bisher unbewusst lenkenden Skriptanteile und in der entschiedenen

Abb. 9: Script-Matrix
Entwicklung eines Lebensstils, der gleichzeitig sorgsam mit den eigenen früheren Lebensprägungen umgeht und für heute angemessene autonome Reaktionen beinhaltet.
In der Skriptmatrix werden Einflussfaktoren des Skripts thematisiert. Aus den entsprechenden Ich-Zustandssystemen (Eltern-Ich = El; Erwachsenen-Ich = ER; Kind-Ich = K) von Vater und Mutter werden Impulse für die Skriptkreation des Kindes gegeben. Und zwar sind die so genannten Einschärfungen, unter denen man aus dem emotional und selbst früh entschiedenen Teil der Eltern kommende Impulse versteht, als sehr wesentliche Impulse zu sehen. Dies können die emotionale Tönung sein, die ein Elternteil in die Beziehung bringt (»die Mama ist immer etwas depressiv«) oder auch Zuschreibungen (»Du bist leider so ein Tollpatsch«) mit entsprechendem Nachdruck.
Atmosphärische Übermittlungen und auch Zuschreibungen können natürlich zwischen Elternteilen sehr variieren, was unter Umständen später zu wechselnden Selbstbildern führt. Eine interessante Ebene des Skriptes, die später als die frühen Einschärfungen angeboten wird, sind so genannte Antreiber, auch Gegenskriptbotschaften genannt. Sie geben Ratschläge, wie man sich bei empfundenen Stress- und Unbehaglichkeitssituationen verhalten soll.
Eine Vorstellung über einzelne ganzheitliche Skriptmuster liefern auch die neun Enneagrammtypen. Das Enneagramm stammt nicht aus der Transaktionsanalyse, gibt aber bei der Skripttheorie eine anschauliche Illustrierung, wie ein Skript sein kann.

Abb. 10: Die neun Typen des Enneagramms
Interessant ist hier auch, das alle Typen sehr viele Ressourcen haben, aber auch an ihren Schattenseiten arbeiten müssen. Die neun Typen des Enneagramms sind Persönlichkeitsmuster, die quasi wie Skripte übernommen werden im Sinne einer frühen Lebensentscheidung für die Herangehensweise an die Welt. Sie lassen sich leicht in Verbindung bringen mit gängigen Persönlichkeitsfragebogen wie dem MBTI.
Das Skript: Vorbewusste, aber außerordentlich erlebens- und verhaltenswirksame Lebensmuster, die sehr stark durch ein entschiedenes Glaubenssystem über sich, andere und die Welt untermauert sind. Sie treten gerade in Konflikten sehr stark auf. Das Skript ist eine ganz wichtige frühe Lebenserfahrung, die die eigene persönliche Haltung wesentlich geprägt hat.
Skriptenergie I: Wenn man selbst im Skript ist, spürt man eine ganz eigene Stimmung. Man hat die Vorstellung, dass einem die Situation jetzt sehr wichtig ist. Es kann sein, dass man Werte oder Sichtweisen bedroht sieht, die einem persönlich sehr wichtige sind.
Beispiel 1: Wenn Ungerechtigkeit auftritt, dann macht mich das fuchsteufelswild. Ich könnte denjenigen umbringen, der für die Ungerechtigkeit verantwortlich ist.
Beispiel 2: Jemand muss im Kontakt mit Männern immer die Oberhand behalten. Männer sind immer Konkurrenten. Sie wollen mir etwas wegnehmen. Entweder macht er im Kontakt gleich deutlich, dass er ein harter Hund ist, oder er geht gar nicht in den Kontakt mit Männern.
Skriptenergie II: Mit dem eigenen Skript verbundene Situationen sind durchaus mit mehreren Gefühlen verbunden. Es gibt die angenehme Erfahrung des »Davongekommenseins«. Dies lockt, den gleichen Ausweg zu wählen, wenn man in eine ähnliche Situationen kommt . Gleichzeitig liegt darunter oft ein ungelöstes Bedürfnis. Wäre es nicht schön, wenn eine angemessenere Lösung möglich wäre?
Aus welchen Wurzeln stammt ein Skript? Das Skript eines Menschen – in der umfassenden Definition – ist normalerweise sehr vielfältig. Es gibt förderliche Bestandteile im Sinne von Erlebens- und Verhaltenserfahrungen, die für die Lebensgestaltung sehr nützlich sind. Natürlich hängt dies auch von den Lebenssituationen ab. Wichtig sind aber vor allem auch einschränkende Skriptbestandteile, die einem Menschen in seinem Erwachsenenleben immer wieder Leid oder auch Probleme mit anderen Menschen bringen. Diese Skriptbestandteile resultieren oft aus Situationen, in denen ein Mensch in seinen frühen Entwicklungsjahren durch eine Situation überfordert und ohne genügende Unterstützung war, aber doch irgendeinen Ausweg aus diesem Dilemma für sich erfahren hat. Der Ausweg im Verhalten ist oft mit einem Denken und Fühlen verbunden. In seinen frühen Entwicklungsjahren hat der Mensch häufig auch noch magische Denkmuster dazu, wie Menschen und die Welt sind. Man macht sich einen Reim auf die Situation. Diese Situationsbewertung prägt sich dann ein und wird auch in späteren Lebensphasen nicht so leicht hinterfragt. Das Gefühl, da noch einmal rausgekommen zu sein, überlagert oft das ursprüngliche Gefühl der Hilflosigkeit. Noch einmal herausgekommen zu sein, ist auch ein angenehmes Gefühl. Dies festigt das Auswegmuster als erfolgreich. Die Situationen der Entwicklungsjahre erlebt der Mensch meist in Kontakt mit seinen frühen Beziehungspartnern, den Eltern. Sie zeigen ihm das Leben. Sie sind für ihn so wie Menschen sind. Daneben haben gerade Kinder aber auch Grundbedürfnisse nach Zuwendung und Sicherheit. Werden diese in der Kindheit durch das Verhalten der Eltern nicht erfüllt, nimmt der Mensch dies auch für das Leben mit. Die Zuneigung zu den Eltern führt eher dazu, dass die Welt so gesehen wird, wie die Eltern sie repräsentieren, als wie sie nach den inneren Bedürfnissen sein müsste. Dies führt im Erwachsenenalter dazu, dass oft in der Partnerschaft oder im Arbeitsleben Situationen kreiert werden, die die Grunderfahrung der Beziehung mit den Eltern bestätigen sollen. Obwohl dahinter der Wunsch steckt, die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, ist die Versuchung groß, eben genau die von den Eltern vermittelte Welt zu bestätigen.
2.4 Beziehung und Kommunikation
Der dritte Bereich betrifft Kommunikation und Beziehung. Man kann es so gut meinen, wie man will. Wenn man nicht in der Lage ist, das nach außen zu kommunizieren, erreicht man nichts. Kommunikation ist Beziehungspflege. Vernachlässigt man die Kommunikation, so darf man sich nicht wundern, wenn Beziehungen nicht gelingen. Mich hat einmal der Spruch beeindruckt: »Liebe ist ein Verhalten, nicht primär ein Gefühl.« Das ist vielleicht überspitzt. Aber wir werden an unserem Tun und dessen Wirkung gemessen, nicht an dem, was irgendwie dahinter gedacht werden könnte. Angemessene Beziehungs- und Kommunikationsfertigkeiten zeichnen einen Profiaus.
Die Transaktionsanalyse der Kommunikation im engeren Sinne
Um die Bedeutung dessen herauszustreichen, was konkret und wahrnehmbar zwischen zwei Menschen in der Kommunikation passiert, betrachtet die Transaktionsanalyse die Mikroeinheiten der Kommunikation. Was »strahlt« der eine Kommunikationspartner aus und was gibt der andere zurück. Dieser Fokus auf die konkreten Botschaft en kennzeichnet die Transaktionsanalyse.
Damit ist es quasi ein doppeltes Sender-Empfänger-Modell à la Shannon und Weaver (1948). Der Unterschied zu anderen Kommunikationsmodellen liegt darin, dass Kommunikation als ein Austausch zwischen den Ausdrucksfiguren der Ich-Zustände verstanden wird. Beziehungen bestehen aus einem Fluss von Transaktionen. Je nach dem, ob kEl mit fEl mit K, oder ER mit ER etc. kommuniziert, gibt es sehr unterschiedliche Formen, die komplementär, überkreuz oder verdeckt sein können. Somit entspricht die Transaktionsanalyse der modernen Kommunikationsdefinition von Gunther Schmidt (2005): Kommunikation besteht aus Einladungen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte zu richten.
Komplementäre Transaktion bedeutet, dass der adressierte Ich-Zustand antwortet und sich auch an den sendenden Ich-Zustand wendet. In der gekreuzten Transaktion antwortet ein anderer als der adressierte Ich-Zustand. Dann existieren noch die verdeckten Transaktionen, bei denen neben einer offenen Ebene eine unterschwellige vorhanden ist. Drei Beispiele dazu:
Eine Transaktion ist definiert als ein Austausch von Information (Stimulus und Reaktion) zwischen zwei Personen.

Abb. 11: Parallele (1), Gekreuzte (2), Verdeckte Transaktionen (3)
Die TA hat Kommunikationsregeln entwickelt:
• Solange die Transaktionen parallel verlaufen, kann die Kommunikation unbegrenzt weitergehen.
• Die Überkreuztransaktion bedeutet eine Störung in der Kommunikation; soll diese wieder »glatt« ablaufen, muss einer der Gesprächspartner oder müssen beide den Ich-Zustand wechseln.
• Bei der verdeckten Transaktion fällt die Entscheidung über das weitere Verhalten durch die verdeckte und nicht durch die offene Ebene.
Die »Spiel«analyse
Das Skript lässt bestimmte Muster der Kommunikation und Beziehungsgestaltung entstehen. Diese treten besonders in Stresssituationen, aber auch als Gewohnheitsmuster auf. Die Transaktionsanalyse nennt diese Muster »Spiele«, weil sie wie eingespielt wirken, aber auch den Charakter von Spielchen haben.
»Ein Spiel besteht aus einer fortlaufenden Folge verdeckter komplementärer Transaktionen, die zu einem ganz bestimmten voraussagbaren Ergebnis führen.« (Berne, 1970, 57)
Spiele kann man als Kommunikationssituationen verstehen, bei denen bestimmte einge«spiel«te Folgen von Transaktionen ablaufen. Nach James und Jongeward (1974, 52) haben Spiele drei Merkmale:
1. eine fortlaufende Folge von Komplementär-Transaktionen, die auf der gesellschaft lichen Ebene plausibel sind,
2. eine verdeckte Transaktion, die zugrunde liegende Mitteilung des Spiels, und
3. einen vorauszusehenden Nutzeffekt, der das Spiel beendet und Zweck des Spielens ist.
In Spielen werden die drei Rollen des Dramadreiecks besetzt: Verfolger, Retter und Opfer.

Abb. 12: Drama-Dreieck von Steve Karpman
Es gibt unterschiedliche Kontexte, in denen Spiele eine Rolle »spielen«. Ulrich Dehner hat besonders noch einmal Bürospiele betrachtet (Dehner, 2001). Ähnlich wie Spiele dienen »Rackets« (English, 1986) dazu,das Skript aufrecht zu erhalten. Es sind Verhaltensmuster, die auf Positionen und Skriptbotschaft en beruhen und durch die gewohnte und alte Stimmungen wieder belebt werden. »Im Racket geht es um Ersatzgefühle, hinter denen ein wirkliches Gefühl steht, das in der frühen Kindheit nicht erlaubt oder abgewertet wurde.« (Frühmann, 1978,374). Jemand zeigt zum Beispiel Ärger, wenn eigentlich Angst angesagt ist. Die Racket-Gefühle haben in der Regel negativen Charakter und sind auf die Abwertung meines Selbst und anderer gerichtet. Der Unterschied zwischen Racket und Spiel besteht darin, dass bei einem Racket die Ich-Zustände nicht gewechselt werden.

Abb. 13: Die neun Typen des Enneagramms
2.5 Kontext und Systembezug
Kontext I: Der Bezugsrahmen
Der vierte Bereich ist die Kenntnis des Einflusses von Umfeldern auf Menschen. Das Umfeld, in dem jemand lebt, auch und vor allem das, in dem jemand aufgewachsen ist, bestimmen seine Weltsicht. Es gibt nicht »die« Weltsicht. Jeder Mensch lebt in seiner Welt. 80 Prozent der Kommunikation findet im Empfänger der Kommunikation statt. Was im Empfänger stattfindet, ist durch seine bisherigen Erfahrungen bestimmt, nicht durch das, was der Sender gerade zu senden versucht. Ob die mangelnden Schulerfolge von Unterschichtkindern oder die Ordnung, die Menschen um sich erleben, immer ist der aktuelle Kontext wesentlich für das Denken und Handeln. Wer in der Schweiz, nachdem er achtlos ein Tempotaschentuch auf die Straße geworfen hat, von einer älteren Dame höflich angesprochen wurde: »Entschuldigen Sie, ich glaube Sie haben etwas verloren« merkt, dass hier ein bestimmtes Ordnungsprinzip gilt. Ein anders Beispiel für die Auswirkung des Umfeldes: Jeder Zusammenschluss ist immer auch ein Ausschluss anderer. So erleben Menschen das. Sobald in einer Firma zwei Abteilungen vorhanden sind, nennen wir sie einfach Apachen und Komantschen, entsteht sehr schnell eine Konkurrenz, manchmal Gegnerschaft, nicht selten auch Feindschaft bis hin zum Krieg. Wie Sie ein Umfeld-Profi werden, lernen Sie in den nachfolgenden Kapiteln.
Seit der »systemischen Wende« (etwa 1980) haben alle professionellen Veränderungsmodelle zwei Aspekte integriert:
• den Aspekt der Vernetzung jedes einzelnen Menschen in mannigfaltigen Systembezügen (Familie, Firma, Vaterland,…)
• den Aspekt, dass jeder Mensch aus seiner Selbsterhaltung heraus sich ein Modell über die Welt, die anderen und sich selbst konstruiert.
Den ersten Aspekt hat die Transaktionsanalyse durch ihre letztlich internalisierten Bilder erlebter Beziehungskonstellationen (Eltern-Ich zu Kind-Ich, Skript) und das Außen-in-Szene-Setzen dieser Muster durch Transaktionen und psychologische Spiele schon von Anfang an beschrieben. TA ist also sehr systemisch per se (Kreyenberg, 2005). Den Aspekt des Konstruktivismus bringt TA durch das Bezugsrahmenmodell von Schiffet al. zur Geltung.
Der allgemeine Bezugsrahmen ist die aktuelle Sicht, die ein Mensch von sich, von anderen und von der Welt hat.

Abb. 14: Persönlichkeitsausdruck, Grundbedürfnisse, Bezugsrahmen und Script
Interessant sind hier besonders spezielle Bezugsrahmen, die Menschen zu allen möglichen Fragen ihres Leben haben, z.B. zum Lernen, zur Erziehung, zu Führung, zu Politik etc. Dieses Einstellungssystem zu einer bestimmten Fragestellung ist äußerst wichtig für die Bezugnahme auf eine solche Frage. Das heißt zum Beispiel: Die Sicht, die ich vom Lernen habe, bestimmt auch mein Lernverhalten. Denke ich etwa, dass man mit 18 Jahren ausgelernt hat, ergibt sich ein anderes Verhalten, als wenn ich der Idee lebenslangen Lernens anhänge.
Kontext II: Die »aktuelle Aufstellung« des Systems
Um die Wirklichkeit eines Coachees in einem Unternehmen oder einer Organisation zu erfassen, ist der Bezug zum System, in dem er tätig ist, von zentraler Bedeutung. Dies bedeutet die Erfassung der schon oben erwähnten Dynamikfelder. Antworten auf die Fragen zu den zehn Dimensionen ergeben ein hervorragendes Bild, wie eine Organisation aktuell beschaffen ist.
Zusätzlich lassen sich die 10 dynamischen Felder durch TA-Konzepte näher beschreiben. Auf diese Weise wird der vor allem für das Coaching so zentrale Bezug zum System Organisation hergestellt. Ohne diesen bleibt das Coaching auch ohne Bezug zur aktuellen Realität des Coachees. Mehr dazu in Kapitel 4.

2.6 Entwicklung und Veränderung
Der fünfte Bereich ist Entwicklung und Veränderung. Entwicklung betrifft den normalen Verlauf, wenn etwas in einer einmal eingeschlagenen Richtung weitergeht. Veränderung ist ein Einschnitt in das, was bisher war. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Veränderungen werden oft von außen angestoßen, zum Teil einem aufgezwungen. Ein plötzlich notwendiger Personalabbau ist eine völlig andere Situation als das altersbedingte Ausscheiden von Arbeitnehmern aus dem Unternehmen. Das erste ist Veränderung, das zweite Entwicklung, auf die man sich einstellen kann. Sie werden sagen, für den altersbedingt Ausscheidenden ist der Übergang in die Rente ebenso eine Veränderung. Aber es ist eigentlich eine Entwicklung, die bekannt, absehbar und vorzubereiten war. Dass viele Menschen aus Entwicklungen, indem sie nicht hinschauen, eine Veränderungssituation machen, steht auf einem anderen Blatt. Entwicklung und Veränderung, beides sind Rhythmen des Leben. Manchmal kommt es so, manchmal so. Es ist wie mit dem Fahrradfahrer, der umfällt, wenn er nicht mehr die Pedale bewegt. Aber auch das weckt manchmal auf und führt dann zu Veränderung.
Ich-Zustandsebene
Zunächst ist Ich-Zustands-Coaching die Entwicklung neuer Ich-Zustände. Dazu gilt es für eine Situation oder ein bisheriges Reaktionsmuster ein neues zu etablieren:

Abb. 15: Entwicklung neuer Ich-Zustände
Der neue zu entwickelnde Ich-Zustand steht allerdings in Konkurrenz zu den schon etablierten Ich-Zustandsmustern der Eigenentwicklung und der Modelle von außen.

Abb. 16: Drama-Dreieck von Steve Karpman
Bezüglich der Ausdrucksqualitäten der Ich-Zustände (freies Kind-Ich bis kritisches Eltern-Ich) strebt die TA den freien Zugang zu allen positiven Ich-Zuständen an. Inhaltlich stellt sich an eine Person die Frage: Ist sie glücklich, ist sie frei? James beschreibt die »gesunde« Struktur der Ich-Zustände so:
»Bei einer gesunden Person gilt:
1. Die Ich-Zustände sind klar gegeneinander abgegrenzt.
2. Die Klientin hat freien Zugang zu ihren Ich-Zuständen.
3. Das Erwachsenen-Ich filtert das Verhalten« (James, 174; zit. n. Petersen, 1980, 270)
Eine problematische Struktur der Ich Zustände sieht folgendermaßen aus:
Situation a) Grenzen zwischen ER, El und K verfließen; z.B. zwischen ER und K: Vorurteile werden als realistische Einschätzungen der Realität empfunden.
Situation b) Ein oder mehrere Ich-Zustände sind ausgeschlossen; Situation c) Nur in einem Zustand sein, z.B. im Kind (überschneidet sich z.T. mit b).
Aus den angegebenen Zuständen ergeben sich problematische Interaktionen. Wenn ein Klient einen seiner Ich-Zustände nicht benutzt, wird er ihn in anderen Personen suchen. Solche Menschen gehen symbiotische Beziehungen ein. Viele Ehen funktionieren nach diesem Prinzip. Die symbiotische Tendenz wird durch »Abwertung« aufrechterhalten. Abwertungen sind Ausblendungen und Wahrnehmungsverzerrungen. Je weniger der Klient wahrnimmt, je mehr er ausblendet und abwertet, desto schwerer ist er gestört.