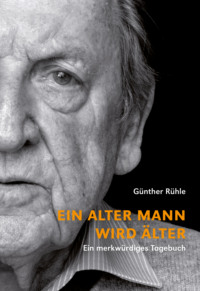Kitabı oku: «Ein alter Mann wird älter», sayfa 4
8. November 2020
Anfang als Kritiker FNP 1956
Ich war also im Feuilleton der Frankfurter Neuen Presse. Ein gediegenes Örtchen mit freundlichen Mitarbeitern. Ein gern schäumender, vital wirkender Chef, Manes Kadow, ein poetisch ambitionierter Kollege mit abgebrochenem Studium, Sohn eines Apothekers, der eine verschwommene Liebe zu den Künsten hatte, gelegentlich Gedichte schrieb, verheiratet mit einer rastlosen Studentin, die ihm zuliebe Pharmazie machte, weil er die bestens gehende, stattliche Apotheke am Goetheplatz nicht übernehmen wollte. Sie füllten gewissenhaft, aber ambitionslos die täglichen Feuilletonspalten, sehr gern mit eingeschickten Geschichtchen. Beide liebten das Kino und das Gläschen auf dem Tisch. Der Theaterteil, den Helmut Castagne lange sehr gut begleitet hatte, lief so nebenbei. Es war also angenehm friedlich. Kadow fuhr freitagnachmittags nach Köln, er machte nebenbei das Nachtstudio im Westdeutschen Rundfunk. Da waren sie froh, dass sie mich in die Freitagspremieren ins Theater schicken konnten. Ich hatte noch nie eine Kritik geschrieben.
Vor dieser Nacht vom 9. zum 10. November 2020
Jetzt ist’s mitten in der Nacht. Mich treibt’s um. Ich war gestern Abend im Schreiben angekommen bei der FNP, wollte das speichern, sehe, dass der Anfang auf einem neuen Blatt steht, nichts davor, Leere dahinter. Die Frage kam: »Wollen Sie speichern?« Ich schreibe: »Ja«. Das brachte die Katastrophe. Da war man auf Anfrage positiv und saß in der Verzweiflung. Der ganze vorherige Text war weg, 79 Seiten. Wie krieg ich die wieder? Das »Rückgängig« habe ich neulich aus Versehen aus der Befehlsleiste gelöscht. Ich habe fast eine Stunde probiert, den Papierkorb gewendet, immer kommen nur anderthalb Seiten. Es lief so gut. Über die Anfänge als Kritiker in Frankfurt, Brecht und die Folgen für die Kritik. Das war doch sicher spannend, was ich da schreiben wollte. Jetzt: Text weg. Denken blockiert. War die Fehlleistung symbolisch? Nichts ging mehr. Es ist nicht nur der Text vom Tage weg, bis auf den gedruckten Rest, sondern das Ganze. Ich muss wohl aufgeben. Ich sehe, dass ich immer untauglicher werde. Bisher war mir der Computer eine Nothilfe. Jetzt finde ich noch nicht einmal mehr die Datei »Dokumente«, wo ich bisher so viele verlorene Texte wiederfand. Noch erkenne ich ja die Buchstaben auf meiner großen Tastatur. Aber ich beherrsche sie nicht mehr. Wieder ein Anfang im Verschwinden des Könnens.
10. November 2020
5 Uhr 20 zeigte der Wecker. Ich halte es im Bett nicht mehr aus. Zum ersten Mal. Ich spüre seit Tagen, dass mein Schlaf dünn wird. Ich hatte immer einen klaren tiefen Schlaf, nach den Unterbrechungen nachts schlief ich sofort wieder ein. »Freu dich, dass du so gesund schläfst«, sagten die Freunde. Ich spüre, auch das geht zu Ende. Diese Nacht war ein einziger Kampf, eine steigende Unruhe, fünfmal den Schlafanzug gewechselt, geschwitzt, die Decke wieder zurechtgezurrt. Ich habe schon lange die klassische Schlaflage eingeübt: auf dem Rücken, den Kopf gut gestützt, die Arme längs an den Seiten. Mindestens fünfzehnmal habe ich mich herausgeschleudert, auf die Seite, in die Babystellung. Auch das half nicht mehr, war sonst immer todsicher. O, warum plötzlich dieses Wort. In der Halbschlafquälerei dieser Nacht kam wie natürlich das Verlangen nach dem Ende wieder auf. Ich dachte sogar an die Hilfsinstrumente in der Küche. Und fragte mich, ganz gegen meinen Willen, warum macht man das nicht? Noch nicht? Dann wieder zugedeckt, wieder aus dem Halbschlaf gehustet, im Rachen oben links juckt eine besondere Art von Schleim, der will raus. Man wirft sich rum, immer wieder auf den Mausarm, der nach ein paar Minuten wehtut, selbst das Dämmern zerstört. Man ist selbst das Ereignis dieser Nacht. Sitzt die Unruhe nicht im Gehirn? Ich musste jetzt runter und das hinschreiben. Die Sätze sind frisch vom Fass. Komm ich so frei von der Zappelei dieser Stunden? Jetzt wird auch mein Schlaf krank. Man wartet, dass die Nacht endlich vorbeigeht. Man wird müde in den bald grauenden Tag gehen, der selbst nichts anderes hervorbringt als den Wunsch nach einer guten Nacht. Ich gehe jetzt wieder rauf und fühle schon jetzt, wie es wieder wird, eine feuchtwarme Wälzerei. Wie kriegt man die alles registrierenden Ungeduldssätze aus dem Hirn, die so tun, als wären sie Gedanken. Die Nacht dauert noch fast drei Stunden.
10. November 2020
Ich konnte gestern Nachmittag nicht weiterschreiben, obwohl ich wollte. Ich wurde gebremst, weil ich mir sagte: O, nicht weiter, gehört das ins Tagebuch? In der Nacht drauf brach ein anderes Stück aus der verdrängten Erinnerung. Es war im Halbschlaf, ich war beim Entwässern, da stand ich auf einmal in Oberallmannshausen, klingle an dem großbürgerlichen Haus, es öffnet ein alter Mann, schmal, wacklig, stockgestützt. Das war jetzt Hanns Johst, ehemals eine hohe Figur bei Hitler, Reichsschrifttumsleiter, beinahe Intendant des Staatstheaters in Berlin, der jung Expressionist war und dabei, als 1919 die Expressionisten nach dem Neuen Menschen riefen. Sein Stück »Der Einsame« war eines der Ereignisse jener Tage. Deswegen war ich jetzt hier. Es war wohl 1970, als die Studenten im Land ihre Revolte einübten. Ich machte eine Edition, die später »Zeit und Theater« hieß.15 Ich wollte mit Johst über seine Anfänge sprechen. Er führte mich ins Zimmer und deutete auf einen Stuhl: »Setzen Sie sich da drauf. Da hat mal der Brecht gesessen.« Die beiden Jungdichter waren damals in einem anscheinend freundlichen Clinch. Er schrieb gegen Johst die Geschichte vom Heimkehrer Kragler, aus der »Trommeln in der Nacht« wurde. Brecht lebte für den alten Johst in dem Zimmer. Ich war viele Jahre später nochmal in Oberallmannshausen, Rudolf Noelte lebte dort. Er sollte mir für Frankfurt »Vor Sonnenuntergang« inszenieren. Es wurde nichts daraus, aber die Sache mit dem Stuhl kannte er. Sie sind sich wohl begegnet. Aber aus der Stunde mit dem alten Johst behielt ich etwas, was mir heute Nacht erschien. Er war wohl früh in der Partei. Er sagte: »Wir redeten viel vom Volk, wussten aber nicht, was das Volk war. Deswegen haben wir die Parteitage eingerichtet. Da stand es vor uns, geordnet und einheitlich.« Irgendwo habe ich das schon beschrieben, vor 50 Jahren. Jetzt überstürzt es mich noch immer. Ich sah mich plötzlich, ich war in der neuen Uniform zwischen Frankfurt und Darmstadt auf dem Damm vor einem Wald aufgereiht, ich war »Jungvolk«, hintransportiert, weil »Der Führer« den ersten Teil der Autobahn einweihte. Als er nach langer Zeit ankam, schrien und riefen wir »Heil« und wurden dann wieder heimgefahren. Mich schauderte plötzlich. Ich sah, als wär’ es derselbe Tag, Jahre später, auf dem Osterdeich in Bremen, hinter mir mein »Fähnlein«, drei Züge zu 40 Mann, Gleichschritt, die »Blauen Dragoner« singend. »Herr, lass uns stark sein im Streiten / Dann sei unser Leben vollbracht.«16 Ich war fünfzehn, die hinter mir zehn bis zwölf. Was wurde mit uns gemacht, was habe ich da mitgemacht. Nennt man solche Stürze in die Nacht »Heimsuchung«? Es wurde mir kalt, ich fror bis in den Morgen. Ich suche mich, indem ich’s hinschreibe.
10. November 2020
Jetzt fang ich zum dritten Mal an, immer rutschen die Sätze weg. Draußen ist ein trüber, kalter Tag. Im Haus alles wie vernebelt. Ich hatte geschrieben. Ich gehe durchs leere Haus wie ein Gespenst, suchend nach Leben, das es nicht gibt. Noch ist mir alles bekannt, noch, wo die Noten von Vaters Klavierauszügen liegen. Aber es wird alles so fern, als wäre jedes Möbelstück schon Erinnerung. Ich schleppte mich vor diesen Computer, der mich gestern so verließ, und kam nicht mehr zurecht. Fand den Anfang dieses Textes, der unter »Tagebuch 2« gespeichert war, unter »Adressarium« auf dem Desktop wieder. Habe das Adressarium anscheinend gelöscht. Ich sah mich plötzlich in Mutters Situation, kniend vor dem Schränklein in der Eingangshalle, die Tässchen-Sammlung, ausgeräumt, wieder einzubauen versuchend. Man sah einen tätigen Körper, zur Tätigkeit verführt, ohne noch zu können, was von einem verlöschenden Geist noch gedacht war.
So war heute Morgen das Satzgestrüpp. Ich hatte das Ende meiner Schreiberei vor Augen. »Vor Augen« ist zwar gut und richtig gesagt, aber auch wieder nicht richtig, denn Erinnerungen kommen aus den inneren Augen. Die gibt es also. Aber ich war so irritiert, dass ich verstört hinausging auf meine 1200 Meter Strecke. Da spürte ich verwundert, wie flott die stockgestützten Schritte gingen, vierzig Meter die Straße hoch. Ich machte wieder die Augenprobe. Das rechte sah etwa zehn Meter weit, das linke in die vernebelte Ferne über hundert, bis ans Ende meiner Strecke. Man kann also noch leben, der Körper sagt noch gut vier Monate, der Geist, das wären noch 120 Nächte wie die letzte. Was also kann man noch wollen. Man geht und atmet noch zwischen Nein, Ja. Und Ja und Nein. So bin ich nun zurück, bin froh, dass ich die Buchstaben auf meiner großen Tastatur noch sehe, auch bediene. Kontrolllesen unmöglich. Ich werde fortan einfach drauflosschreiben müssen. Ich werde und bin wohl schon eine Buchstabenfabrik.
10. November 2020
Der dunkle Tag draußen bedrängt die Seele und den Leib. Ich komme mir schon vor wie ein Gespenst, das noch durchs Haus tappt, an den Zimmern vorbei, die vor Leere und Kälte gähnen, auf Leben warten, das ich nicht mehr geben kann. Das Haus ist ein Gebäude, in dem man sterben kann und noch nicht kann.
11. November 2020
Seit ich täglich meine »Strecke« mache, treffe ich den großen weißen SUV. Er steht da wie ein deutliches Signal: »Hier ist Hilfe. Hier wohnt Frau K.« Frau K. war eine flinke kleine, hilfreiche Frau, wir sind seit vierzig Jahren gute Nachbarn. Frau K. lebt in dem großen Haus seit fast dreißig Jahren allein, die drei Kinder sind seit langem weg, kommen jetzt wieder öfter zu Besuch. Ich habe mit Schmerzen das elende Sterben ihres tüchtigen Mannes gesehen. Er saß zuletzt nur mit verbogenem Körper im Rollstuhl. Jetzt kommt sie nur noch im Rollstuhl auf die Straße, die Kroatin ist bei ihr, Tag und Nacht. Ich sehe an ihr, was mir noch passieren kann. Wenn ich sie bei ihrer schwierigen Ausfahrt treffe, denke ich immer, was mag sie von mir denken, wenn sie mich zwar stockgesichert, aber doch noch behenden Schrittes sieht. Ich denke oft, wie sie sich durch den Tag quälen muss. Sie duldet und hat wohl eine unendliche Geduld. Sie ruht wohl in einem festen Glauben. Sie ging immer pünktlich zur Kirche mit katholischer Inbrunst. Sie hielt immer ihr Gesang- oder Gebetbuch vor sich im gebeugten Arm. Das tröstet mich für sie. Die immer hilfsfreudige Frau wird ein großes Begräbnis haben im Dorf. Wie mag ihr Gott aussehen? Der uralte Mann im Himmel? Und meiner? Ich gehöre ja noch zu den Jahrgängen, die im Kindergottesdienst und in der Schule in Luthers Gläubigkeit erzogen wurden, gehöre heute noch zu einer tätigen Gemeinde, zahle unverdrossen die Kirchensteuer, weil ich sehe, wie vielen Menschen sie doch immer noch Zuflucht und Hilfe ist. Ein geistiges, soziales System. Und habe doch immer ohne Kirche und gottesfern gelebt. Fern von den Bindungen bei Gryphius. Ich habe jetzt Zeit für andere Gedanken und Gefühle.
12. November 2020
Wenn ich morgens meine zwölf verschiedenen Tabletten schlucke, die mich, scheint es, doch am Leben erhalten, wundere ich mich, wie man mit Chemikalien auf die Defizite des Körpers antworten kann, wie Körper aufeinander reagieren, sich zusammenfinden oder abstoßen. Was die Natur alles bereitstellt, damit der Mensch und die anderen Lebewesen sich ernähren können, auf ein Zeit- oder Lichtkommando die Blätter von den Bäumen fallen und wieder ergrünen. Wie diese Welt, die seit vielen Millionen Jahren besonnt und festgehalten im Weltall treibt, jetzt sogar Erfindungen wie das Internet, ganz neue Systeme gesellschaftlichen Verhaltens erlaubt. Eine große umfassende Konstruktion. Muss man da nicht folgern dürfen, was Friedrich Schiller so sagte: »Brüder überm Sternenzelt / muss ein guter Vater wohnen.«17 Das »Muss« betont als Folgerung, dass das nicht alles Zufälle sind, die wir als Leben erleben. Gott als Konstrukteur. Es ist denkbar, aber längst zerdacht. Den Gottesbeweisen ist widersprochen worden: »Gott ist tot.« Der Ruf ging über die Welt, und doch gibt es das Verlangen, aus dem nicht nur Frau K. von gegenüber lebt, in Gottes Hut zu sein, welches die Kirchen erhält und außerhalb der Kirchen in Abtrünnigen weiterlebt und immer wieder an den frühen Satz des Augustinus erinnert: »Credo quia absurdum est«18 – »Ich glaube, obwohl es absurd ist«. Der Satz hat mich einmal überfallen und ist jetzt wieder da. Ich war begeistert, als das Absurde Thema auf dem Theater wurde, in vielen Spielarten sichtbar. Selbst Samuel Beckett zählte dazu. Weil er immer wieder das »Trotzdem« zum Thema machte, hatte er noch ein »Gegenüber«. Ich bitte abends wieder um eine gute Nacht und spreche von Lebensdank.
12. November 2020
Vielleicht werde ich ja doch noch ein Neuer Mensch. Ich merke mit Dankbarkeit an mir doch eindrückliche Veränderungen. Das sind wohl nicht die unmittelbaren Folgen der 16 verschiedenen Tabletten, die ich am Tag schlucke. Mit denen jetzt mein Doktor mich ja einigermaßen wieder hingekriegt hat. Aber vielleicht sind es Nachwirkungen. Seit Tagen gehe ich ja leichter meine »Strecke«, gestern Abend sogar zweimal. Die Veränderungen, die ich meine, laufen eher über den Gaumen, den Appetit, die Esslust, also die Ernährung. Zuerst merkte ich es an der Schokolade. Ich habe früher gern Schokolade gegessen, oft eine ganze Tafel Vollmilch Nuss, wenn es beim Artikelschreiben nicht voranging. Die Schokolade hatte den Whisky der Anfangszeit abgelöst. Neulich konnte ich im Kaffeeladen einer Luxusschokolade nicht widerstehen, edel verpackt, teuer. Ich hatte bittere erwischt, was ich erst auf der Zunge merkte. Ich mag bittere Schokolade nicht, das Leben ist doch bitter genug. Ab und zu gönnte ich mir eine Praline, nach dem Mittagessen, zur Einleitung des Mittagsschlafs. Damit ist es ab heute und fortan auch vorbei. Die Pralinen heute waren sehr viel besser als die von neulich, aber der Magen und das mit ihm verbundene Lustgefühl haben Schluss gemacht. Mir ist elend und ich kriege den Geschmack nicht mehr weg. Früher ging das mit einem Schluck Campari. Auch das hat wohl ein Ende. Nicht, weil er die Schokolade nicht mehr schafft, auch neulich die Kartoffelpuffer nicht mehr, denen ich mit zu viel Rapsöl eingeheizt hatte. Mit Hering in Tomaten wird es nicht anders gehen. Ich habe aber noch zwei Dosen im Kühlschrank. Cora war heute Morgen da und machte zu Mittag frisch Quiche Lorraine. Die Quiche war wunderbar, ich habe sie sehr gelobt. Sie sagte darauf zu mir: »Du musst öfter Frisches essen, nicht immer Gefrorenes aus dem Kühlschrank, das ist auf die Dauer nicht gut.« Genau das hatte ich vorhergesagt: »Die Pfanne mit der Quiche war zu gut gefüllt.« »Da hast du für die nächste Woche noch was. Ich frier es dir ein.« Die Folgerichtigkeit küchenbezogener Handlung ist manchmal brüchig. Aber ich brauche keine Angst zu haben. Mein Gefrierschrank, den Dumitru neulich entfrostet hat, ist wieder ganz voll. Neulich habe ich mir mal ein frisches Wiener Schnitzel gewünscht, wie es die immer so gut im Berliner Savoy oder im Wiener Beisl in der Kantstraße gab, schön dünn und knusprig. Ich will jetzt auch keine deutschen Schweinen entnommenen Kalbsschnitzel mehr. Soweit der Befund, weswegen ich auf den Neuen Menschen in mir warte. Ich entziehe mich alten Lebensformen.
Als Cora heute Morgen kam, zog ich wieder das frischgebügelte blaue Oberhemd mit den dicken Knöpfen an. Sie sieht mich gern in Blau. »Das macht dich jung.« Als sie nach der Quiche Lorraine nach dem Mittagessen ging, schloss ich gleich meinen Tagesspaziergang an. Die »Strecke« tausendzweihundert Schritte. Bei tausend fange ich, der Steigung wegen, zunächst noch sanft, immer an zu schwitzen. Als ich mich nach der Heimkunft zum verdienten Mittagsschlaf hinlegte, musste ich nach zehn Minuten doch wieder raus, total verschwitzt. Ich musste gleich unter die Dusche, mittags um zwei, mit der halben Quiche Lorraine im Leib. Jetzt warte ich darauf, ob das der Anfang vom Neuen Menschen in mir ist, der sich so vielfach ankündigte. Also, bitte keine Schokolade mehr.
12. November 2020
Es gibt noch andere Knöpfe, die einen aufregen und zur Verzweiflung bringen können. Es sind nicht nur die dicken Hemdknöpfe. Ich habe vor Jahren ähnlich, aber anders, denselben Kampf mit Manschettenknöpfen geführt. Meine liegen wohl schon über ein Jahrzehnt oben im Schrank. Ich habe das Manschettenknopf-Zeitalter damals für mich beendet, werde aber gelegentlich daran erinnert. Manschettenknöpfe am frisch gebügelten Hemd zierten ja einst den Mann. Ich sah neulich ein Foto von Friedrich Merz. Seine Manschettenknöpfe strahlten mir entgegen. Ich dachte sofort, das ist Wahlkampf, er will demnächst die CDU führen und gibt Signale an Mitglieder und solche, die es werden wollen: Ich bin konservativ und von der edlen Sorte. Wenn ich aus Versehen beim Suchen nach einem frischen Hemd eines von meinen Manschettenhemden, die vor sieben oder neun Jahren frisch gebügelt wurden, greife, zeigt sich mir die vergrabene Zeit und ich denke an die schönen und einmal sehr teuren Manschettenknöpfe, die wir frohgemut in Hamburg an der Alster erstanden. Aber von den körperbezogenen Knöpfen wollte ich gar nicht sprechen. Mit den technischen wird es immer schwieriger, obwohl mir der Verkäufer beim Erwerb eines Diktiergeräts, das ich vorsichtshalber wegen zunehmender Schreibschwäche erstand, sagte: »Das ist ganz einfach, Sie müssen nur hier drücken.« Die zwei Knöpfe meiner Spülmaschine beherrsche ich schon lange, auch am Elektroherd, und verwechsle doch zunehmend vorne und hinten. Die Waschmaschine konnte ich, solange ich nur Hemden weißwusch. Meine Wäschelage ist komplizierter geworden. Handtücher, Betttücher, Schwarzwäsche, Küchentücher. Derselbe Knopf hat verschiedene Stellungen. Man muss neue Stellungnahmen lernen. In der Mikrowelle habe ich schon zwei Schutzhauben für das Mittagessen versengt, weil ich auf Grill stellte. Ich dachte, Grill haben wir nur auf der Terrasse. Ich habe meine alte Hi-Fi-Anlage nach zwanzig Jahren wieder in Betrieb nehmen wollen. Ich drückte alle Knöpfe vom Plattenspieler, CD-Player, Powertaste, R und Kassette. Es gibt einen Knopf als Schalter, den man fünfmal nach unten oder nach oben drehen muss und dabei ausschalten, was man nicht braucht, mit Druckknopf links. Fünf Wochen, dann habe ich nach Hilfe gerufen, an Dumitru, und begriffen. Seine Zeichnung von den Druck- und Schaltstellen liegt noch immer bereit. Jetzt aber der Backofen. Ich hatte mich in meinem Alleinsein schon zum absoluten Mikrowellisten vorgearbeitet. Jetzt dringt eine alte Freundin auf mich ein: »Du nimmst besser den Backofen.« Ich habe es zweimal versucht und bin dreimal gescheitert. Ich kann nicht mehr lesen, was was ist. Statt den Gemüseeintopf zu kochen, wundere ich mich, dass er nicht warm wurde. Der Schalter stand auf Auftauen. Die Enteisung meines Nudelauflaufs verendet fast in Ober- und Unterhitze. Beim dritten Mal wollte ich üben, vergaß auszuschalten und verbrannte mir, als ich’s merkte, meinen vierten Finger. Ich habe mittags fast eine Viertelstunde mit Cora geübt. Auftauen links unten und Oberhitze rechtsrum dreimal. Hoffentlich behalte ich’s. Unerbittlich vor dem Herd sitzen, eine Einstellung wie nach einer Lebensgarantie suchend. Mir brennt jetzt noch das Herz.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.