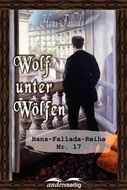Kitabı oku: «Der eiserne Gustav», sayfa 5
15 Der Juwelendiebstahl
Eva hatte es nicht eilig gehabt mit ihrem Matjeskauf, sie war durch den schönen Junivormittag gebummelt, am Schloß vorbei, wo die Leute schon wieder in dicken Klumpen standen, auf den Kaiser wartend …
»Doof sind die!« entschied Eva. »Es weht ja keine Kaiserstandarte vom Schloß. Seine Majestät ist doch auf Nordlandfahrt – die werden sich schön die Beine in den Bauch stehen!«
Dann war sie über die Linden gegangen, war in die Friedrichstraße eingebogen und, langsam immer weiter bummelnd, war sie bis zum Warenhaus von Wertheim gekommen.
Eva hatte nur ihre eine Mark bei sich, sie hatte nicht die Absicht, etwas bei Wertheim zu kaufen. Aber sie ging und sah, sah und ging. Ihre Augen leuchteten: Dieser Anblick von Seide und Samt, diese Überfülle, dieser quellende Reichtum berauschten sie. Treppauf und treppab lief sie, wie sie ihr Einfall führte. Am Ende war es gleich, ob sie Kleider oder Porzellan, ob Thermosflaschen oder Hüte ansah. Nicht das einzelne berauschte sie, sondern die Fülle, Prunk und Reichtum – siebenhundert Bilder, Hunderte von Servicen …!
Schließlich hatte sie sich in stillere Bezirke verloren, weniger Menschen waren um sie, das Licht schien gedämpfter. Sie war in der Schmuckwarenabteilung. In den Vitrinen glänzte es matt und heller, sie beugte sich über die Kästen, sie atmete rascher. Sanfter Schein von Gold, blaues und grünliches Blitzen von Brillanten – sie schossen ihre kleinen Strahlenbündel direkt in sie hinein –, oh, so etwas einmal zu besitzen! Uhren über Uhren, aus Gold, so zierlich, so klein! Ganz schmale Ringe, aber mit einem Stein, größer als eine Erbse! Silbertabletts, mit aufgelegten Ranken, man sah förmlich, wie schwer sie waren – und sie konnte mit all ihrer Schlauheit an den Matjesheringen höchstens zwanzig Pfennig Schmu machen!
Sie seufzte schwer.
»Na, Frollein«, sagte eine recht freche Stimme neben ihr. »Janz hübsche Schosen, wat?«
Sie sah hoch, mit all der Abwehrlust, die in jedem Großstadtmädchen bei jeder überraschenden männlichen Anrede wach wird. Aber gleich wurde sie unsicher. Der junge Mann mit dem schwarzen Bärtchen, der da neben ihr an der Vitrine stand, konnte auch ein Verkäufer sein. Er trug weder Kreissäge noch Panama, und 1914 trugen die Männer alle einen Hut auf dem Kopf, oder doch wenigstens in der Hand.
»Ich kaufe nichts«, sagte sie für alle Fälle abweisend.
»Wat macht denn det?« fragte der Jüngling wieder mit seiner frechen Stimme, bei der es sie wie Abwehr und doch nicht unangenehm überlief. »Ansehen kostet nischt und macht Vajniejen. Aber, Frollein«, sagte er überredend, »nu stellen Se sich mal vor, ick bin der dicke Wertheim – sicher isser dick! –, un Sie sind mein Frollein Braut. Un ick sare zu Ihnen: ›Such dir mal aus, mein Schatz, wat dein Herz bejehrt.‹ Wat würd’ste dir denn da aussuchen, Mächen?«
»Sie sind ja komisch«, sagte Eva. »Was fällt Ihnen denn ein, mich so einfach zu duzen?«
»Aba, Frollein – ick habe Ihnen doch jesacht, ick bin der dicke Wertheim, un Sie sind meine Braut – zu seine Braut sacht man doch du …«
»Sie haben wohl Quasselwasser getrunken, daß Sie auf nüchternen Magen soviel reden?! Wieso sind Sie denn so aufgeregt?«
»Icke aufgeregt? Nich de Bohne! De Aufrejung kommt noch, aba bei de andern! – Also, Frollein, wie is et mit ’nem kleinen Brillantschmuck, vorne lang mit ’ne Bommel un hinten mit ’ne Schließe aus Brillanten?«
»Das ist doch bloß was für ’ne Olle«, sagte Eva amüsiert, obwohl sie fühlte, daß mit dem jungen Mann nicht alles in Ordnung war. »Nein, wenn ich was möchte, dann möcht ich so’nen Brillantring, dort im Kasten sind sie …«
Sie ging weiter, an einem Verkäufer vorbei, der sich gelangweilt seine Finger beschaute, denn daß dies Pärchen keine Kundschaft wurde, war klar. »Sehen Sie, so ein Ring …«
»Ganz hübsch, det Dingelchen«, sagte der Jüngling gönnerhaft. »Aber, Frollein, wenn Sie meine Braut wären, würd ick Ihnen so’nen Tinnef nich schenken …«
»Das glaube ich!« lachte Eva. »Soviel Goldfüchse, wie der kostet, haben Sie nicht Haare in Ihrem Bart!«
»Hab ick nich? Na, denn will ick Sie mal sagen, Frollein, det Sie mir mit Ihrem Brillantenverstand leid tun können. Det is nämlich bloß Simili, det is bloß Tinnef, det is ein Diamant aus Jlas, verstehn Sie nu?«
»Reden Sie doch keinen Kohl …«
»Die richtigen Sachen will ick Ihnen mal zeigen, Frollein, sehn Se hier, in diesem Kasten, det sind Steine! Kieken Se mal den hier, der so jelblich aussieht, un wenn Se von der Seite kieken, denn blitzt er rot – der hat seine sieben Karat, und lupenrein! Und der hier …«
»Reden Sie sich bloß nicht in Brand!« spottete Eva, war aber schon angesteckt von der Begeisterung des jungen Mannes.
»Und dieser hier – Jott, Frollein, wat hier im Kasten liecht, wenn Sie und icke, wenn wir det hätten …«
»Wir haben’s aber nicht! Und wir kriegen’s auch nicht!«
»Det saren Se nich, Frollein! Manchmal kommt es anders, un manchmal, als man denkt. – Ne schöne Markttasche haben Se, da jeht wat rin. Und wenn Se mal loofen müssen, denn loofen Se ooch, wat haste, wat kannste …?«
»Was quasseln Sie denn so komisch?« fragte Eva argwöhnisch. »Sie haben doch nicht schon einen gehoben?«
»Sehn Se da den Verkäufer, Frollein?« fragte der Mann mit einer vor Aufregung ganz heiseren Stimme. »Der pennt jleich in. Können Se de Uhr über seinem Kopp erkennen? Wat is denn de Uhr? Ick habe nämlich so’ne schlechten Oojen. Nee, so müssen Se sich stellen, wenn Se de Uhr sehen wollen …«
Von der Aufregung des Mannes ging etwas Ansteckendes aus. Fast wider Willen stellte sich Eva so, wie er ihr gesagt hatte, die Uhr war wirklich schlecht zu erkennen, sie kniff die Augen ein …
Neben sich hörte sie ein Prasseln, ein Klirren … Sie sah den Verkäufer schreckhaft zusammenfahren, auch sie fuhr herum …
»Loof, Mächen, loof!« rief die heisere Stimme direkt neben ihr …
Wie ein Schattenbild, wie etwas ganz Unwirkliches sah sie die zertrümmerte Scheibe der Vitrine, eine Hand, die schmuckgefüllt herauskam …
»Renne doch, Dumme!« rief er wieder und stieß sie direkt gegen den hinzueilenden Verkäufer. Der Verkäufer griff nach ihr. Ohne zu wissen, was sie tat, schlug sie nach ihm, lief, mehr Menschen kamen, sie huschte um eine Vitrine, stolperte eine Treppe mit fünf, sechs Stufen hoch, warf eine Schwingtür auf …
Hinter ihr schrien jetzt viele Stimmen: »Haltet den Dieb!«
Eine Glocke schrillte …
Sie war in der überfüllten Lebensmittelabteilung. Erschreckende Gesichter sahen ihr entgegen. Jemand faßte nach ihr, aber sie wich der Hand aus, sie schob sich hinter eine dicke Frau, kam in einen anderen Gang, ein Stoß Konservenbüchsen verdeckte sie …
Sie lief, hier war eine Treppe, sie warf die Tür zur Treppe auf, huschte die Treppe hinunter, ein Stockwerk, zwei Stockwerke tiefer …
Sie stand und lauschte. Kamen sie? Wurde sie verfolgt? Warum war sie geflohen? Sie hatte doch nichts getan! Dieser ekelhafte Kerl – solche Unverschämtheit, ausgerechnet sie als Schutzschirm für seinen Diebstahl zu benutzen! Dieser Verbrecher!! Wenn sie ihn je wiedersieht, wird sie schreien, sie wird die Leute zusammenbrüllen, die Schutzmänner sollen ihn an die Kette legen – und dann wird sie ihm in sein freches Gesicht lachen! Sie, die vollkommen Schuldlose, in seine Schmutzereien zu ziehen! Ist so etwas erhört?!
Ein schwerer Schritt kommt langsam die Treppe hinunter – und sie flüchtet wieder. Sie stößt die Schwingtür auf, geht langsam durch ein paar Abteilungen und kommt dem Ausgang nahe. Aber plötzlich überfällt sie eine Angst, sie ist ja kenntlich, sicher ist ihre Beschreibung schon allen Portiers telefoniert, sie hat ja die Markttasche aus schwarzem Wachstuch! Warum sieht die Verkäuferin sie dort so an?
Sie bezwingt sich. Ich habe doch nichts getan, beruhigt sie sich. Sie fragt die Verkäuferin: »Frollein, wo ist denn hier die Toilette?«
Die Verkäuferin sagt ihr Bescheid, sie geht schon zur Toilette, aber dann überlegt sie es sich anders. Die Treppe, die gute Treppe von der Lebensmittelabteilung hat sie schon einmal gerettet, lieber geht sie zu ihr zurück!
Die Treppe ist jetzt belebt; Leute gehen aufwärts und abwärts. Aber sie hat Geduld. Sie setzt den Fuß auf eine Stufe und knotet an ihrem Schuhband …
Dann ist sie endlich unbeobachtet, sie nimmt die Markttasche. Sie weiß natürlich, daß innen auf das Futter der Name »Hackendahl« geschrieben ist, den muß sie ausreißen!
Aber sie hält inne! Es leuchtet sanft in der Tasche, es blitzt, es strahlt …!
Sachte setzt sie die Tasche auf die Treppe hin – oh, dieser Schurke, dieser Lump! Er hat sie völlig zu seiner Mitschuldigen gemacht, er hat einen Teil seiner Beute in die Tasche geworfen – wenn man sie gefaßt hätte! Nie hätte sie sich freischwatzen können! Ach, wenn sie ihn nur hier hätte, ihn mit seinem quasseligen Gerede von Markttasche und Laufen – so ein Schwein!
Jemand kommt eilig die Treppe herunter. Sie späht: Es ist ein Mann in der braunen Uniform des Warenhauses. Sie knüpft an ihrem Schuh; sie hat rasch ihren faltigen Rock über die Tasche gebreitet …
Der Uniformierte sieht sie von der Seite an – hat er sie argwöhnisch angesehen? Jedenfalls wird es höchste Zeit, aus dem Haus zu kommen. Es müssen jetzt mindestens zehn Minuten seit dem Diebstahl vergangen sein, wahrscheinlich steht schon Polizei an allen Türen … Kaum hat sie die Schwingtür unten klappen gehört, stopft sie den Schmuck in die Tasche ihres weißen Unterrocks. Sie hält sich nicht damit auf, ihn näher anzusehen, und nur als sie den Brillantring mit dem gelblichen Stein faßt, lächelt sie. So ein ausgekochter Lump!
Dann reißt sie den Namen aus und geht ohne Tasche. Geht durch das Erdgeschoß, an den Verkaufstischen, deren Glanz blaß und gewöhnlich geworden ist, vorüber, an dem Portier vorbei, mit dem Strom der Besucher auf die Straße hinaus …
Draußen. Gerettet! Frei!
16 Zwei Hackendahls im Gymnasium
Als die Jungen zur Elf-Uhr-Pause auf den Hof des Gymnasiums kamen, sahen sie natürlich die Droschke erster Güte draußen halten. Keiner beachtete sie, Porzig bloß, der bekannte Hämling, konnte sich nicht entbrechen, vernehmlich zu bemerken: »Konkurrenz unseres geliebten Bubi! Hackendahl, nimm die Hacken dahl vor so viel väterlicher Pracht! Hackendahl, dekliniere equus, der Zosse …«
»Stänkere nicht, Porzig!« warnte Hoffmann.
»Es ist sogar meines Vaters Wagen!« sprach Heinz Hackendahl. »Denkst du, deswegen schäme ich mich?! Keine Bohne!«
»Siehe da!« rief Porzig und imitierte den Lehrer des Griechischen. »Traun fürwahr, Hackendahl! Und beruht das Gassengerücht auf Wahrheit, daß der Kaiserliche Marstall mit Eurer väterlichen Gestrengen wegen Ankauf jenes schimmernden Rosses in Verhandlung steht?«
Der Schimmel, der Liebling des Vaters, sah wirklich ungewöhnlich kläglich aus. Nach der Jagd am Vormittag war er nur noch die Ruine eines Pferdes. Die Jungen der Obertertia sahen erst auf das Pferd, dann auf die beiden Gegner. Heinz Hackendahl und Hermann Porzig waren geschworene Feinde, ihre ständigen Plänkeleien erfrischten die Klasse.
»Krächze nicht, Hermann, mein Rabe«, bemerkt Bubi Hackendahl kühl. »Die Porzen sind stinkende Cojoten – beim Kriegsgeschrei verkriechen sie sich in die Wigwams der Squaws!«
(Dies war eine Reminiszenz aus dem geliebten Karl May.) »Wir sehen nirgend den glänzenden Lackpott unseres Patris equorum, dieser Zierde der Droschkenfahrer-Gilde!« rief Porzig mit gut gespielter Besorgnis. Der Kreis der zuhörenden Jungen hatte sich wesentlich vergrößert und stachelte die Phantasie des Spötters. »Wo weilt er? Warum schützt er den Zossen nicht vor den Schlingen der Wurstschlächter? Kippt er etwa – traun fürwahr! – in einer Stehbierhalle ein Kümmelchen? Sprich, legitimer Sohn einer Droschke!«
Es war ein unausrottbares Märchen auf der Penne, daß der Alte Fritz seinem Kammergericht einen silbernen Nachttopf übermacht hatte – in Wut über das Urteil seiner Räte: für den Müller, gegen den König. Hermann Porzig war der Sohn eines Kammergerichtsrats, also antwortete Heinz Hackendahl: »Der glänzende Lackpott meines Vaters erblaßt vor dem Silberschein eines königlichen Nachtgeschirrs. – Ist es wahr, daß dein Vater dieses Gnadengeschenk jeden Sonnabend zu scheuern hat – und du darfst auf die Bürste spucken, Edeling?«
Ein Schauer des Schreckens ging durch alle beim Anhören einer so schweren Beleidigung. Wirklich lief Porzig sofort rot an – er teilte Spott leichter aus, als er ihn ertrug.
»Nimm den Nachtpott zurück!« schrie er. »Er ist eine Beleidigung des ganzen Kammergerichtes.«
»Nie!« rief Heinz Hackendahl. »Du hast meinen Vater beleidigt!«
»Du aber das Kammergericht! Revozierst du?«
»Nie!«
»Es ist also Schuß?«
»Schuß!«
»Schiß?«
»Schiß!«
»Verschiß?«
»Großer Verschiß – bis einer um Gnade bittet!« beendete Heinz den traditionellen Herausforderungsgesang der Penne. Er sah sich um. »Hoffmann, du bist mein Sekundant!«
»Ellenberg, du meiner!«
»Laßt es für nachher!« bat der besonnene Hoffmann. »Wir haben nur noch drei Minuten Zeit.«
»In einer Minute winselt er!«
»Sein ungereinigter Pestatem soll uns nicht die Mathese verpesten!«
Sie hatten sich schon ihrer Jacken entledigt, beide brannten auf den Kampf.
»Eins! Zwei! – Drei!« riefen die Sekundanten. Mit winklig gebogenen Armen näherten sich die Streiter einander, tasteten sich ab, faßten sich, lehnten Brust an Brust, Stirn gegen Stirn – und einen Augenblick später rollten sie im Sande des Schulhofs.
»Nehmen Sie eine jugendliche Unbesonnenheit nicht zu schwer, Herr Hackendahl«, hatte oben in seinem Studierzimmer der Direktor den besorgten Vater gebeten. »Der Satz: ›Jugend hat keine Tugend‹ gilt heute mehr denn je.«
»Geld stehlen ist nicht unbesonnen, es ist schlecht«, hatte Hackendahl widersprochen.
»Der heutigen Jugend ist ein Hang zur Genußsucht eigen, der unserer älteren Generation fremd war«, dozierte der Direktor. »Eine lange Friedenszeit hat die jungen Leute schlaff gemacht …«
»Wir müßten wieder einmal einen ordentlichen Krieg haben«, rief Hackendahl.
»Um Gottes willen! Nein! Ahnen Sie denn, welch schreckliche Ausmaße ein moderner Krieg nehmen könnte?!«
»Wegen solch einem Völkchen auf dem Balkan? Das ist in sechs Wochen ausgestanden – und hat den jungen Leuten doch gutgetan. Wie ein Stahlbad.«
»Die ganze Welt liegt voller Zündstoff«, antwortete der Direktor. »Alles schaut mit Neid auf das immer stärker werdende Deutschland und unsern Heldenkaiser. Die ganze Welt würde über uns herfallen.«
»Wegen ein paar Serben, die man kaum auf der Landkarte findet?!«
»Unseres wachsenden Reichtums wegen! Unserer Stärke wegen! Wegen unserer Kolonien! Wegen unserer Flotte! – Nein, Herr Hackendahl, es ist, verzeihen Sie, fast ein Frevel, sich einen Krieg zu wünschen, bloß weil der Sohn eine Dummheit begangen hat.«
»Er müßte militärische Zucht haben!«
»In knapp einem Jahr hat er sein Abiturium gemacht, dann können Sie ihn sofort dienen lassen«, sagte der Direktor überredend. »Nehmen Sie ihn jetzt nicht übereilt aus der Schule, aus einem Bildungsgang, der ihm alle Möglichkeiten erschließt.«
»Ich werde es mir überlegen«, sagte Hackendahl widerstrebend.
»Überlegen Sie nicht länger!« rief der Pädagog dringend. »Sagen Sie gleich ja! Versprechen Sie es mir.«
»Ich muß erst sehen …«
»Eben das sollen Sie nicht. Wenn Sie ihn erst sehen, in seinem Eigensinn, in seinem Trotz, werden Sie wieder anderen Sinnes werden. Wie konnten Sie ihn aber auch in einen Kohlenkeller sperren – ist das denn Pädagogik …?!«
»Mich hat man in meiner Jugend auch nicht mit Glacéhandschuhen angefaßt, und ich habe nie Geld gestohlen!«
»Sind Sie denn ein Strafrichter, oder sind Sie ein Vater? Sie werden sich auch schon verbotene Wünsche erfüllt haben. Wir Menschen sind alle schwach und ermangeln des Ruhmes – nun, das wissen Sie selbst. Also sagen Sie ja.«
»Wenn er um Verzeihung bittet!«
»Herr Hackendahl! Wird er denn jetzt um Verzeihung bitten, jetzt, wo Sie ihn aus dem Kohlenkeller herauslassen?! Man muß doch das Erreichbare verlangen!«
Der eiserne Gustav stand schwankend. Von dem Schulhofe her drang verworrenes Getöse.
Der Direktor sagte halblaut: »Es ist möglich, daß Erich als Erster sein Abitur macht – Primus omnium sagen wir dafür. Erster von allen – es ist ein hoher Ruhm!«
Gustav Hackendahl lächelte. »Mit Speck fängt man Mäuse, Herr Direktor, nicht wahr? Na schön, will ich einmal sehenden Auges in die Falle gehen. Der Junge kommt morgen wieder zur Schule.«
»Das ist ein Wort, Herr Hackendahl!« rief der Direktor erfreut und reichte dem Vater die Hand. »Sie werden es nicht bereuen … Was ist das für eine Ungehörigkeit?!«
Er fuhr herum und lief zum Fenster. Ein brausendes Geschrei drang vom Schulhof herein, brüllende, johlende, schreiende Jungenstimmen!
»Evoe Hackendahl! Hackendahl hoch!«
Porzig hatte um Gnade gebeten, Bubi war Sieger. Im »Schwitzkasten« fast erstickt, konnte Porzig nur röcheln.
»Du nimmst den Lackpott zurück? – Den Zossen? – Die Pferdewurst? – Stehbierhalle und Kümmelchen? – Alles?«
Porzig grunzte jedesmal nur, der Kreis tobte Beifall.
»Es scheint«, hüstelte der Direktor am Fenster, »ein kleiner Streit des anderen Sohnes Hackendahl zu sein. Nein, wir wollen uns nicht am Fenster sehen lassen – oft ist es besser, den Anschein zu erwecken, daß man nichts gesehen und nichts gehört hat.«
»Der verfluchte Bengel hat sich die Hose zerrissen«, brummte hinter der Gardine Hackendahl. »Ewig reißt er sein Zeug entzwei, und seine Mutter darf flicken.«
»Die Begabungen Ihres Sohnes Heinz liegen auf anderem Gebiet«, meinte der Direktor. »Ich möchte sagen, er ist lebenspraktischer. Man müßte vielleicht einmal überlegen, ob nicht ein Realgymnasium das Richtigere für ihn ist. Sie haben zwei gut veranlagte Söhne …«
»Es ist komisch, daß mein Dritter gar nichts abbekommen hat«, sagte Hackendahl. »Der ist bloß ’ne Suse; wo man ihn hinstellt, schläft er ein.«
»Er wird auch seine Begabung haben«, meinte der Direktor tröstend. »Man muß nur suchen. Suchen und fördern.«
»Bloß ’ne Suse«, wiederholte Hackendahl. »Keinen Kummer macht er mir, aber auch nie eine Freude. Es ist schon ein Kreuz!«
17 Die heimliche Ehe
Otto Hackendahl hatte die beiden Pferde dem Schmiedeknecht übergeben, ging nun eilig weiter, trotzdem er wußte, daß er gegen ein Gebot des Vaters verstieß: Hackendahl verlangte, daß man dem Schmied beim Beschlagen auf die Finger sah, sonst war rasch ein Huf zu tief ausgeschnitten oder ein Nagel falsch eingeschlagen.
Aber Otto hatte auch seine Heimlichkeiten, und wenn er duckmäuserig und susig war, so war er doch nicht so susig, wie sein Vater meinte. Er überließ die Pferde dem Schmied, auf zwanzig gut beschlagene kam höchstens ein vernageltes, es brauchte nicht heute zu geschehen.
Er geht eilig die Straße hinunter, und schon wie er geht, wohl eilig, aber dicht an den Hauswänden, dem Blick jedes Vorübergehenden ausweichend, zeigt sich, daß mit ihm nicht alles in Ordnung ist. Eigentlich ist er ein großer, stattlicher Mensch, der kräftigste der Brüder, kräftiger als der Vater, aber er hat keine gute Haltung, er ist ohne Energie und Selbstbewußtsein, ihm fehlt jeder Eigenwille. Es ist vielleicht wirklich, wie er zur Mutter gesagt hat: Sein Vater hat am längsten mit ihm exerziert. Darüber brach sein Eigenwille entzwei. Aber es ist wohl auch so, daß dieser Wille nie stark war: Ein kräftiger Baum wächst gegen die Winde an, einen schwachen knicken sie.
Otto schlenkert ein Paketchen in der Hand, dann merkt er, daß er damit schlenkert, und versteckt es unter dem Arm, als sei es Diebsgut. Er biegt in eine andere Straße, überquert sie und geht, sich scheu umsehend, in einen Torweg. Er überschreitet einen Hof, durchschreitet einen neuen Torweg, kommt über einen zweiten Hof, und fängt eilig an, eine Treppe zu erklettern.
Er steigt ins erste Stockwerk hinauf, ins zweite, er klettert immer weiter. Er muß hier Bescheid wissen, er sieht die Schilder an den vielen Türen nicht an. Immerzu begegnen ihm Menschen, aber die Menschen beachten ihn nicht – Otto Hackendahl hat Schutzfarbe, Mimikry, man merkt ihn kaum, so farblos ist er.
Nun bleibt er vor einer Tür stehen. Er sieht das Schild, auf dem »Gertrud Gudde, Schneiderin« geschrieben steht, nicht an. Er drückt auf den Klingelknopf, ein-, zweimal. Drinnen rührt es sich, er hört Bewegung, eine Stimme, nun lacht ein Kind, Otto lächelt.
Jawohl, er kann lächeln, nicht nur das Gesicht verziehen, sondern richtig lächeln, weil er sich nämlich glücklich fühlt. Und er lächelt noch stärker, als die Tür aufgeht, ein stolperndes Kind gegen seine Beine läuft, selig schreit: »Papa! Papa!«
Eine Frau sagt: »Du bist heute aber spät dran, Otto. War was los?«
»Und ich muß in einer Viertelstunde wieder fort, Tutti«, sagt er, beugt sich über ihren Mund und küßt ihn. »Ich habe die Pferde in der Schmiede stehenlassen – ich muß gleich wieder hin. Ja, ja, Gustäving, Papa ist ja da! Hast du schön geschlafen?«
Das Kind ist selig, er schwingt es hoch, es lacht und jauchzt. Auch die Frau lächelt, Gertrud Gudde, Schneiderin – der Direktor des Gymnasiums hat recht gehabt: Niemand ist so ohne alle Gaben, daß er nicht Glück geben kann.
Gertrud Gudde, die Arme, Kleine, Verwachsene mit der zu hohen Schulter, mit dem scharfen Gesicht, aber dem sanften Taubenblick vieler Buckliger – Gertrud Gudde, kleine, mühsame Schneiderin, sie kennt ihren Otto genau, in seiner Schwäche, seiner Entschlußlosigkeit, der Angst vor dem Vater, aber auch in seinem Verlangen, Glück zu geben.
»Aber: Was war los bei euch?« fragt sie. »Erzähl, Otto, es wird schon nicht so schlimm sein.«
»Ich habe dir auch wieder Schnitzarbeiten mitgebracht«, sagt er. »Templin wird dir ungefähr zehn Mark dafür geben.«
»Du sollst aber nicht die halben Nächte sitzen und schnippeln! Ich schaffe es auch schon so – heute habe ich vier Anproben!«
»Ja, du!« sagt er. »Gustäving – haben wir nicht eine großartige Mutti?«
Das Kind ruft und jauchzt – die Mutter lächelt. Ach, die beiden im Leben zu kurz Gekommenen, er mit dem schwachen Willen, sie mit dem verkrüppelten Körper – hier zu zweien, nein, zu dreien, in Küche und Stube, allein für sich, geben und empfangen sie so viel Glück!
»Komm, einen Augenblick kannst du dich hinsetzen. Ich habe noch Kaffee für dich, hier sind Schrippen. Los, iß! Gustäving zeigt dir unterdes, wie er turnen kann.«
Gehorsam tut er, was sie sagt. Sie hält immer irgend etwas für ihn bereit, er kann kommen, wann er will. Es ist dann so, als seien sie richtig Mann und Frau. Und er versteht das, versteht es ohne ein Wort, er ißt immer, sagt nie nein – auch wenn er noch so satt ist.
Gustäving zeigt seine kleinen Kunststücke, die Mutter ist noch stolzer darauf als der Sohn. Die Mutter, die der gerade Rücken, die festen Beine des Kindes glücklich machen, sie, die fast keinen Tag ihres Lebens schmerzfrei verbracht hat …
»Und nun erzähle, was bei euch los war …«
Er berichtet, langsam und schwerfällig. Aber Gertrud Gudde versteht ihn, sie liest in seinem Gesicht.
Und dann – sie kennt ja alle, von denen er erzählt: die Mutter, den Erich, Eva und den gefürchteten grimmigen Vater, den eisernen Gustav, auch. Sie kommt dann und wann als Hausschneiderin zu den Hackendahls, schon seit vielen Jahren, so haben sich Otto und sie kennengelernt, liebengelernt. Ohne daß je ein anderer etwas merkte, selbst nicht die listige Eva. Gertruds lebhaftes Gesicht spiegelt alles wider, was er erzählt, mit abgerissenen Ausrufen begleitet sie seine Worte: »Sehr gut. Ottchen!«– »Das war richtig, was du da gesagt hast!«– »Und du hast das Schloß gleich aufgebracht? Großartig!«
Er sieht sie an, jetzt ist er frei, er hat nun selbst das Gefühl, als habe er einiges verrichtet, er, der Getriebene, der zwischen den Mühlsteinen Zerriebene.
»Aber was wird Vater sagen, daß Erich weg ist?« fragt er schließlich. »Und Eva, die so geizig ist, was wird die für ein Geschrei machen?!«
»Eva …?! Eva kann ja gar nichts sagen, wenigstens zum Vater nicht. Es ist ja alles gestohlenes Geld, sie würde sich bloß selbst verraten! Nicht wahr?«
Er nickt langsam, jawohl, das versteht er.
»Aber der Vater – wegen Erich?« fragt er noch einmal, hoffend, daß sie ihm auch diese Last erleichtern wird.
Sie sieht ihn nachdenklich an mit ihrem sanften Taubenblick.
»Der Vater«, sagt sie – und die Gestalt des eisernen Gustav, die immer über ihrem kleinen Leben steht, richtet sich groß hinter ihnen auf. »Der Vater«, sagt sie und lächelt, ihm Mut machend, »der Vater wird sehr traurig sein – auf Erich ist er doch immer am stolzesten gewesen. Sag kein Wort gegen Erich, auch nicht, daß er Evas Geld genommen hat. Es wird dem Vater schon so schwer genug sein. Und gib ruhig zu, daß du die Schlösser aufgemacht hast, sag, hör zu, Otto, merk dir das, sag ihm: ›Ich hätte dich ja auch aus jedem Keller rausgeholt, Vater!‹ – Behältst du das?«
»Ich hätte dich ja auch aus jedem Keller rausgeholt, Vater«, wiederholt er schwerfällig. Und dann: »Aber das ist ja wahr, Tutti, das stimmt genau: Ich hätte Vater doch nicht eingesperrt gelassen!«
Er blickt sie freudig an.
»Siehst du, Otto! Ich sage ja nur, was du selbst denkst, du kannst es nur nicht so ausdrücken.«
»Aber was wird Vater dann tun, Tutti?«
»Das kann man nicht wissen, Otto, bei Vater kann man es nie genau wissen, weil er jähzornig ist …«
»Vielleicht schmeißt er mich raus. Und was dann? Sollst du mich auch noch satt machen?«
»Aber, Otto, du bekommst doch jede Stunde Arbeit! Du gingst den Tag über in eine Fabrik als ungelernter Arbeiter oder auf einen Bau als Handlanger …«
»Ja. Das könnte ich wohl. Doch, das ginge.«
»Und wir wohnten ganz zusammen, und dein Vater müßte dir deine Papiere geben, und wir könnten …«
»Nein, das nicht. Ohne Vaters Willen heirate ich nicht. Es steht in der Bibel …«
Es ist seltsam, dieser schwache Mensch ist in einem Punkt unnachgiebig: Er will nicht gegen den Willen des Vaters heiraten. Zu Anfang ihrer Liebe hat sie ihm viele Male gesagt, daß er sich die notwendigen Papiere hinter des Vaters Rücken besorgen kann, sie wird das Aufgebot bestellen. Was ändert denn eine standesamtliche Trauung, wie kann sie dem Vater weh tun, der doch nichts von ihr erfährt …?!
Aber nein! Hierin ist er unerschütterlich. Aus dem Religionsunterricht der Volksschule, aus der Konfirmandenlehre bei Pastor Klatt, aus den Urgründen seiner dunklen, trüben Seele kommt ihm das Gefühl: Es bringt Unheil, ohne des Vaters Segen zu heiraten. Er braucht des Vaters Segen. An den die anderen nie denken.
Und sie weiß das, sie hat auch das verstanden. Sie hat begriffen, daß in der Brust dieses einen verachteten Sohnes der Vater nicht nur der Gott der Rache, sondern auch der Liebe ist – daß dieser verachtete Sohn den Vater am stärksten liebt. Daß sie trotzdem immer weiter hofft auf die Trauung, nicht ihret-, sondern Gustävings wegen, der schon den Vornamen vom Großvater trägt, aber auch einmal seinen »ehrlichen« Namen bekommen soll – das kann ja nicht anders sein.
Darum ersehnt sie die Trauung. Nur darum! »Könntest du es dem Vater nicht wenigstens einmal andeuten, Otto?« hat sie oft gesagt. »Sprich doch wenigstens einmal mit mir vor seinen Augen, wenn ich bei euch auf Arbeit bin.«
»Ich will es versuchen, Tutti«, hat er geantwortet und hat doch nie auch nur einen Ansatz zum Sprechen gemacht.
Dies ist der einzige Punkt, in dem sie mit ihm nicht einig ist, den sie immer wieder zur Sprache bringt, obwohl sie weiß, daß sie ihn damit quält. Sie will es gar nicht, aber dies kommt ihr stets von neuem auf die Zunge, wie jetzt eben, ganz ohne daß sie es wollte.
Rasch sagt sie darum: »Nein, du hast recht. Grade jetzt wäre es falsch, wo Vater so viel andere Sorgen hat.«
Sie sieht vor sich hin. Schüchtern kommt seine Hand über den Tisch zu ihrer hin. »Du bist doch nicht böse?« fragt er ängstlich.
»Nein, nein«, versichert sie eilig. »Nur …«
»An was denkst du?« fragt er, als sie nicht weiter spricht. »Ich denke an den ermordeten Prinzen von Österreich«, sagt sie, »und daß die Leute meinen, es gibt Krieg …«
»Ja …?« fragt er verständnislos.
»Du müßtest doch mit in den Krieg, nicht wahr?«
Er nickt.
»Otto«, sagt sie eindringlich und drückt seine Hand. »Otto – würdest du denn auch in den Krieg gehen, ohne mich geheiratet zu haben? – Oh, Otto, ich sage es nicht meinetwegen! Aber Gustäving würde ja nie einen Vater gehabt haben, wenn dir etwas geschähe …«
Er sieht nach dem friedlich spielenden Kind hin.
»Wenn es einen Krieg gibt, Tutti, dann heirate ich dich«, sagt er. »Das verspreche ich dir.« Er sieht das Leuchten ihrer Augen, er sagt schwach: »Aber es gibt ja keinen Krieg …«
»Nein! Nein!« ruft sie hastig, selber erschrocken von den eigenen Wünschen. Nur das nicht! Nicht um den Preis!