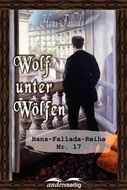Kitabı oku: «Der eiserne Gustav», sayfa 12
16 Vor dem Goldverkauf
»Es fehlt noch ein Ring. Wo hast du deinen Ring, Evchen?«
»Ich habe doch keinen Ring, Vater!« widersprach Eva.
»Natürlich hast du einen! Solchen mit einem braunen Stein. Nicht wahr, Mutter, Evchen hatte einen Ring …?«
Die Mutter saß weinerlich vor dem runden Tisch in der Wohnstube, auf den der Vater alles gelegt hatte, was an Gold im Hause war: seine geliebte dicke Uhr mit der schweren Kette; die kleine, mit Emaille verzierte Uhr der Mutter, die an einer Schleife aus Gold auf der Brust getragen wurde; eine goldene Bleistifthülse; ein Paar große Manschettenknöpfe, deren Goldgehalt nicht ganz zweifelsfrei war. Ein Goldkettchen mit goldenem Kreuz, das die Sophie zur Konfirmation bekommen hatte. Die ehemals dicken goldenen Eheringe, die Zeit und Arbeit glatt und dünn geschliffen hatten. Eine goldene Brosche mit einer daranhängenden – falschen – kleinen Perle. Sieben goldene Zehnmarkstücke, fünf zu zwanzig Mark.
An den Mauern, auf den Litfaßsäulen klebten überall die Plakate: »Gold gab ich für Eisen! Bringt euer Gold zur Goldankaufstelle!« Die Zeitungen schrieben alle Tage davon, vielfach bewundert gingen Herren herum, die schon die schmale Eisenkette statt der goldenen auf der Weste trugen.
»Kein Stück Gold bleibt im Haus!« rief Vater Hackendahl. »Wir müssen alles abliefern! Haben wir nicht noch was? Mutter, hattest du nicht mal so kleine Dinger in den Ohren, keine Ohrringe, mehr wie Knöpfe – ich erinnere mich doch!«
»Ach, Vater«, jammerte die alte Mutter, »die kleinen Dinger – laß sie mir doch! Ein bißchen muß man doch aus seiner Jugend für sich behalten dürfen. Sie wiegen rein gar nichts, so eine Kleinigkeit kann der Regierung doch auch nichts helfen …«
»Nichts da!« entschied Hackendahl. »Wir sollen unser Gold der Regierung geben, und da tun wir’s auch! Ich versteh dich nicht, Mutter!. Du hast den Erich und den Otto hergeben müssen, und nun weinst du wegen so ein paar Golddingern!«
»Ich weine aber auch wegen Erich und Otto«, sagte die Frau und stand mühsam auf. »Immer, wenn ich den Postboten auf der Treppe höre, muß ich weinen …«
»Ich weiß ja, Mutter!« sagte er begütigend. »Es ist nicht leicht, aber es wird doch getan, damit wir siegen. Und wir kriegen Eisen dafür, Mutter! Wozu heiß ich denn der eiserne Gustav?! Eisen paßt viel besser zu uns als Gold.«
»Ich geh ja schon, Vater!«
Und sie ging in die Schlafstube. Der Vater sah sich um, Eva war auch gegangen. Nein, er hatte Eva nicht vergessen, er sah den Goldhaufen an: Der Ring war nicht dabei. Man muß alles hergeben, dachte er. Wenn man das Liebste für sich zurückbehält, dann ist es ja kein Opfer.
Er horchte. Es war still in der Wohnung, aber jetzt war es immer totenstill in der Wohnung, wenn Bubi in der Schule war. Bubi war der einzige, der noch ein bißchen Leben ins Haus brachte. Totenstill! Hackendahl erinnerte sich: Früher hatte Eva viel gesungen, jetzt nie mehr. Totenstill. Und nun mußte er zu ihr rübergehen in ihr Zimmer, den Ring holen.
Hackendahl setzte sich in den Stuhl seiner Frau an den runden Tisch, er sah den Goldhaufen an. Für einen kleinen Bürger war es eine ganze Menge, was er da opferte. Aber es war nicht genug, es fehlte ein Ring, und wenn nur ein wenig fehlte, galt das Opfer nicht. Ein Opfer, bei dem man etwas ungeopfert ließ, galt nicht. Es war wie beim Militär: Eine Ordnung, die nicht ganz und gar ordentlich war, war überhaupt keine Ordnung. Und wenn nur ein Knopf eine matte Stelle hatte, wenn an der Hacke des glänzend gewichsten Schuhs nur ein Spritzerchen Schmutz saß – dann war es eben keine Ordnung.
Dazu war man da – auf der Welt, im deutschen Lande, auf dem Droschkenhof, in diesem Hause: daß man dafür sorgte, hier an der Stelle, für die Hackendahl einzustehen hatte, geschah alles ordentlich. Dann fühlte man sich wohl, dann hatte man ein gutes Gewissen vor sich, seinem Kaiser und seinem Herrgott. Man durfte eben nicht nachgeben, keine Ausnahme durfte man machen, eisern mußte man sein. Eisern!
Nachdenklich schiebt Hackendahl die Goldstücke hin und her. Er baut Türmchen aus ihnen, und dann legt er so etwas wie ein Kreuz. Ja, Otto hat schon das Eiserne – wer hätte das von Otto gedacht?! Aber es war jedenfalls ein Zufall gewesen, und kräftig war Otto ja. Das war noch ein guter Tag gewesen, da man berichten konnte: »Mein Sohn hat das Eiserne!«
Er war überall damit rumgegangen, auch in den Kneipen. Er war in letzter Zeit recht viel in Kneipen gewesen, man gewöhnte es sich an, wenn man gar nichts zu tun hatte. Rabause erledigte ja alles allein. Ein Leben lang war man immer nach aller Kraft tätig gewesen – wer hätte gedacht, daß man in einem Kriege, in einem großen Kriege, in einem Weltkriege Untätigkeit und Langeweile kennenlernen würde?!
Hackendahl sitzt mit gerunzelter Stirn da und spielt mit seinen Goldstücken. Er ist sich vollkommen klar darüber, daß weder Mutter noch Eva mit ihren Schätzen bei ihm angetreten sind, daß er aufzustehen und Dampf zu machen hat. Aber er sitzt da und kann sich nicht entschließen! Ist es darum, weil er die Auseinandersetzung mit der Tochter fürchtet? Der Ring mit dem braunen Stein – sie muß ihn doch von ihrem Kavalier haben!
Hackendahl seufzt schwer. Mit seiner großen Hand schiebt er das Gold endgültig auf einen Haufen zusammen, dann steht er auf. Er sieht sich suchend im Zimmer um, er kann sich immer noch nicht entschließen. Endlich ruft er (und er versucht, seiner Stimme den alten, befehlenden Klang zu geben): »Mutter! Wo bleibst du denn? Ich warte!«
»Ich find die Ohrringe nicht«, ruft sie zurück. »Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Es ist doch Jahre her …«
»Mach ein bißchen zu, Mutter«, mahnt er. »Bis zwölf will ich auf der Ankaufstelle sein, um eins machen die doch zu.«
»Ich such schon«, ruft sie. »Habe bloß einen Augenblick Geduld, Vater!«
In dem Augenblick könnte er zu Eva gehen. Er hat schon die Türklinke in der Hand, da hört er den Rabause auf dem Hof rufen. Er geht zum Fenster und fragt: »Was ist denn, Rabause? Wer ist denn da?«
»Es ist einer von Eggebrecht. Ich habe aber gesagt, Sie hätten keine Zeit. Sie wollten Ihr Gold abliefern.«
»Was ist denn?«
»Herr Eggebrecht ist heute früh mit einem Transport Pferde aus Polen gekommen. Sie müßten aber gleich hin – sonst wären sie wieder weg wie das letztemal.«
»Ich komme!« ruft Hackendahl, und das ist nun freilich wieder die alte kräftige Stimme des alten eisernen Gustav.
Pferde, es sind Pferde da! Seit Monaten und Monaten lauert er auf Pferde, es hat immer nicht geklappt. »Mutter!« ruft er. »Laß das mit dem Gold – oder geh meinethalben selber! Unter den Linden, in der Reichsbank, du weißt doch. Ich geh los – Eggebrecht ist mit Pferden da, aus Polen!«
»Vater! Vater!! Vater!! Du mußt mir doch Bescheid sagen! Wieviel Geld willst du denn dafür haben, und wieviel eiserne Uhrketten soll ich nehmen? Auch eine für mich?«
»Mach alles, wie du willst! Ich habe wirklich keine Zeit, Mutter! Sonst sind die Pferde wieder weg! Und ich muß Pferde haben! Ich muß!! Wo ist denn mein Bankbuch? – Evchen, gut, daß ich dich noch sehe. Der Eggebrecht ist mit Pferden da, ich muß gleich hin, sonst sind sie wieder weg. – Also deinen Ring legst du dazu, das versprichst du mir doch? Da wird ›er‹ schön mit einverstanden sein, so ein feiner Kerl, wie der sicher ist! – Na, du erzählst mir später mal alles, jetzt muß ich zu Eggebrecht …«
Er läuft die Treppe hinunter.
17 Mutter und Tochter
»Hörst du, Evchen?« fragt die Mutter, und sie lacht beinahe. »Vater läuft die Treppen runter wie ein Junger! Ja, wenn Vater was von Pferden hört …!«
»Seine Pferde gehen ihm eben über alles.«
»Er soll ruhig wieder Pferde kaufen. Wenn auch das Droschkengeschäft schlecht geht. Und manche sagen auch: Es ist überhaupt alle mit der Pferdedroschke. Aber das war ja kein Leben für Vatern – er fing schon richtig mit Bummeln an. Na, damit ist es nun vorbei, wenn er wieder Pferde kriegt.«
»Ja, wenn Vater nur wieder was zum Kommandieren hat – Pferde, Kutscher, Kinder, es ist ihm ganz gleich, nur Kommandieren muß sein.«
Die Mutter findet es ganz natürlich. »So war Vater immer, Evchen. Noch in Pasewalk, wie er ganz jung war, wenn er da mal Urlaub hatte – nicht zu ertragen war der Mann! Immer raus aus der Kammer, rein in die Stube, raus aus der Stube, rein in die Kammer … Mit dem Zollstock hat er nachgemessen, wie die Bettvorleger liegen mußten, und unserm Hänschen – wir hatten damals noch ’nen Kanarienvogel, aber das weißt du nicht mehr – hat er das Futter auf der Briefwaage abgewogen! Extra auf die Post ist er deswegen gegangen!«
»Daß du es ausgehalten hast, Mutter!«
»Aber wieso denn? Du bist ja komisch, Evchen. Vater ist doch gut – da mußt du erst mal andere Männer kennenlernen! Ihr meckert bloß immer, weil er ein bißchen scharf im Regiment ist. Aber darum müßt ihr nicht meckern, da habt ihr gar keine Ursache zu. Ihr tut ja doch, was ihr wollt! Wo hast du denn deinen Ring?«
»Ich geb ihn nicht her, Mutter!«
»Das sollst du auch gar nicht! Wo es so fein paßt, daß Vater zu Eggebrecht ist, und ich muß abliefern. Aber ich liefere nicht ab, der Weg ist mir zu weit, die ganze Frankfurter runter und über den Alex und die Königstraße und dann beim Schloß längs – nee, Kind, das ist nichts für meine Krampfadern. Geh du man, und dann erzählst du mir alles, wie es gewesen ist, und dann sagen wir Vatern, ich war da. Mußt dich nur beeilen, daß du schnell zurück bist.«
»Ja, Mutter. Ich kann ja doch auch in die Ankaufstelle in der Frankfurter gehen, es ist doch egal, wo man abliefert.«
»Nee, das mach bloß nicht! Reichsbank ist das Höchste, darauf sieht Vater, und wenn dann die Stempel nicht stimmen unter den Quittungen …«
»Ich gehe also zur Reichsbank, Mutter.«
»Dann machste dich also gleich fertig und gehst los. Und nun paß mal auf, ich habe dir gesagt, deinen Ring nehmen wir nicht, und das sollst du auch nicht, denn ich verstehe, daß ein junges Mädchen an so was hängt … Aber du mußt mir auch mehr erzählen, Evchen. Ich seh ja doch, was los ist, und paß bloß auf, daß er dich heiratet, eh was passiert ist. Mit so was versteht Vater keinen Spaß …«
»Ach, Mutter …«
»Ich weiß ja, so was erzählt eine Tochter lieber allen anderen Leuten, nur nicht der Mutter. Aber du wirst schon kommen, du wirst mir schon kommen. – Und meine Ohrringe gebe ich auch nicht, die wiegen nichts, da merkt Vater auch nichts davon … Und dann paß auf, aber du mußt mir heilig versprechen, Vater nichts zu sagen, dann nehme ich mir hier von den Goldstücken, dreie von den großen und dreie von den kleinen …«
»Ach, Mutter …«
»Das ist kein Schmu, Evchen. Die will ich nicht für mich, die will ich aufheben. Jetzt reden sie immer abliefern! Aber man weiß doch nicht, wie die Zeiten noch werden. Wo wir jetzt schon Brotkarten haben, wer weiß, was das alles noch gibt. Abliefern müssen doch nur wir Kleinen – aber wie es die Großen halten, davon hört man nichts, man denkt es sich bloß. Dem Kaiser werden sie keine Brotkarte geben, und ob er all das Gold-und Silbergeschirr aus dem Schloß abliefert … Nee, du hast recht, Kind, nu geh lieber los. Und wenn du zurückkommst, paßt du gut auf, daß du Vater nicht grade in die Arme läufst, nicht wahr?«
18 Hackendahl freut sich
Viele Hufe klapperten über das Steinpflaster des Hofes, die Mutter fuhr neugierig mit dem Kopf aus dem Fenster, trotzdem sie es gar nicht durfte. Denn Eva war noch nicht zurück von der Reichsbank.
Aber der Vater dachte jetzt nicht an Gold und Reichsbank. Fröhlich winkte er der Mutter.
»Wir haben wieder Pferde, Mutter!« rief er. »Jetzt kommt Leben in den Betrieb.«
Die Mutter schaute. Sie hatte viele Pferde erlebt auf dem Hofe; auf allen Gängen in die Stadt mit Vater hatte sie auf Pferde achten müssen. Mutter kannte Pferde. »Sind sie nicht sehr klein?« rief sie aus dem Fenster.
»Klein …?« rief Vater zurück und ärgerte sich gewaltig. »Klein …?! Kleiner als du sind sie auch nicht! – Komm, Rabause! Hilf die Pferde in den Stall bringen. Jetzt gibt’s Arbeit! Klein – die denkt, im Kriege spannen wir Elefanten vor die Droschken. – Klein …«
Er schluckte, mit neuem Zorn rief er zum Fenster hinauf: »Ich komm nicht zum Abendessen. Eßt ihr alleine – ich habe zu tun.«
»Siebzehn Stück«, sagte Rabause. »Da können wir wieder zwanzig Droschken fahren lassen – und den Schimmel und den Braunen lassen wir ein bißchen stehen, lange hätten die es nicht mehr gemacht.«
»Richtig«, lobte Hackendahl. »So habe ich es mir auch gedacht – und so ’ne Frau sagt klein!«
»Ganz so groß wie unsere alten sind sie ja wohl nicht«, meinte Rabause vorsichtig.
»Ganz so groß …«, sagte Hackendahl vorwurfsvoll. »Quatsch doch keinen Quatsch, Rabause! Richtige Ponys sind das! Russenpferde sind’s, Panjepferdchen nennt man so was! Klein? Natürlich sind sie klein. Die müssen ja klein sein, sonst kriegen wir sie nämlich nicht, sonst nimmt sie nämlich die Militärverwaltung für sich.«
»Richtig«, sagte Rabause. »Ponys. Solche hab ich früher schon mal gesehen, Herr Chef, bei Renzen im Zirkus …«
»Zirkus! Das hättste nun auch nich sagen müssen, Rabause! Zirkus, das klingt, wie wenn meine Frau ›klein‹ sagt. Wir haben hier keinen Zirkus!«
»Weiß ich, Herr Chef. Ich mein ja auch nur: als ob Zirkus!«
»Na schön, ich dachte, du wolltest auf demselben Horn wie meine Frau tuten. Nun habe ich gedacht, Rabause: Das Geschirr werden wir ändern lassen müssen. So paßt das den Katzen nicht. Ich bestell gleich nachher den Sattler. Und der Schmied muß auch her, die Beschläge an den Gabeln müssen versetzt werden …«
»Das kostet einen Haufen Geld, Herr Chef, und wenn mal wieder Frieden ist, und wir haben wieder richtige Pferde …«
»Es ist aber nicht Frieden, es ist Krieg, Rabause! Und ich richte mich jetzt auf den Krieg ein. Immer habe ich gelauert und gelauert, es muß doch Frieden werden, jetzt lauer ich nicht mehr. Bei mir ist jetzt Krieg, und ich will auch im Krieg was anderes zu tun haben, als bloß warten. – Nee, ich freu mich, daß es nun wieder Arbeit gibt. Und du freust dich doch auch, Rabause? Das war doch kein Leben nicht, mit fünf Schindern …?«
»Ich freue mich auch. Versteht sich. Satt werden wir die Katzen ja kriegen, wenn’s Hafer auch bloß auf Bezugschein gibt …«
»Stimmt, Rabause! Und wenn der Hafer mal knapp ist, frißt so ’ne Katze auch bloß Heu, und in Rußland sollen sie sogar nur Stroh zu fressen kriegen, sagt Eggebrecht. Das mach ich aber nicht, denn wer arbeitet, der soll auch essen.«
»Billig werden sie sein im Futter, und wenn sie nu auch billig im Preis gewesen sind, weil se doch man klein sind, Herr Chef …«
»Klein! Nun sagst du auch klein, genau wie meine Frau, Rabause. Ich versteh dich nicht! Wie können sie denn billig sein, wo’s keine Pferde gibt?! Da können sie doch gar nicht billig sein! Denk doch mal selber nach, Rabause …«
»Nee, billig können se wohl nich sein, Herr Chef, da haben Sie recht.«
»Teuer sind sie! So teuer, daß ich erst weggehen wollte von Eggebrecht. Aber dann habe ich mir’s überlegt, Rabause. Arbeit muß ich haben, und wenn ich sie nicht kaufe, kauft sie ein anderer …«
»Da haben Sie recht …«
»Unter uns, Rabause, aber du darfst es meiner Frau nicht sagen. Ich habe dem Eggebrecht für die siebzehn Katzen mehr zahlen müssen, als ich für meine siebenundzwanzig guten Pferde bekommen habe!«
»Herr Hackendahl …!«
»Reden wir nicht davon! Ich habe dir nischt gesagt! Aber wenn erst meine zwanzig Droschken wieder vom Hof rollen, dann denke ich nicht mehr an das Geld. Dann freue ich mich. Dann denke ich, was die Leute kucken werden: zwanzig Droschken! Und dann werden sie sagen: ›Ja, der Gustav, der is eisern. Der läßt sich nicht unterkriegen, genau nicht wie der Hindenburg. Der ist eisern!‹ – Und dann freue ich mich …«
Drittes Kapitel: Die lange schwere Zeit
1 Nacht einer Kriegerfrau
In der Nacht fuhr die Schneiderin Gertrud Gudde hoch aus dem Schlaf. Sie hatte den Winterwind sausen hören, schneidend, erbarmungslos gegen Leute, die nicht genug Feuerung haben und unzureichend ernährt sind. Sie schauderte zusammen, dann hatte sie die müden Glieder fester in das warme Bett geschmiegt.
Aber gleich war sie wieder hochgefahren und hatte Licht gemacht. War sie denn nicht aufgewacht, weil Gustäving gerufen hatte? Sie war aus der Wärme gestiegen, hinein in die eisige Kälte des Zimmers, an sein Bett getreten: Aber Gustäving schlief ruhig. Er lag auf der Seite. Eine knochige, bläuliche Schulter sah aus dem Hemd. Sacht zog sie die Decke darüber. Die Nase war viel zu scharf und spitz in dem Kindergesicht, die Ärmchen waren dürr wie Stecken, kein Gramm Fleisch schien auf ihnen zu sein.
Sie sah das alles, wie sie es hundertmal in der letzten Zeit gesehen hatte, wie sie Monat für Monat, Woche für Woche ihr Kind so hatte werden sehen. Sie seufzte, stopfte die Decke noch einmal fest um den mageren Kinderkörper, mit einem Gefühl hilfloser Ergebenheit. Dann kehrte sie in die Bettwärme zurück.
Sie versuchte wieder einzuschlafen. Es war erst zwei Uhr nachts. Sie lag und lauschte auf den Wind, der an den Fenstern im fünften Stock so heulte und rüttelte, als wohne sie nicht in der großen Steinstadt Berlin, sondern weit draußen auf dem flachen Lande, wo die Häuser ungeschützt den Stürmen preisgegeben sind.
Sie erinnerte sich genau, wie der Wind heulte und rüttelte an dem kleinen Elternhaus auf Hiddensee. Wie sie als Kinder wach lagen und lauschten, wie sich das Donnern der Brandung am nahen Westrand der Insel in den Sturmlärm mischte, und wie sie immer daran dachten, daß jetzt der Vater draußen war in seinem Boot, auf Heringsfang vor Arkona oder nach Schollen im Achterwasser. Sie erinnerte sich, wie sie flüsternd in ihren Betten miteinander von ihren großen kleinen Kindergeschehnissen gesprochen hatten, vom Bernstein oder den Hütegänsen, aber nie vom Vater, der draußen war. Das verbot ihnen eine tiefe, abergläubische Scheu. Aber sie dachten immer an ihn, und dieses ständige Denken schien dem Sturm fast etwas Persönliches zu geben, als sei er ein böser Feind, der Vater nachstellte, dem man nicht erzählen durfte, daß Vater draußen war.
Es ist ein weiter Weg von dem armen Fischerhaus auf Hiddensee bis zu der volkreichen Mietskaserne im Osten der großen Stadt Berlin. Es ist auch ein weiter Weg von dem kleinen ängstlichen Fischermädchen bis zu der Schneiderin, die kaum noch Angst hat, sondern im tiefsten ergeben ist in das, was ihr Gott schickt. Ein weiter Weg, eine ungeheure Wandlung. Aber doch, die Gertrud Gudde, die jetzt um zwei Uhr nachts nahe dem Bett ihres schlafenden Kindes wach liegt, empfindet wieder etwas von der abergläubischen Angst, wenn sie auf den Wind horcht. Sie möchte einschlafen, sie will nicht daran denken, sie will es dem Sturm nicht sagen. Aber der Schlaf kommt nicht, das Herz klopft so traurig langsam, die Trübe der kalten Nacht ist nicht nur um sie, sie ist ebenso in ihr.
Ist es nicht derselbe Wind – der Wind vor ihren Fenstern und der Wind über Frankreich? Ist nicht auch für jene dort Sturm? Ist nicht wieder wie ehemals, lange vormals, ein Mann von ihr draußen, nach dem Vater der Geliebte, der Vater ihres Kindes?
Alles wie ehemals, alles wie eh und je! Sie steckt den Kopf in die Kissen, sie will nicht daran denken. Unheil! Otto hat seit zwei Wochen nicht mehr geschrieben – genau wie es früher war, wenn ein Fischerboot nicht zurückkam, und Frau und Kinder, das ganze Dorf wartete auf Nachricht, hoffte und harrte … Es gab ja Fischerboote, die der Sturm bis nach Finnland verschlug, es konnte eine lange Zeit dauern, bis Nachricht eintraf.
Und dann waren sie längst tot gewesen! Während sie daheim noch hofften und harrten, waren die draußen längst tot gewesen, verdorben und gestorben! Über zwei Wochen hatte Otto nicht mehr geschrieben! Und jetzt – der Sturm mag heulen und rütteln, soviel er will! –, jetzt erinnert sie sich, sie ist nicht davon aufgewacht, daß Gustäving nach ihr rief. Eine andere Stimme hatte sie angerufen …
Sie hatte eine Zeitung in der Hand gehalten, sie hatte eine Nachricht gesucht. Angstvoll blätterte sie die Zeitung um, Seite um Seite. Aber von jeder Seite hatten sie nur die unzähligen, schwarzumränderten Todesanzeigen angesehen, die alle Zeitungen füllten: »Den Heldentod für sein Vaterland starb …« Und darüber das Gefallenenkreuz.
Seite auf Seite umgeblättert und nichts wie diese Anzeigen. Plötzlich weiß sie, daß sie keine Nachricht sucht, daß sie die Anzeige sucht: »Den Heldentod für sein Vaterland starb Otto Hackendahl …«
Und sie erschrickt namenlos und sagt sich: Ich suche doch nicht die Anzeige! Er lebt ja, er hat mir grade erst geschrieben, daß er zum Unteroffizier befördert ist … Ich will die Namen gar nicht lesen!
Doch sie liest die Namen nur hastiger, es ist, als warte sie gierig auf den Namen Otto Hackendahl – damit endlich die Erlösung kommt, eine endgültige Entscheidung nach dem ewigen, bangenden Warten von nun schon zwei Jahren. Aber das Schwarz der Zeitungen verwirrt sich, die Gefallenenkreuze schieben sich ineinander, vor den Fenstern heult der Wind … Das Boot ist draußen, und der Vater ist draußen, und sie sind allein im Haus, Mutter und Kinder …
Wie erzählen die Fischer auf Hiddensee? Wenn einer von ihnen ertrinkt, und im Ertrinken ruft er nach seinem Weib, so geht der Ruf so weit, wie es auch sein mag, und erreicht die Gerufene. Er weckt sie aus tiefstem Schlaf: Der Sterbende sagt der Lebenden auf Wiedersehen!
So drang durch das Geschiebe der schwarzen Kreuze ein Ruf zu der Schläferin und hatte sie geweckt. Sie hatte zuerst gemeint, es sei das Kind gewesen. Aber da sie nun wieder einschlafen wollte, wußte sie: Es war nicht das Kind gewesen, er war es gewesen.
Sie lag wach und hätte gerne geweint. Aber sie konnte nicht weinen. Es dauerte schon zu lange. Es half ihr auch nichts, daß sie wußte, es ging allen Frauen jetzt so. Alle Frauen träumten Nacht für Nacht den Traum vom gefallenen Mann. Vom gefallenen Bruder. Vom gefallenen Sohn. Es half ihr nichts, daß sie sich sagte: Es kann ja gar nicht anders sein. An was man den ganzen Tag denkt, an das denkt auch im Schlaf das Hirn weiter. Es hat nichts zu bedeuten. Und es half ihr nichts, daß sie sich sagte: Hundertmal habe ich schon dieses und ähnliches geträumt, und er hat doch immer wieder geschrieben.
Sondern nichts half. Und sie wußte schon, daß nichts half. Daß es in ihr saß, in ihr und in allen Frauen, Schwestern, Müttern. Daß man es eben ertragen mußte, dieses unendliche, peinigende Warten, bis endlich wieder einmal der Briefträger den Feldpostbrief abgab. Und nach fünf Minuten der Erleichterung, des Aufatmens begannen wieder die fünfhundert, die fünftausend, die fünfzigtausend Minuten bangenden Wartens!
Nein, nichts half – und doch ertrug sie es, sie wie alle anderen. Sie stöhnte: »Es ist unerträglich, es muß endlich ein Ende nehmen, so oder so.« Aber es nahm kein Ende, und sie ertrug es weiter. Sie ertrug es, weil sie ein Kind zu versorgen hatte, weil die nackteste Notdurft des Lebens ihr immer neue Pflichten auferlegte, weil sie Briefe ins Feld zu schreiben hatte, die nie mutlos klingen durften, weil sie unendlich arbeiten mußte, um ihm noch Feldpostpäckchen zu schicken … Weil jeder Tag schon in frühester Stunde mit einem eisernen »Du mußt!« auf sie zutrat, weil sie eben nicht die Hände in den Schoß legen, sich nicht ihrer Trauer hingeben konnte.
Schließlich ist Gertrud Gudde doch wieder eingeschlafen, wie sie schließlich fast jede Nacht über ihren Ängsten wieder einschlief. Noch zweimal weckten ihre Träume sie, und mit der alten Angst starrte sie in die Nacht und lauschte auf den Sturm. Das eine Mal hatte sie falsch gelegen, ihre schwache kranke Brust hatte unter einem schweren Druck geseufzt, und sie hatte ihren schrecklichsten Traum geträumt, den sie manchmal hatte, seit ihr plötzlich klargeworden war, was diese auf einmal überall geleierte Redensart »Scheintot im Massengrab« eigentlich bedeutete.
Sie hatte mit Otto unter den anderen gelegen, lebendig unter Toten, und sie hatte versucht, sich hervorzuwühlen … Oh, wie konnten die Menschen einander quälen! Wie konnte jemand, der ein Herz hatte, so etwas sagen?! Atemlos starrte sie in das Dunkel und versuchte, die grauenhaften Bilder aus sich zu vertreiben.
Der dritte Traum aber war fast schön gewesen. Denn sie hatte neben Otto gesessen in einem frühlingsgrünen Walde, und Otto hatte aus der Tasche seines feldgrauen Rockes eine lange Flöte gezogen und hatte gesagt: Die habe ich geschnitzt. Jetzt will ich dir etwas vorspielen!
Er hatte zu spielen angefangen, und bei seinem Spiel waren aus jedem Schalloch der Flöte Vögel geschlüpft. Und die Vögel waren auf der Flöte sitzen geblieben und hatten zu seinem Spiel zu zwitschern und zu singen angefangen. Das hatte unfaßbar schön geklungen. Sie hatte sich immer näher an ihn gelehnt, und schließlich hatte sie ihn umgefaßt. Da hatte er gesagt: Du darfst mich aber nicht zu sehr anfassen. Du weißt doch, daß ich gestorben und nur noch Asche und Staub bin, Tutti?
Sie hatte es wirklich gewußt, aber nur noch fester hatte sie ihn angefaßt. Da war er in ihren Armen zergangen, wie ein leichter Nebel war er durch den Frühlingswald verweht, ganz in der Ferne hörte sie noch sein Flötenspiel und das Zwitschern und Singen der Vögel.
Davon war sie aufgewacht. Der Sturm vor den Fenstern hatte sich etwas gelegt. Die Weckuhr zeigte auf halb fünf. Es war Zeit aufzustehen!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.