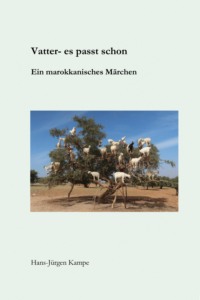Kitabı oku: «Vatter - es passt schon», sayfa 2
Nach einigen Minuten Nachdenken hatte Mohamed die Lösung. „Du gehst von der Schule und arbeitest. Das Geld, das Du verdienst, lege ich für Deine Mitgift zurück. Wir wollen uns vor Jamals Familie nicht schämen müssen“.
Fatima wagte das erste Mal zu widersprechen und flehte ihren Mann an, dem Kind doch noch Zeit mit der Entscheidung zu geben und Laila, die so gern und fleißig lernte, auf der Schule zu lassen. Auch Lailas verzweifelte Tränen halfen nichts. Der Vater wurde immer verstockter und beharrte darauf, dass Laila zu gehorchen habe.
Schließlich schlug Mohamed mit der Faust heftig auf den Tisch.
„Auf jeden Fall kannst Du Dir diesen windigen Schakal Nabil aus dem Sinn schlagen. Selbst wenn Ajwad, der Sohn einer Hündin, mir eine ordentliche Brautgabe für Dich zahlen würde, Nabil würdest Du nie im Leben bekommen“.
Mohamed machte seine Drohung wahr und meldete Laila in der nächsten Woche in der Schule ab. Ihr Lehrer, Monsieur Attique, beschwor den Vater, seine beste Schülerin doch noch auf der Schule zu lassen. Auch der Direktor bekniete Mohamed, seiner Tochter nicht die Zukunft zu stehlen. Sie würde mit Leichtigkeit die Schulen bis zur Hochschulreife absolvieren. Er selber wollte sich dafür einsetzen, dass Laila eines der wenigen, begehrten Stipendien bekam, um an der ESMA, einer der beiden Universitäten in Marrakesch, studieren zu können.
Nur-all das waren genau die falschen Argumente, die Mohamed gerade nicht hören wollte, und die ihn noch mehr in seiner Entscheidung bestärkten. Kein Mädchen von ihm durfte studieren, zumal seine beiden Jungen an einer weiteren Schulbildung kein Interesse zeigten.
Da Laila die Mindestschulzeit bis zum fünfzehnten Lebensjahr erfüllt hatte, konnten die entsetzten Lehrer nichts gegen die Starrköpfigkeit des Vaters unternehmen. Laila musste ihren blauen Schulkittel und ihre Schulbücher zurückgeben. Nur die alten, abgewetzten Spanisch -und Englisch Lehrbücher von Monsieur Attique durfte sie behalten. Beide Bücher waren ihr ganzer Schatz, den sie unter ihrer Matratze vor ihrem Vater versteckt hielt.
Von einem Tag auf den nächsten musste Laila zu Hause bleiben und der Vater zwang sie, sich irgendeine Arbeit zu suchen. Aber Arbeit war in Marrakesch sehr rar. Es gab zu viele hoffnungslose Tagelöhner, die vom Land in die Stadt drängten; Menschen, die für einen Hungerlohn jede Arbeit angenommen hätten, aber auch keine Arbeit fanden.
Tag für Tag verging und Laila konnte ihrem zornigen Vater abends nur von Absagen berichten. Der wurde immer aufgebrachter.
„Du willst nur nicht arbeiten. Glaubst Du vielleicht, Du kannst mir auf der Nase rumtanzen? Ich war bis jetzt so großzügig und habe Dir die Wahl Deiner Arbeit überlassen. Aber wenn Du nicht willst, werde ich mich selber drum kümmern, Dir eine Arbeit zu suchen. Und Du nimmst jede Arbeit an, die ich finde“.
Damit war das Thema für Mohamed vorerst erledigt. Aber auch er musste in den nächsten Wochen die Erfahrung machen, dass ein Mädchen mit abgebrochener Schule und ohne Ausbildung keine Stelle finden konnte. Selbst junge Menschen mit Hochschulabschluss mussten sich hinterher als Lederwaren-, Teppich- oder Schmuckverkäufer auf Provisionsbasis ohne jede Absicherung verdingen.
Mohamed fand auch keine Arbeit für seine verzweifelte Tochter und wurde immer ungeduldiger und gereizter zu Hause. Fatima musste sich immer öfter den Vorwurf anhören, dass sie ihm zwei Mädchen geboren hatte.
3
Es war ein Zufall, dass Mohamed in seinem Stammcafé von einem anderen Müßiggänger erfahren hatte, dass es achtzig Kilometer weiter westlich von Marrakesch in der Nähe der Kleinstadt Chichaouna an der Fernstraße nach Essaouira, eine Kooperative gab, in der auch ungelernte Frauen eine Arbeit finden konnten.
In der Kooperative Khemisa wurden hunderte von alten Argan Bäumen gepflegt, bewässert und von den Frauen der Kooperative abgeerntet. Die viele tausend Beerenfrüchte mussten aufwändig von Hand geöffnet und entkernt werden. Die Nusskerne wurden sodann mit Steinwerkzeug gespalten und die ausgelösten Samenplättchen geröstet. Im nächsten Arbeitsschritt kneteten und pressten die Frauen die gerösteten Samenplättchen mit einer Steinmühle kalt, um aus dem Teig das wertvolle Arganöl zu gewinnen.
Fast drei Tage braucht eine Arbeiterin, um ohne Maschinen zeitraubend und anstrengend einen Liter reines Arganöl zu gewinnen. Die Kooperative wurde neben vielen anderen in Südmarokko 1996 von der marokkanischen Chemieprofessorin Zoubida Charrouf gegründet. Die Professorin, selbst Halbberberin, hatte an der Universität von Rabat festgestellt, dass Arganöl Saponine, Spinasterol und Schottenol enthält, ebenso einen hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren und Antioxidativen. Damit hilft das wertvolle Öl gegen Krebs, Entzündungen, Durchblutungsbeschwerden, senkt den Cholesterinspiegel und findet auch in der Kosmetikindustrie immer mehr Anwendung, da es Narben- und Faltenbildung vorbeugt.
All das interessierte Mohamed allerdings herzlich wenig. Für ihn war nur wichtig, dass Laila hier eine Möglichkeit hatte, für wenig Geld und unter dem Mindestlohn, aber bei freier Kost und Logis und sogar mit einer Krankenversicherung ohne eine Ausbildung zu arbeiten.
Am nächsten Tag meldete sich Mohamed bei der Arbeit für einige Tage krank, was nicht weiter auffiel, und fuhr mit Laila im Bus bis nach Chichaouna. Weinend hatte Laila von ihrer Mutter und ihren Geschwistern Abschied genommen. Während die Brüder hämisch grinsten, klammerte sich die kleine Nouria vergeblich an ihre große Schwester und die Mutter stieß ein verzweifeltes Wehklagen aus. Es half alles nichts. Mohameds Entschluss stand fest. Laila musste weit weg von Nabil, arbeiten und Geld verdienen.
Fatima hatte ihrer Tochter noch ins Ohr flüstern können, dass sie Samima heimlich unterrichten würde, damit die ihren Sohn Nabil über Lailas neue Unterkunft informieren könne. Auf dem Weg zur Busstation nahm Laila traurig und hoffnungslos die ersten Sonnenstrahlen wahr. Das Rot der ihr so vertrauten Häuser am Rande ihrer Heimatstadt schimmerte früh morgens noch blass.
Ihren Pass hatte Mohamed seiner Tochter vorsorglich abgenommen, als sie mit sehr wenig Gepäck in dem stickig heißen Bus anderthalb Stunden durch die trockene Souss Ebene in die Kleinstadt fuhren. Die letzten fünf Kilometer mussten Vater und Tochter die staubige Landstraße in flirrender Hitze entlanglaufen, bis Reihen von Arganbäumen die Kooperative ankündigten. Bis auf die Anpflanzungen der teilweise schon sehr alten Bäume, war die Gegend so steinig und karg, dass auch das Leben der Vögel verkümmerte.
Ausgezehrt, traurig, hilflos und durstig betrat Laila widerwillig den bekiesten Hof. Alles wirkte hier einfach, aber sauber. An der linken Seite wartete ein Parkplatz auf die ersten Besucherbusse. Vor Kopf trennte eine zwei Meter hohe Mauer den Vorplatz vom eigentlichen Hof der Kooperative.
Mohamed schritt als erster forsch durch das hölzerne Tor und betrat den Hof, in dessen Mitte ein kleiner Brunnen plätschernd Wasser spendete. Laila folgte sehr zögerlich. Sie hatte Angst vor der unbekannten Welt. Zwei alte, knorrige Olivenbäume standen vor einer langen, überdachten Terrasse, die zwanzig Frauen unterschiedlichen Alters Schatten bot. Die Arbeiterinnen saßen auf Kissen, neben sich Körbe, voll mit Argan Früchten. Einige öffneten die Beeren und holten die nussartigen Samen aus der Frucht, andere spalteten die Nüsse und einige pressten mit schweren Steinmühlen das begehrte Öl aus dem gekneteten Teig der Samen.
Mohamed schaute sehr skeptisch. Kein Mann zu sehen, der aufpasste, dass fleißig gearbeitet und nicht geschwätzt wurde. Aber wenigstens trugen alle Frauen Kopftücher. Er ging auf die älteste Arbeiterin zu und verlangte selbstbewusst, den Chef zu sprechen. Zuerst schaute die Alte gar nicht hoch. Als Mohamed seine Frage ungeduldig und lauter wiederholte, blickte ihn die runzlige Arbeiterin etwas spöttisch an.
„Den gibt´s hier nicht“, war alles, was der unsympathische Besucher zu hören bekam. Einige Fragen später war Mohamed zwar schlauer, aber auch frustrierter. Es gab hier tatsächlich keinen Chef. Aber es gab eine Chefin. Lailas Vater war verblüfft und verunsichert. In was für einer Kooperative war er hier nur gelandet? Aber nach einer so langen Fahrt wollte er sein Vorhaben mit Laila jetzt unbedingt zu Ende bringen. Er musste wohl oder übel akzeptieren, mit einer Frau zu verhandeln. Etwas kleinlaut verlangte er, dann eben die Chefin zu sprechen.
Nach einer Viertelstunde Wartezeit erschien Latifa, die Leiterin der kleinen Dorf–Kooperative. Jetzt war Mohamed entsetzt. Latifa war erst Ende zwanzig. Und trug kein Kopftuch. Aus seiner Sicht noch viel zu jung, um ein solches Unternehmen zu leiten. Mohamed empfand es als weiteren Affront, dass die junge Frau ihm gegenüber auch noch erstaunlich selbstbewusst auftrat. Am liebsten wäre er mit seiner Tochter wieder nach Marrakesch zurückgefahren.
Latifa hatte die Situation mit wenigen Blicken erfasst und bot Vater und Tochter in ihrem Büro ein Sitzkissen aus rotem Leder an. Unaufgefordert erschien wie von Geisterhand eine ältere Frau mit heißem, süßem Pfefferminztee, den sie in kleine Teegläser mit silberner Ummantelung goss. Nach dem ersten, unverbindlichen Geplänkel konnte sich Latifa noch ein besseres Bild machen. Laila war nicht freiwillig hier, konnte aber in ihrem Alter nichts gegen den Willen ihres despotischen Vaters unternehmen, der seine Tochter in Khemisa zum Arbeiten zwingen wollte.
Latifa spürte, dass Laila sich in der Gegenwart des autoritären Vaters unwohl fühlte und Angst hatte. Aber vielleicht konnte gerade eine Zeit in der Frauen Kooperative dem Kind helfen, Abstand zu gewinnen, reifer und selbstsicherer zu werden und sich mit zunehmendem Alter gegen den tyrannischen Vater zu behaupten. So wie auch ihr die vergangenen Jahre in der Kooperative geholfen hatten, erwachsen und selbstbewusst zu werden.
Latifa beschloss, Vater und Tochter erstmal die Kooperative zu zeigen, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Alles in den Häusern und im Außenbereich war einfach, aber sauber. Der Schlafsaal für die Frauen, die in eigenen Betten, welche durch Vorhänge abgeteilt werden konnten und mit eigenen Schränken versehen war, wirkte auf Laila befreiend und anheimelnd. Der Speiseraum, die Küche, und die Toiletten-alle Böden waren gefliest und die Wände weiß gekalkt.
Laila registrierte dankbar, dass es sogar Waschbecken und zwei Duschen gab. Aus den Leitungen floss sauberes, klares Wasser und die Fenster ließen Licht und Luft in die Räume. Laila und auch Mohamed waren nur am Staunen. Hier war alles besser, als in dem umgebauten Ziegenstall in Marrakesch, wie sich Mohamed mit aufkommender Missgunst eingestehen musste.
Während der Besichtigung erklärte Latifa die Arbeit in Khemisa, welches wiederum zu einer von sechs Hauptkooperativen gehörte, die zusammen den landwirtschaftlichen Verband „Targanine“ bildeten.
Vor Mohamed erwähnte Latifa nichts von den Fortbildungen für Frauen, die neben der Arbeit hier angeboten wurden. Auch erfuhr der Despot nichts von den Schulungen über das Rechtssystem in Marokko, welche Frauen über ihre Rechte aufklärten, mit dem Ziel, dass sie eine Gleichstellung in der Ehe und zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft einfordern konnten. Auch die Alphabetisierungs-, Schneider-, Näh-, und Kunsthandwerkerkurse erwähnte Latifa ebenso wenig wie den Fonds, den „Targanine“ eingerichtet hatte, um Frauen mit zinslosen Darlehen in einer Notsituation zu helfen.
Vor Allem, um sich vor gewalttätigen Ehemännern und Vätern behaupten zu können.
Vielmehr war die junge Leiterin zu Mohamed liebenswürdig, ohne unterwürfig zu wirken. Sie umschmeichelte ihn als verantwortungsbewussten Vater, der diesen langen Weg auf sich genommen hatte, um seiner Tochter eine der wenigen Arbeitsstellen zu vermitteln. Sie erwähnte das ausreichende gesunde Essen und Trinken, die Krankenversicherung und das Geld, das Laila verdienen konnte.
Zwar waren die neunhundert Dirham im Monat auch für marokkanische Verhältnisse nicht viel - sie lagen bei der Hälfte des Mindestlohnes. Aber Mohamed war mittlerweile so tief in dem Netz von respektvollen Liebenswürdigkeiten und Anerkennung über seine Verdienste als Vater gefangen, dass er fast alles akzeptiert hätte.
Und so fiel es ihm auch nicht weiter auf, dass das Gehalt, welches Laila beziehen würde, nicht auf sein Konto gezahlt werden sollte, sondern auf ein Lohnkonto, welches die Kooperative jeweils für die Arbeiterinnen einrichten würde.
Als Latifa den Eindruck gewonnen hatte, dass auch Laila die Arbeit, die Unterkunft und das Angebot der Kooperative gefiel, bereitete sie einen Arbeitsvertrag vor. Mohamed war viel zu stolz, um zuzugeben, dass er nur sehr schlecht lesen, schreiben und rechnen konnte. Zwar tat er so, als würde er das Vertragswerk eingehend studieren, hatte aber nichts von dem Inhalt verstanden, als er den Vertrag mit einigen unkenntlichen arabischen Schriftzeichen von rechts nach links unterschrieb.
Der Abschied von Laila war emotionslos und sehr kurz. Laila schaute ihren Vater nicht an, als der sich von ihr und Latifa verabschiedete und stolz auf sich durch das Tor schritt. Auf dem Rückweg zur Busstation rechnete Mohamed über eine Stunde lang aus, dass Laila fast zwei Jahre arbeiten musste, um die geforderten zwanzigtausend Dirham zu verdienen. Das war ihm viel zu lang. Denn so viel hatte Mohamed schnell begriffen. Dann wäre seine Tochter achtzehn Jahre alt, volljährig und könnte sich ihm in undankbarer Weise widersetzen. Was seine aufsässige Tochter mit Sicherheit machen würde.
Also musste die geforderte Summe schneller aufgebracht werden, um die Hochzeit mit Baz früher feiern zu können. Mohamed überlegte während der Busfahrt krampfhaft, wie er Geld dazuverdienen könnte.
Eine Möglichkeit war nach wie vor der Verkauf von Gegenständen, die anderen gehörten und die er in einem unbewachten Augenblick auf dem Markt „entsorgte“. Das war nicht ohne ein Risiko. Mohamed rieb sich unentschlossen den Stoppelbart. Kurz bevor er Marrakesch erreichte, fiel ihm noch eine Möglichkeit ein, ohne zu investieren, Geld zu verdienen. Er würde seinen beiden Söhnen befehlen, die vielen Hundekadaver, die an den Straßenrändern lagen, aufzusammeln. Ein wunderbares Rohmaterial, und sie würden der Stadtverwaltung noch ein gutes Werk tun, das Mohamed bei seinen Chefs erwähnen wollte. Fatima würde er dann zwingen, aus den Knochen Seife zu kochen, die er an einen der Händler in den Souks verkaufen könnte. Keine großen Beträge, aber im Laufe von über einem Jahr würde ein weiterer Beitrag für Lailas Hochzeit zusammenkommen.
Für seine Verhältnisse gut gelaunt stieg Mohamed aus dem Bus und schlurfte in seinen Pantoffeln zurück in die Arme seiner Familie, die ihn im Grunde genommen nicht vermisst hatte.
Marburg – in diesem Jahr
1
Anton Thaler erwachte schweißgebadet und setzte sich unbeholfen auf seiner durchgelegenen Seegrasmatratze auf. Immer wieder dieser Albtraum.
Alle paar Wochen sah er, wie sie sich ihm aufreizend im weißen Sand wie ein Schlemmerfilet entgegenräkelte, wie sie sich ihm förmlich anbot und entgegenstreckte. Noch unberührt. Wie sie ihn geradezu anbettelte, sie endlich zu nehmen und sich ihm gänzlich geöffnet hatte. Antons Puls und Atem ging immer schneller.
Und dann hörte er wieder hinter sich das Keuchen, Schritte im Sand, während seine eigenen Beine immer schwerer wurden. Nur noch zehn Meter, noch fünf! Anton ruderte mit den Armen, um vorwärts zu kommen. Es half alles nichts. Ein Schatten glitt an ihm vorbei. Seine Füße schlurften nur noch bleiern im Sand.
Tief enttäuscht musste er wieder mit ansehen, wie sich sein eigener Vater, mit einem kompromisslosen „Haben wollen“ in den Pupillen auf das Objekt seiner Begierde stürzte und sie wie immer zuerst in den Händen hielt.
Die weiße, handtellergroße Drehmuschel, makellos hingespült an den Strand von La Herradura, wo Antons Eltern, Klaus und Andrea Thaler, sich vor Jahren ein kleines Ferienhaus bauen ließen. Und in dessen Zimmern sich mittlerweile die übervollen Glaszylinder reihten, in denen sein Vater seit geraumer Zeit seine Beutestücke, die immer seltener werdenden Drehmuscheln, hortete.
Was Anton, dem ältesten „Stammhalter“ von Klaus, am meisten schockierte, war nicht die Tatsache, dass er wie immer im Traum bei der Drehmuschel gegen seinen „Vatter“ den Kürzeren zog, sondern, dass er unbewusst seinem Vater, den er seit Jahren mit seinen Macken auf die Schippe genommen hatte, immer ähnlicher wurde.
Was er nie im Leben wollte.
Es waren ja nicht nur die Drehmuscheln, die ihn seit einiger Zeit faszinierten und die er auch so liebend gern suchen und sammeln wollte. Andere Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Semester, die er mit seinem langjährigen Freund Artur, genannt „Lutscher“, wegen dessen früherer Vorliebe für klebrige Lollis, in Marburg Jura studierte, eingeschlichen hatten, wunderten Anton selbst immer mehr.
Da war zum Beispiel seine aufkommende Begeisterung für sehr alte Beatles Songs aus den frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, über die er sich früher nur lustig gemacht hatte. Denn in der Schulzeit wollte Anton nur Punk, Heavy Metal und Hardrock hören, und zwar sehr laut. Wahrscheinlich, weil die halbe Schule das so gemacht hatte. Und jetzt mit über zwanzig? Ein richtiger Softie war er geworden.
Das Gleiche galt auch für seine aufkommende Begeisterung für Joggen. All das durfte sein „Vatter“ erstmal nicht erfahren. Der fühlte sich sonst noch bestätigt
Anton hatte sich von den sehr überschaubaren Überweisungen seines knausrigen Vaters ein paar Laufschuhe abgespart und joggte dreimal die Woche den steilen Berg bis zum Marburger Schloss hoch. Das hätte Klaus, der selber mit seinen Freunden regelmäßig lief, mit Sicherheit sehr gefreut, was Anton aber gern verhindern wollte. Nachher würde sein „Vatter“ auf die Idee kommen, am Wochenende in Kassel mit ihm eine Runde zum hohen Herkules laufen zu wollen. Und da hätte Anton wahrscheinlich richtig alt ausgesehen.
Richtig geschämt hatte sich Anton aber, als er in einem Reformhaus in der Marburger Altstadt ein Schild sah, auf welchem Weidenröschen Tee im Sonderangebot beworben wurde. Er hatte sich mit größten Gewissensbissen in den Laden geschlichen und sich zweihundert Gramm von dem immer noch teuren Tee gegönnt. Der Tee war seinem Vater seit Jahren heilig, weil er der Meinung war, seine Prostata würde es ihm im Alter sicherlich danken. Wahrscheinlich hatte die Verkäuferin Anton auch deshalb so merkwürdig angesehen, weil kein Student normalerweise diesen heuähnlichen Tee mit dem Geschmack von Pferdepippi kaufen würde. Und weil die Ausgabe für das Gesöff sein Budget bei weitem überschritt, beschloss Anton, jede Portion mindestens dreimal aufzubrühen. Auch deshalb wäre sein sparsamer Vater wieder sehr stolz auf ihn gewesen. Anton konnte machen, was er wollte, seine Erziehung und seine Gene schlugen voll durch.
Die schlimmste Eigenschaft, die sich bei Anton immer stärker zeigte, durfte der „Vatter“ aber nie im Leben mitkriegen: Anton spürte selber, dass er in den zwei Jahren, die er nun schon in Marburg lebte, immer sparsamer wurde. Ein Wesenszug, den er bei seinem „Vatter“ bislang einfach nur peinlich fand.
Die Sparsamkeit hatte sich bei Anton erst langsam entwickelt. Am Anfang war er froh, wenn er am Monatsende etwas von den knappen Überweisungen seiner Eltern übrigbehielt. Er sparte beim Putzen in seinem Zimmer und bei den Staubsauger Beuteln für den alten Sauger, den ihm Klaus zum Einzug großzügig überlassen hatte. Entsprechend sah Antons kleines Zimmer im Dachgeschoß des alten Fachwerkhauses am Marktplatz auch aus.
Die „Wollmäuse“ unter seinem ausgelegenen Bett bildeten mittlerweile eine harmonische Wohngemeinschaft mit der zunehmenden Zahl von übergroßen Silberfischen, die in Antons jahrzehntealter Seegrasmatratze seit Generationen nisteten. Und die nach vier Semestern fast handzahm geworden waren, weil sie bei Anton eh nichts zu befürchten hatten. Lutscher war sowieso der Meinung, die vielen Silberfische wären das Ergebnis eines besonders guten Mikroklimas in ihren Studentenbuden.
Wobei man mit dem Begriff „Klima“ in den Dachzimmern sehr vorsichtig umgehen musste.
Im Sommer glich das kleine Zimmer unter dem nahezu ungedämmten Dach des über fünfhundert Jahre alten Fachwerkhauses einem Römertopf im Backofen. Da musste keiner frieren.
Im Gegensatz zum Winter, in dem Anton versuchte, ökonomisch und ökologisch nur minimal zu heizen, sodass Lutscher, der im Nachbarzimmer hauste, der Meinung war, jede offene Bushaltestelle in Jakutsk wäre im Januar noch gemütlicher, als Antons Zimmer.
Oft genug weigerte sich der Jurastudent, sein Zimmer halbwegs warm zu halten. Denn die einzige Heizquelle war ein steinalter Ölofen der Marke Degussa, den Anton mit einer Kanne regelmäßig befüllen musste. Entsprechend stanken seine Haare, seine Haut und seine Kleidung das gesamte Wintersemester nach Heizöl, sodass Anton nur wenig Lust hatte, die vier Stockwerke in den Keller runter und wieder hoch zu steigen. Erst wenn die Eisblumen jeden Blick nach draußen versperrten und kaum noch Tageslicht ins Zimmer drang, bequemte sich Anton, eines der drei Fässer im Keller anzuzapfen, die dort unter Missachtung jeglicher Umwelt- und Brandschutzauflagen auf dem uralten Lehmboden standen.
Und wenn Anton den Ofen aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts doch benutzte, konnte es schnell passieren, dass eine Verstopfung in der Leitung jegliches Heizen verhinderte. Von seinem Vermieter kam dann immer nur die gleiche Antwort: „Ich schicke Ihnen einen Spezialisten vorbei“.
In den nächsten Tagen hörte Anton dann irgendwann am frühen Abend ein heftiges Trampeln, Keuchen und Schnaufen im Treppenhaus, als käme eine Dampflok nach oben.
Gregori, der „Spezialist“ wuchtete seine drei Zentner die alte Holztreppe bis ins Dach. In der linken Hand trug der Deutschrusse das einzige Werkzeug, das er hatte: eine gekürzte Dachlatte. Mit der stocherte Gregori heftig in der Brennkammer, trat zweimal mit den verstärkten Kappen seiner Arbeitsschuhe roh an den scheppernden Ofen, bis das Öl vor lauter Erschütterungen wieder floss.
Der einzige Satz, den der Dicke nach dem dritten Deutschkurs relativ flüssig in Deutsch sprechen konnte, lautete: „Host`n Schnops?“ Letzten Endes war das keine Frage, sondern eine Aufforderung, denn Gregori hatte sein Leben bereits vor langer Zeit dem Alkohol geweiht.
Deshalb hatte sich Anton auch für die Besuche des gewichtigen „Spezialisten“ in einem Billigdiscounter eine Literflasche des billigsten Korns zugelegt, von dem Gregori nach jedem Besuch ein Wasserglas runterstürzte, bevor er mit Getöse die zitternde Holztreppe wieder nach unten stapfte.
Nur - es konnte passieren, dass nach einer Behandlung durch den „Spezialisten“ viel zu viel und zu schnell Öl in die Brennkammer floss, sodass die gusseisernen Platten rot glühten und sich Anton ängstlich überlegte, auf welchem Fluchtweg er die vier Stockwerke nach unten kommen könnte. Also blieb der Ofen lieber aus.
Seit Anton eine feste Freundin hatte, versuchte er noch weiter zu sparen, denn er wollte Frida, der Politik- und Pädagogikstudentin aus dem Norddeutschen, ja ab und zu auch etwas bieten.
Also änderte Anton zwangsweise seine Essgewohnheiten. Er gönnte sich nur noch dreimal die Woche das billigste Stammessen in der Mensa. Zum Beispiel durchgekochte, rosa Labskaus mit Gurke, Linsensuppe oder auch mal ein Spiegelei mit Bratkartoffeln. Ansonsten bestand sein Mittagessen aus einem der großen Mohnstriezel in der Mensa, die nur die Hälfte des Stammessens kosteten, dafür aber den Blutzuckerspiegel schön nach oben trieben.
All das reichte aber nicht, um seine Freundin, die selber auch knapsen musste, ab und zu mal ins Kino oder zum Billardspielen einschließlich Getränk einzuladen.
Also suchte Anton krampfhaft nach weiteren Quellen, um zu sparen. Nicht nur, dass er festgestellt hatte, wie er bei Konzerten in der Marburger Stadthalle durch den Bediensteten Eingang ohne zu zahlen zu einem Kulturerlebnis kam. Wobei ihn ja meistens die Konzerte, in die er sich einschleichen konnte, noch nicht mal sonderlich interessierten. Aber egal - es war kostenlos, und da nahm Anton auch schon mal eine Schlagerparade von abgehalfterten „Stars“ aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Kauf.
Lutscher hatte ihm zudem vorgeschwärmt, dass man durch Blutspenden auch zu einer monatlichen Mehreinnahme ohne großen Aufwand kommen konnte. „Man könne ja auch noch ganz andere Sachen in der Uni Klinik von sich spenden, was sogar sehr angenehm sein kann“, war Lutschers Überlegung, sein selbstloses Angebot an Körpersäften noch zu diversifizieren.
Zu beiden Möglichkeiten, sich kurzzeitig zu schwächen, hatte Anton aber keine Lust, denn er hatte noch eine weitere Möglichkeit entdeckt, wie er beim Essen weiter sparen konnte.
In Marburg gibt es, wie in allen anderen Universitätsstädten auch, zahlreiche studentische Verbindungen. Und die hatten laufend Nachwuchssorgen. Also wurden die „Frischlinge“ an der Uni mit Handzetteln, Mailings und durch persönliche Ansprachen von „Füchsen“, den Einsteigern bei Verbindungen, eingeladen, das gesellige Leben der Korpsstudenten kennenzulernen. Und dann möglichst auch Mitglied zu werden.
Aber vorher durften sich die neuen Studenten als Gäste abends in den großen Verbindungshäusern so richtig den Bauch vollschlagen. Und damit die Leber nicht vertrocknete, gab es Bier bis zum Abwinken.
Auf diese Weise hatten Anton und Lutscher schon diverse Abendessen kostenlos genossen, teilweise sogar mit Bedienung. Aber beide hatten immer dem wachsenden Druck standgehalten, in eine der Verbindungen einzutreten. Wenn die Erwartung an eine Mitgliedschaft zu groß wurde, wechselten die beiden schnellsten als nicht zahlende, aber anfangs willkommene Gäste in ein anderes Verbindungshaus.
Heute Morgen hatte Anton auf seiner dreiteiligen Matratze verschlafen. Gestern Abend war es bei der „Fidelia“, einer schlagenden Verbindung, wieder hoch her gegangen und sehr spät geworden. Der Jurastudent sprang aus dem Bett, wusch sich sehr flüchtig an dem Fünf Liter Boiler auf dem Gang, sparte sich den Gang auf die nur achtzig Zentimeter breite Toilette, schnappte sich zuerst hektisch seine Unterlagen und dann den alten grünen Parka, der schon in der Ecke stehen konnte und rannte die Barfüßerstraße zwischen den restaurierten Fachwerkhäusern runter. Sein Ziel war das „Landgrafenhaus“, in dem seit über hundert Jahren tausende Studenten mit öffentlichen und zivilen Rechtsfragen gelangweilt wurden.
Als er keuchend vor der Tür des großen Vorlesungssaals L 100 angekommen war, hörte Anton schon, wie von innen ein Schlüssel ins Schloss geschoben wurde. Hastig riss Anton die Tür auf und stand Auge um Auge Professor Fuchs gegenüber. Grauer Anzug mit Weste, Fliege auf weißem Hemd mit verblichenem Kragen, graue Haare und bereits jetzt schon ein hochrotes Gesicht, das auf eine gewisse Reizbarkeit schließen ließ.
Professor Fuchs las Strafrecht, dessen Auswirkungen er durch Überschreitungen der Gesetze regelmäßig bei Selbstversuchen zu spüren bekam.
Denn Wotan Ignaz Egon Fuchs war ein ausgemachter Choleriker vor dem Herrn. Der Pate des kleinen Egon hatte auf dem zusätzlichen Namen Wotan bestanden, weil das Baby bereits in seinen ersten Lebenstagen extreme Schreikrämpfe und plötzlich auftretende, nicht zu bremsende Wutanfälle zeigte. Egons Mutter hatte zwar immer beschwichtigt: „das sind nur Blähungen“, oder „das verwächst sich noch“. Aber als der erste Zahn kam und das Kleinkind aus purer Bosheit seine Mutter heftig beim Stillen gebissen hatte, stimmte sie resigniert dem Namen des germanischen Kriegsgottes zu.
Der Kleine blieb hochcholerisch.
Aus Sicht der meisten Studenten war der Professor, der kurz vor der Emeritierung stand, ein Fall für die „Klapsmühle“. Und ein klassisches Beispiel für die Anwendung des Paragraphen 51 des Strafgesetzbuches.
„Schuldunfähigkeit aufgrund Unzurechnungsfähigkeit wegen Alkoholgenuss“.
Fast wöchentlich stürmte der Professor ins Foyer des Landgrafen- oder des Savigny Hauses und riss wutentbrannt die Büchertische der Studenten um. Am Anfang waren die Tische der Marxisten, Leninisten, Spartakisten, oder der Maoisten das Ziel seiner Attacken. Auf die Farbe Rot reagierte der Professor wie ein spanischer Kampfstier in der Arena. Später hatte sich der Choleriker auch auf Grün eingeschossen und rammte die Tische der strickenden Vertreter der Umweltbewegung. Seit Neuesten verschmähte er noch nicht einmal die Farbe Gelb, der liberalen Gattung, und sogar der Tisch der Schwarzen, des Rings Christlich Demokratischer Studenten, flog in seltener Einigkeit mit den anderen Fraktionen durch den Flur.
Weitere, bei den Studenten immer wieder gern erzählte Beispiele seines Jähzorns, waren das Eintreten einer Tür des Stadtbusses, weil der Fahrer nicht da hielt, wo der Herr Professor gerade mal aussteigen wollte. Oder das hilflose Zusammensacken seines Architekten, weil der krachend in der Linken des Gelehrten gelandet war, dem die neue Garage doch nicht hundertprozentig gefallen hatte. Auch die junge Frau, die bei Dunkelgelb nicht noch über die Ampel gefahren war, sondern sich erdreistet hatte, zu bremsen, sodass der Wissenschaftler ebenfalls nicht mehr über die Ampel, sondern vier Minuten zu spät zum Mittagessen nach Hause kam, konnte ein Lied von der Tobsucht des Strafrechtlers singen. Sie rettete in letzter Sekunde der Verschlussknopf an der Tür ihres „Käfers“, die der Erzürnte aufreißen wollte, um die „total unfähige“ Fahrerin vom Lenkrad zu entfernen. Der prügelnde Welfenprinz Ernst August war dagegen ein Musterknabe an selbstbeherrschter Zurückhaltung.