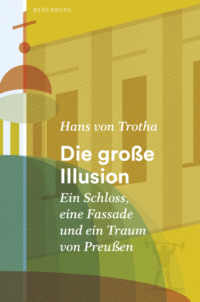Kitabı oku: «Die große Illusion», sayfa 2
Nation und Nationalismus
La grande illusion. Die große Illusion. So hat der französische Regisseur Jean Renoir einen legendären Antikriegsfilm genannt, der, 1937 – also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – gedreht, eine Geschichte aus einer Epoche erzählt, die offensichtlich damals schon als längst untergegangen wahrgenommen wurde: die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Protagonistinnen und Protagonisten geben sich der Illusion hin, dass bald Frieden sei, vielleicht ja sogar dauerhaft.
Die große Illusion. So hat der bereits zitierte Historiker Eckart Conze eine Interpretation des Friedens von Versailles genannt, das Ende jenes Ersten Weltkriegs, der den Rahmen für die Handlung von Jean Renoirs Film liefert und der auch das Ende des deutschen Kaiserreichs bedeutete. Conzes Buch trägt den Untertitel Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt. Es erschien 100 Jahre nach der für das 20. Jahrhundert so folgenreichen Proklamation eines Friedens im Spiegelsaal von Versailles, der Deutschland betreffende unter den sogenannten Pariser Vorortfrieden, die den Abschluss einer großen internationalen Konferenz in Paris markierten. Deren Protagonisten, und die wenigen Protagonistinnen (tatsächlich hatte die internationale Frauenwahlrechtsbewegung Delegierte nach Paris geschickt, um ihr Anliegen voranzubringen), gaben sich der Illusion hin, es sei möglich, aus widerstreitenden nationalen Interessen eine stabile internationale Ordnung zu schaffen.
Die Verkündung der Friedensbedingungen für das vernichtend geschlagene Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles bezog sich in einem Gestus triumphaler Revanche auf die Deklaration eines deutschen Nationalstaates an eben diesem Ort am 18. Januar 1871. Ein berühmtes Gemälde, das der Historienmaler Anton von Werner für den größten Saal im Berliner Schloss, den legendären Weißen Saal, auftragsgemäß anfertigte, hat die Szene in idealisierter Form festgehalten. Es ist zur Ikone des Ursprungs eines deutschen Nationalstaats geworden, der auf Betreiben und unter Führung Preußens entstand. Die Protagonisten gaben sich der Illusion hin, eine geeinte Nation könnte den Deutschen mehr Reichtum, mehr Einfluss und Macht, mehr Wohlstand, irgendwann – damit hatten sie es nicht ganz so eilig – vielleicht auch Frieden und ein gutes Leben unter den Bedingungen einer Moderne garantieren, deren umwälzende Veränderungen gerade spürbar zu werden begannen. Das Deutsche Reich, dessen Gründung Anton von Werners monumentales (4,34 mal 7,32 Meter) Gemälde im Berliner Schloss zelebrierte, sollte es nicht lang geben. Aus einem Krieg, dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, war es hervorgegangen, in einem Krieg ging es auch zugrunde: 1918, am Ende jenes Kriegs, in dem Jean Renoirs La grande illusion spielt, war schon wieder Schluss mit dem Versuch, an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation anzuknüpfen. Während Jean Renoir seinen Film schrieb und drehte, tobte innerhalb der deutschen Grenzen aufs Allerschlimmste gerade der sogenannte dritte Versuch.
Die erste und vordringlichste Botschaft der Fassade, um die es hier geht, ist die Aufforderung zu einem Blick in die Vergangenheit des Orts, an dem sie wiedererrichtet wurde, und des Gebäudes, zu dem sie früher gehörte. Es war das Residenzschloss der Könige von Preußen, nach der Einigung Deutschlands zum Nationalstaat 1871 der deutschen Kaiser.
Auch der Einigung zu einem deutschen Nationalstaat hat der Historiker Eckart Conze ein Buch gewidmet. Es erschien im Herbst 2020 mit Blick auf die 150. Wiederkehr der Reichsgründung im Januar 2021. Conze gab ihm den Titel Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe. Es schildert den Vorgang der Einigung Deutschlands und verfolgt die Debatten, die diese Einigung im Lauf der folgenden eineinhalb Jahrhunderte auslöste, geprägt von den und manchmal auch prägend für die politischen und gesellschaftlichen Fragen, die die Zeit jeweils bewegten. Dabei wird deutlich, dass diese Einigung, also die Einigung zum deutschen Kaiserreich in der Form, in der es nach 1871 real existierte, als »Kriegsgeburt«, als kleindeutsche Lösung (also ohne Österreich), als Revolution von oben, unter der Dominanz Preußens, gegen den Willen vieler Beteiligter (vor allem der süddeutschen Staaten), unter Ausschluss jedweder parlamentarischen Beteiligung, schließlich als autoritärer Zentralstaat alles andere als »alternativlos« war. Der Begriff, den Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zusammenhang mit der Euro-Rettungs-Krise zur seither viel zitierten Chiffre dafür machte, dass es bisweilen unnötig sei, politisches Handeln logisch zu erklären und nachvollziehbar zu begründen (was bei der Namensfindung für eine rechte Fundamentalopposition, die Alternative für Deutschland, eine Rolle gespielt haben dürfte), fällt nicht nur bei Eckart Conze, sondern auch in anderen Darstellungen der Ereignisse von 1871, etwa in Christoph Jahrs ebenfalls im Herbst 2020 erschienenen Buch Blut und Eisen, dessen Untertitel die Rolle Preußens für die Reichseinigung von 1871 so fasst: Wie Preußen Deutschland erzwang. So anachronistisch die Anwendung des Begriffs alternativlos in seiner politischen Bedeutung von 2010 auf die komplexen politischen Verhältnisse im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist, so kommt sie doch nicht von ungefähr: Hat doch eine nationalistische Geschichtsschreibung viel darangesetzt, das Gegenteil zu behaupten, also darzulegen, dass die Einigung Deutschlands unter der strammen Führung Preußens immer das Ziel der Geschichte gewesen sei – mithin also eben doch alternativlos.

Anton von Werner, Die Proklamation des deutschen Kaiserreichs. Fassung für das Berliner Schloss, enthüllt am 22. März 1877.
Öl auf Leinwand, 4,34 × 7,32 m, Kriegsverlust; nur als Schwarz-Weiß-Fotografie erhalten.
Eckart Conze erzählt die Geschichte der Einigung Deutschlands zum Kaiserreich nicht nur um ihrer selbst, sondern vor allem um der Konsequenzen willen, die sich aus ihr ergeben haben. Dabei hat er mit seinem Buch, das er eine »geschichtspolitische Intervention« nennt, eine Debatte innerhalb seiner Zunft ausgelöst, die auch in den Feuilletons ausgetragen wurde. Einerseits hatte das mit dem Jahrestag zu tun, der 150. Wiederkehr der Reichsgründung, die nicht zuletzt wegen Anton von Werners stets im Bildgedächtnis der Deutschen präsenten Gemälde immer gleich ein Bild erzeugt und damit verbunden Emotionen. Der lebhafte Streit um Conzes »Intervention« ist aber auch eine Folge davon, dass sich über eine intensive, zum Teil auch öffentlich diskutierte Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert, ein neues, differenziertes Bild des deutschen Kaiserreichs, des ersten Nationalstaats der Deutschen, ergeben hatte, immer wieder angeregt durch Jahrestage (etwa 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 2014 oder 100 Jahre Frieden von Versailles im Jahr 2018, aber auch der 200. Geburtstag Otto von Bismarcks, des wichtigsten und umstrittensten deutschen Politikers im 19. Jahrhundert, ohne den es das deutsche Kaiserreich zu diesem Zeitpunkt und in dieser Form nicht gegeben hätte, im Jahr 2015).
Eckart Conze macht im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts in dem seit 1990 wieder zum Nationalstaat vereinten Deutschland eine »Renationalisierung, ja einen neuen Nationalismus« aus, »der außenpolitische Bindungen, nicht zuletzt in Europa, infrage stellt und innenpolitisch und gesellschaftlich einer völkisch bestimmten nationalen Identität das Wort redet«. Der Historiker spricht von »Dynamiken der Renationalisierung« und resümiert: »Unkritisch und offensiv bekennt sich ein neuer Nationalismus zur preußisch-deutschen Nationalgeschichte und stellt die Berliner Republik in ihre schwarz-weiß-rote Tradition.«
In verschiedenen Repliken wurde Conze vorgeworfen, die neuen Forschungsergebnisse zum 19. Jahrhundert nicht genügend zu würdigen und einseitig auf die »Schatten des Kaiserreichs« zu verweisen, ohne die gesellschaftlichen Fortschritte jener Epoche ausreichend zu berücksichtigen. So befand die Historikerin Birgit Aschmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:
»Conzes Bild des Kaiserreichs folgt einer historiographischen Pendelbewegung, auf die er selbst eingeht. Hatte die deutsche Geschichtsschreibung bis in die fünfziger Jahre hinein ein weithin positives Bild der Jahre zwischen 1871 und 1914 gepflegt, das sich vom Nationalsozialismus und der ungeliebten Weimarer Zeit abhob, kehrte sich seit den sechziger Jahren mit den Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer und der ›Bielefelder Schule‹ die Blickrichtung um. Fortan galten auch und gerade die gesellschaftlichen Strukturen des Kaiserreichs als ursächlich für den Ersten Weltkrieg und den Nationalsozialismus. In umfangreichen Forschungsprojekten versuchten Historiker nun, die Deformation des kaiserzeitlichen Bürgertums als Ursache der Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts dingfest zu machen. Letztlich aber scheiterte dieses Vorhaben, erwiesen sich doch das Kaiserreich als weniger undemokratisch und der Westen als weniger vorbildlich als gedacht. Fortan konzentrierte sich die Erklärung des Nationalsozialismus, erst recht des Holocausts, auf den Ersten Weltkrieg und Weimar, während die vom politisch-moralischen Erklärungszwang befreite Historiographie des neunzehnten Jahrhunderts ein vielschichtigeres Bild der deutschen Gesellschaft und Kultur entwickelte.« (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.1.2021)
Birgit Aschmann wirft Eckart Conze vor, »aus purer Abwehrhaltung veraltete Bilder vom Kaiserreich einzufrieren. Natürlich gab es die ›Schatten des Kaiserreichs‹, also Militarismus, Nationalismus und Obrigkeitsstaat. Aber erst in Kombination mit der breiten kultur- und politikgeschichtlichen Forschung, die die gegenläufigen Phänomene von Pluralisierung, Demokratisierung, Rationalisierung und Emotionalisierung in Politik und Gesellschaft betont, ergibt sich ein ›vollständiges‹ Bild jener Epoche.«
In der Wochenzeitung DIE ZEIT konstatierte die Historikerin Hedwig Richter in einer »Replik auf Eckart Conze«: »Das Kaiserreich war moderner, als seine Kritiker glauben.« Sie meint: »Die Diskussion, die (Conze) angestoßen hat, kreist letztlich um die Frage: Darf man der deutschen Öffentlichkeit neuere Erkenntnisse über das Kaiserreich zumuten, die ein komplexeres Bild zeichnen? Oder relativiert das die deutsche Schuld am Nationalsozialismus?« Und: »Zweifellos: Militarismus, Antisemitismus und Kolonialismus prägten das Kaiserreich. Doch sie lassen sich erst angemessen analysieren, wenn man sie als globale Phänomene begreift.« Schließlich meint Hedwig Richter: »Die Deutschen erlebten damals, wie die US-Historikerin Margaret Anderson schreibt, ›Lehrjahre der Demokratie‹ (und nicht nur den Aufstieg völkischer Bewegungen). Das Parlament entwickelte sich gegen das Toben des oft verspotteten Kaisers zu einer maßgeblichen Instanz.« (DIE ZEIT, 20.1.2021)
Auf Deutschlandfunk Kultur kommentierte dagegen die Historikerin Christina Morina: »Ich glaube, in dem Bereich sind sich auch die Historikerinnen und Historiker inzwischen einig, dass das eine Epoche war, die zur Vorgeschichte des heutigen Deutschlands gehört, die aber sehr kritisch gesehen wird, die als Machtstaat, als autoritärer Machtstaat eben keine Traditionslinie ist, in die wir uns heute bewusst stellen, sondern eine Epoche, die Gott sei Dank überwunden ist. (…) Es gibt starke Demokratiebewegungen, die nicht wegen oder mit dem System des Kaiserreichs, sondern trotz dieses autoritär verfassten, dieser konstitutionellen Monarchie gewachsen sind, die selbstverständlich zu unserer demokratiegeschichtlichen Tradition gehören – da ist die Sozialdemokratie ganz vorne zu nennen, aber selbstverständlich auch die Frauenbewegung und andere liberale und liberaldemokratische Vereinigungen. (…) Ich weiß nur nicht, was Sinn und Zweck einer Diskussion ist, die versucht, daraus Bezugspunkte zu holen. Denn insgesamt glaube ich, in der Gesamtbewertung ist es eben ein Staat, der die Demokratie nicht als Ideal vertrat, sondern sozusagen als Zugeständnis ermöglichte, wenn es passte.«
Außerdem findet auch Christina Morina: »Zur Geschichte der Bundesrepublik gehört immer auch ihre Herausforderung von rechter, nationalistischer Seite. Das ist etwas, was gerade in letzter Zeit – deshalb ist eben, glaube ich, die Diskussion um die Relevanz der Reichsgründung und des ersten deutschen Nationalstaates heute auch wichtig –, was in letzter Zeit eben auch wieder stark zunimmt und inzwischen in der AfD auch eine parlamentarische Repräsentation hat, die es in der Geschichte der Bundesrepublik niemals zuvor gegeben hat.«
In der Süddeutschen Zeitung wunderte sich der in Cambridge forschende Historiker Oliver F. R. Haardt, »mit welcher Emotionalität die Debatte über 150 Jahre Kaiserreich hierzulande unter Historikerinnen und Historikern geführt wird. Denn das ist längst nicht bei jedem wichtigen historischen Jubiläum in Deutschland so. Die Diskussion zur 500-Jahr-Feier der Reformation war beispielsweise deutlich nüchterner. Das Kaiserreich scheint dagegen nach wie vor einen besonderen Nerv in der Zunft zu treffen.« (Süddeutsche Zeitung, 3.2.2021)
Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung schob Joachim Käppner unter dem Titel »Des Kaisers alte Kleider« nach: »Das wilhelminische Reich war nicht besser als sein Ruf. Im Gegenteil.« (Süddeutsche Zeitung, 17.3.2021)
Es mutet schon ein wenig bizarr an, dass eine solche leidenschaftliche Debatte unter Historikerinnen und Historikern über die Interpretation des deutschen Kaiserreichs mit ihren unmittelbaren Bezügen in unsere Gegenwart, zur Politik von heute und zur deutschen Gesellschaft der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts vor der gerade wieder fertiggestellten Fassade des Residenzschlosses der deutschen Kaiser aufglüht. Denn dieses neuerdings wieder so heftig diskutierte, umstrittene, vielschichtige, offensichtlich vor allem aber deutungsbedürftige Deutsche Reich spielt notgedrungen eine Rolle, wenn man vor der neuen Illusionsfassade des alten Berliner Schlosses steht.
In dem am Ende eines solchen Buchs üblichen Dank heißt es in Eckart Conzes Schatten des Kaiserreichs: »Dieses Buch, das Geschichte und Gegenwart zu verbinden sucht, gäbe es nicht ohne die Familie Hohenzollern.« Der Autor hat sich als Historiker und als Publizist immer wieder zu dem Konflikt geäußert, der zwischen dem Haus Hohenzollern, vertreten durch dessen Oberhaupt Prinz Georg Friedrich, und Institutionen der Bundesrepublik Deutschland um die Restitutionsansprüche der Familie entbrannt ist. Es ist, wie schon erwähnt, zumindest auf den ersten Blick und rein juristisch betrachtet, eine Konsequenz aus dem Einigungsvertrag von 1991. Es ist aber darüber hinaus auch eine sehr späte Auseinandersetzung der Demokratie mit ihrem monarchisch-monarchistischen Erbe. Als gäbe es da noch etwas zu klären. Aber – vielleicht gibt es da ja auch noch etwas zu klären? So wie Menschen, die ihre Pubertät nicht ausgelebt haben, mitunter später Dinge tun, die sie besser in jugendlichem Alter getan hätten, was aber, aus welchen Gründen auch immer, unterblieben ist. Hat die Bundesrepublik Deutschland, die zu Recht stolz ist auf ihre weltweit als vorbildlich wahrgenommene Demokratie, etwa ein ungeklärtes Verhältnis zur Monarchie? Steht dahinter gar die mehr oder weniger ausgesprochene Sehnsucht von Bewohnerinnen und Bewohnern eines in vielerlei Hinsicht ausgeklügelt demokratisch austarierten Föderationsstaatswesens nach einer zentralen Instanz, die entscheidet – und zwar qua Amt und Aura? Ist also auch diese Debatte womöglich nicht ein überfälliger juristischer Akt der Entschädigung, sondern auch »schwieriges Erbe«? Länder wie Frankreich oder Österreich haben den Bruch der demokratischen mit der monarchischen Tradition sehr viel klarer markiert als die deutsche Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Muss man das ausgesprochen ausgeprägte Selbstbewusstsein der Hohenzollern gegenüber der Republik und das nicht ganz so ausgeprägte Selbstbewusstsein in umgekehrter Richtung womöglich in einem größeren Zusammenhang sehen, eine Entwicklung, die der Literaturwissenschaftler, Publizist und Professor emeritus der Stanford University Hans Ulrich Gumbrecht Ende 2020 in die Frage gemünzt hat: »Wie sollen wir Mitglieder der gebildeten Elite reagieren, falls sich herausstellen sollte, dass einer Mehrheit unserer Mitbürger bestimmte Formen sozialen und politischen Zusammenlebens vorschweben, die wir nicht mit gutem Gewissen als ›demokratisch‹ ansehen können?« (Süddeutsche Zeitung, 19.12.2020)
Seinen auf den ersten Blick provokant wirkenden Dank an die Familie Hohenzollern am Ende seines Buchs erklärt Eckart Conze folgendermaßen: »Die kontroverse öffentliche Diskussion über die Entschädigungsansprüche der Familie hat den letzten Anstoß gegeben. Es ist der Blick eines Zeithistorikers auf das Kaiserreich, geleitet von der Frage, welche Bedeutung der Nationalstaat von 1871 für die historische und politische Selbstverständigung der Deutschen nach 1945 hatte und bis heute hat.«
Vor allem zwei Debatten erscheinen Conze in diesem Zusammenhang alarmierend: die erwähnte um Restitutionsansprüche der Familie Hohenzollern und jene um den Bestseller Die Schlafwandler. Wie Europa in den ersten Weltkrieg zog des australischen Historikers Christopher Clark aus dem Jahr 2013, den viele als Plädoyer für eine deutsche »Kriegsunschuld« (Conze) gelesen haben, in Absetzung von einer in den vorangegangenen Jahrzehnten immer wieder von der Geschichtswissenschaft konstatierten »Kriegsschuld« Deutschlands – eine wichtige Voraussetzung für eine Geschichtsrevision, in der der deutsche Nationalstaat in einem deutlich freundlicheren Licht dastehen könnte, als er es nach 1945 weithin tat.
»Das Kaiserreich«, kolportiert Conze die Clark-Debatten von 2014, »werde in ein schlechtes Licht gerückt, es werde als autoritär und aggressiv charakterisiert, um das Deutschland des 21. Jahrhunderts zu treffen und es an einer selbstbewussten nationalen Politik zu hindern. Die 2017 erstmals in den Bundestag gewählte AfD plädiert für eine Außenpolitik, die sich an Bismarck orientiert, und beklagt in einem Parlamentsantrag, dass die ›gewinnbringenden Seiten der deutschen Kolonialzeit erinnerungspolitisch keinen Niederschlag finden‹. Zugleich wird darüber gestritten, ob der deutsche Völkermord an den Herero und Nama in den Jahren 1904 bis 1908 Entschädigungsleistungen rechtfertigt. Auch der Umgang mit Kunst und Kultur aus kolonialen Kontexten ist umstritten. Das zeigt nicht zuletzt die Diskussion über das im wiedererrichteten Berliner Stadtschloss der Hohenzollern beheimatete Humboldt Forum und seine Ausstellung.«
Hier begegneten sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des Berliner Humboldt Forums Ende 2020 zwei Debatten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten: die Debatte um die Ausstellung innerhalb des Gebäudes, also seine Nutzung, und die Debatte um die Fassade. Während beide Debatten neu belebt wurden und dabei an Profil und Schärfe gewannen, wuchs jene in Sandstein gemeißelte Projektionsfläche aus dem Kellergeschoss der deutschpreußischen Vergangenheit in die Höhe, von der hier die Rede sein soll.
Dass die erwähnten Debatten also vor der just in diesem Moment fertiggestellten Hohenzollern-Schloss-Fassade stattfinden, mag man einen Zufall nennen. Aber die Geschichte kennt die Kategorie des Zufalls nicht. Gleichzeitigkeiten kann man feststellen, oder man kann sie ignorieren – was sich am schnellsten und einfachsten, vor allem aber unter Vermeidung jeglichen argumentativen Aufwands erledigen lässt, indem man die Kategorie des Zufalls bemüht, dessen wesentliche Aufgabe ja gerade darin besteht, Zusammenhänge zu leugnen. Und dass man in diesem Fall die Debatte um die Funktion eines Gebäudes (und seine Botschaften) und die Debatte um seine Fassade (und deren Botschaften) voneinander trennen kann und sogar trennen soll, ist eine Besonderheit dieses Baus und der eigentliche Gegenstand dieses Essays.
Unmittelbar nach der in fast jeglicher Hinsicht – außer im Ergebnis eines geeinten Staates – vollkommen anders gearteten, neuerlichen Einigung zu einem zweiten deutschen Nationalstaat im Jahr 1990 kam in konservativen Kreisen der Gedanke auf, das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte, nach Kriegsende notdürftig reparierte und dann im Jahr 1950 im Auftrag von Walter Ulbricht gesprengte Berliner Schloss (nicht Stadtschloss) wieder aufzubauen. Die Idee war auch zu DDR-Zeiten schon ventiliert worden, damals allerdings mit wenig Hoffnung auf Realisierung. Der Fall der Mauer und die schnell folgende Einigung änderten diese Lage und gaben dem Traum von einem neuen Hohenzollern-Schloss inmitten einer neuen demokratischen Hauptstadt Auftrieb. Die Vereinigung war das Momentum, das die Protagonistinnen und Protagonisten eines Schloss-Neubaus für sich nutzen zu können meinten. Sie gaben sich der Illusion hin, auf diesem Weg architektonisch eine Wunde heilen zu können, die die unheilvolle Dynamik der Geschichte des 1871 gegründeten deutschen Reichs und ihre schwerwiegenden Konsequenzen der deutschen Nationalseele zugefügt hatten, tiefe narzisstische Kränkungen, die mit einer historisierenden Fassade natürlich so wenig geheilt werden können wie ein Bruch mit einem Pflaster. Aber, um im medizinischen Bild zu bleiben: Eine Prothese sollte die Amputation vergessen machen. So sehen es die Kritikerinnen und Kritiker. Die Befürworterinnen und Befürworter einer Schlossfassadenrekonstruktion halten die Operation offenbar für gelungen. Wobei noch nicht ganz geklärt ist, wie es dem Patienten geht. Genau besehen, gibt es zwei Patienten: die Institution Humboldt Forum, die sich hinter dieser Fassade formiert, und die Stadt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.