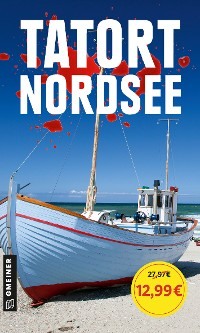Kitabı oku: «Tatort Nordsee», sayfa 2
2
Wiard Lüpkes war das, was man eigenbrötlerisch nennt. Er wohnte nicht allzu weit entfernt des Saathoff’schen Hofes. August verstand sich ganz gut mit ihm, sie hatten öfter mal miteinander zu tun, und wenn es nur das zufällige Treffen irgendwo in den umliegenden Poldern oder wie neulich in Norden war, bei dem man ein paar Worte wechselte. Dabei kebbelten sie sich immer, denn die politischen Ansichten von Wiard und August gingen durchaus nicht immer konform, manchmal diametral auseinander, aber sie akzeptierten sich. Früher hatte Wiard beim Finanzamt in Emden gearbeitet, bis ihm »das Amt und alles, was damit zu tun hatte, zum Halse raus hing«, und hatte seitdem keine feste Anstellung mehr gehabt. Die Leute hatten es kaum nachvollziehen können: »So eine Stelle auf’m Amt, Mensch, beim Staat, also, die gibt man doch nicht auf, heutzutage, bei mehr als fünf Millionen Arbeitslosen …«, »So gut wie verbeamtet.«, »Füße hoch, ein paar Einkommensteuererklärungen bearbeiten, und dann noch Gehalt dafür kriegen.« Wiard hatte das anders gesehen, und mit den paar Einkommensteuererklärungen war es auch nicht einfach so getan, er hatte es aufgegeben, mit den Leuten darüber zu diskutieren. Aber vor allem war ihm irgendwann, aus heiterem Himmel (oder doch nicht?) der Gedanke gekommen, warum er eigentlich acht Stunden täglich in dieser vermufften Bude saß und darüber gutachtete, ob jemand ein paar Euro Steuer zurückbekam oder nicht. Acht Stunden seines einzigartigen, einmaligen Lebens, von dem nun schon allerhand Jahre rum waren. Schließlich hatte er die Kündigung eingereicht, sogar den Betriebspsychologen des Kreises hatten sie ihm noch aufgehalst: »Herr Lüpkes, es ist aber sonst alles in Ordnung mit Ihnen?« Und: »In Ihrem Alter – also, da finden Sie keinen Job mehr, in der Wirtschaft sowieso nicht, aber im öffentlichen Dienst geht das auch nicht mehr …«
»Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder«, hatte er geantwortet, »und das, was ich für mich brauche, das kriege ich schon irgendwie zusammen, bin ja für sonst niemanden verantwortlich, nur für mich, na, das wird schon hinhauen.«
Am letzten Tag beim Finanzamt hatte er sich bei den Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, bei all denen, die er schätzte, und den anderen. Dann hatte er sich, nachdem er das Gebäude durch die Außentür verlassen hatte, noch einmal umgedreht und ein, zwei Minuten nachgedacht, dabei auf die Gemäuer des Amtes blickend: Das war’s, ab sofort wird gelebt, war es ihm durch den Kopf gegangen. Und gleichzeitig: Na, ich kann das so machen, andere nicht …
Jetzt half Wiard im Sommer bei verschiedenen Landwirten aus, er kannte ja fast alle hier und in den Nachbarpoldern, und mit einigen verstand er sich gut. Bei August hatte er ebenso hier und da geholfen. Auch beim Bau des neuen Laufstalles, schließlich hatte August zusammen mit dem Bankberater so viel Muskelhypothek veranschlagt, dass er es allein kaum schaffte. Im Winter ging Wiard tageweise Beschäftigungen nach, war bei einer Jobvermittlung gemeldet, und immer, wenn das Geld zur Neige ging, suchte er sich Arbeit. Die Rente reichte »allenfalls fürs Klopapier und ein Stück Butter«, obwohl er mehr als 18 Jahre im Finanzamt gearbeitet hatte, aber er hatte ein Haus – seine Altersvorsorge, vielleicht die sicherste. Das war auch so ein Zufall in seinem Leben gewesen, hatte aber seinen Entschluss, dem Amtmannsleben Ade zu sagen, maßgeblich beeinflusst. Ein Onkel vererbte ihm das Haus, als der mit über 85 Jahren plötzlich verstarb. Der Postbote hatte irgendwann mit einer Einladung zur Testamentseröffnung beim Notar vor ihm gestanden, und Wiard hatte keinerlei Idee, worum es sich handeln könnte. Nach dem Notarstermin war er Besitzer eines kleinen Hauses im Polder. Handschriftlich hatte sein Onkel auf das Testament gesetzt: ›Und dat du mi dat Huus in Ordnung hollst.‹
Im letzten Sommer hatte er über eine Zeitarbeitsvermittlung einen Job als Helfer beim Bau des neuen Deiches bekommen. Vier Monate ordentlich gerackert, dabei aber ganz gut verdient.
»Das reicht locker, um den Herbst und den Winter zu überstehen und ein paar Wünsche zu erfüllen, die ich so habe …«, hatte er zu August gesagt. »Da kann ich mal wieder meinen Hobbys nachgehen.« Zu seinen Hobbys gehörten ein Schaf, eine Ziege, zahlreiche Katzen, Hühner und ein Schäferhund. Außerdem fertigte er Kunstgegenständen aus Holz an. Die wollte er in einem kleinen Laden, den er in seinem Haus auszubauen gedachte, zum Verkauf anbieten, »gerade, wenn die Badegäste aus dem Binnenland kommen«, von denen er sich einen Nebenverdienst erhoffte (»die kaufen doch alles, was halbwegs nach Küste und Meer aussieht«). Und er war technisch up to date, hatte einen Laptop zu Hause stehen, DSL-6000-Anschluss, wusste über alle neuen Trends Bescheid.
»Das passt doch alles nicht zusammen«, behaupteten seine Zweifler im Polder.
»Und wieso nicht«, hatte August gegengefragt …
Jedenfalls war Wiard dieses Leben offenbar lieber als das mit Ärmelschützern vor immer wieder denselben Formularen.
»Verdienst unsicher, Lebensqualität aber wesentlich besser geworden – das wiederum sicher«, so verteidigte Wiard seinen Schritt gegenüber besagten Kritikern.
August hatte keine Ahnung, was Wiard mit ihm besprechen wollte und was das mit dem Deich zu tun haben könnte. Seine Gedanken drehten sich um die Zukunft des HSV, als er eine mehr als daumendicke, dabei aber schnell zerfließende Wurst eines hellblauen Shampoos in seine Hand drückte, um das Zeug auf dem Kopf in reichlich Schaum zu verwandeln, damit Dreck und Kuhstallgeruch verschwanden.
»Sonst kannst du gleich im Stall bleiben und bei deinen Kühen übernachten«, hatte Henrike schon des Öfteren bemerkt. August lächelte, als er an diese Worte dachte, und wusch die Haare umso gründlicher.
3
An diesem Abend saß Wiard Lüpkes über einem Haufen Papiere, den er intensiv studierte. Seit Wochen ging ihm der neue Deich nicht mehr aus dem Kopf. Das Land und private Investoren waren gemeinsam die Deichbauarbeiten angegangen – Klimawandel und daraus resultierender Meeresspiegelanstieg forderten ihren Tribut. Gut sah er aus, der neue Deich, mächtig und stabil, und jeden Abend zeichnete sich die gerade Linie der Deichkrone gegen den Horizont ab – vorausgesetzt sie hatten nicht mal wieder Sauwetter. Doch Wiard war eher beunruhigt. Und das, wie er meinte, aus gutem Grund. Er hatte selbst am Deich mitgearbeitet und später bei allerhand Stellen und vielen Personen Informationen eingeholt. Einem inneren Gefühl folgend, war er mehr und mehr dem Gedanken verfallen, dass mit dem Deich etwas nicht in Ordnung war. Die gerade Linie der Deichkrone kam ihm manchmal gar nicht so gerade vor. Er war diesem Gefühl nachgegangen und hatte aufgrund seiner Recherchen so seine Vermutungen. Doch was dieses Gefühl des ›Nicht-in-Ordnung-Seins‹ nährte, konnte er noch nicht in eine schlüssige, nachvollziehbare und vor allem glaubwürdige Erklärung umsetzen. So behielt er das Ganze erst einmal für sich. Tag für Tag war er zum Deich gegangen, hatte ihn gründlich in Augenschein genommen und den Eindruck gewonnen, dass nicht immer mit der Sorgfalt vorgegangen worden war, die man bei guter Deichbaupraxis hätte erwarten können. Hier und da Schludrigkeiten bei Pflasterungen am Deichfuß, kahle Stellen in der Grasnarbe (oder waren das Schafe gewesen? Nein, die machen die Grasnarbe ja eben nicht kaputt), insbesondere aber der Eindruck, dass es Stellen gab, an denen der Deich ›weich‹ war, machte ihm zu schaffen. Dieses Gefühl versuchte er mit seinen Recherchen und den Erfahrungen während der Zeit, die er selbst am Deich mitgearbeitet hatte (einige Monate sozusagen als ›Mann für alles‹), in Einklang zu bringen. Er wusste, so dachte er, ein paar Dinge, die andere nicht wussten und die er bislang als unwichtig abgetan hatte. Jetzt wurde er diesen Gedanken nicht mehr los. Und neulich hatte er beim Feuerwehrfest im Polder einen über den Durst getrunken und Georg Redenius (»hohes Tier bei der Küstenschutzbehörde«; was hatte der da eigentlich verloren?) erzählt, der Deich sei doch »qualitativ eine Katastrophe, einfach scheiße gebaut«, das hätte doch nur mit »Bestechung und Korruption« zugehen können, dass diese Pfuscherei durch die beaufsichtigenden Behörden nicht geahndet worden sei. Klar, am nächsten Morgen hatte er sich sehr über diese Äußerungen geärgert (sofern er noch von ihnen wusste), aber ihm war im Kopf geblieben, dass Redenius, den er rein zufällig bei einigen Runden Schnaps kennengelernt hatte, plötzlich sehr ernst geworden und etwas rötlich im Gesicht angelaufen war und, als Wiard weitersprach, ihn angefahren hatte, er solle jetzt aufhören mit dem Deich, sonst bekomme er eins auf die Nase … So reagierte man doch nicht, zumal Wiard gleich beschwichtigt hatte, es wäre doch nur ein Spaß gewesen (obwohl er es eigentlich ernst gemeint hatte).
Der Vorfall lag nun aber schon einige Zeit zurück, und Wiard kramte wieder in seinen Deichunterlagen, in Plänen, Karten, Notizen, sah sich Fotos an, analoge und digitale, alle vom Deichbau und vom Deich jetzt, wie er dort stand. Wiard dachte nach. Immer wieder betrachtete er die Bilder der Stellen, an denen die achtkantigen Steine unten, am Außendeich auf der Asphaltabdeckung, ein wenig eingesackt waren. Es fiel dem Laien sicher nicht gleich auf, doch Wiard kannte den Neubau und den jetzigen Zustand, nur wenige Monate später. Wie konnte das sein? Und – durfte das sein?
Wiard wollte gerade einen Schluck aus der Tasse dampfenden Tees nehmen, die neben ihm auf dem Schreibtisch stand. Plötzlich ein lauter Knall. Die vorherige Stille und Gemütlichkeit des kleinen Landhauses wurde von einem Klirren und Splittern durchbrochen. Glasscherben flogen umher. Sich zur Seite drehend, sah Wiard einen Gegenstand durch das Fenster fliegen, duckte sich instinktiv, was nichts nutzte, denn ein harter Schlag traf ihn am Kopf. Der Treffer saß – etwas unterhalb der linken Schläfe. Wiard kippte seitlich vom Stuhl, einem alten, vierrädrigen Schreibtischstuhl, der sich jetzt unter ihm wegdrehte. Auf dem Boden liegend, fühlte er noch mit der rechten Hand an die pochende Stelle. An seinen Fingern klebte Blut. Sein Kopf dröhnte, es war kaum auszuhalten. Dann wurde es dunkel um ihn.
4
August und Henrike hatten es tatsächlich noch zu dem gemeinsamen Glas Wein geschafft. Er war gut gewesen (der Wein), und am nächsten Morgen stand August gegen 6 Uhr wieder im Melkstand. Er hatte seinem Vater gesagt, er solle liegen bleiben, da es am Abend vorher sicher spät werden würde. Die Vorstellung der Heimatbühne hatte, Pause eingerechnet, bis weit nach zehn gedauert, und meistens trifft man in einer kleinen Stadt ja noch den ein oder anderen Bekannten. Augusts Eltern lagen in der Regel zwischen neun und halb zehn im Bett, jetzt im dunklen Herbst sowieso, da war ein Nachhause-Kommen kurz vor Mitternacht die absolute Ausnahme, über die man noch lange würde reden können. Er war sich dennoch sicher, dass sein Vater früher oder später auftauchen würde. Nach so vielen Jahrzehnten des Daseins als Bauer war ihm das morgendliche Melken in Fleisch und Blut übergegangen. Augusts Vater konnte nicht anders – und hätte es als bedrohliche Alterserscheinung empfunden, morgens das Melken zu versäumen. Warum auch, dachte er, sollte er sich – obwohl er noch mitanpacken konnte – hinsetzen und Däumchen drehen? August und Henrike versuchten ihm immer wieder klarzumachen, dass er sich vielleicht am Ende doch ärgern würde, wenn er immer nur gearbeitet und nicht auch noch ein wenig den Lebensabend genossen hätte. Dazu meinte der alte Saathoff, die Arbeit auf dem Hof sei »sein Leben« und nichts genösse er mehr als diese. Aber er unternahm nun gelegentlich Dinge mit seiner Frau, die er früher nie gemacht hatte, eben – wie am Abend zuvor – mal zur Heimatbühne gehen (»dat word laat, dat word laat« – seine Sorge über den langen Abend war gegen die Vorfreude auf das Theaterstück in der Stadt kaum aufzuwiegen).
Nach dem Melken wollte August zu seinem neu gepachteten Ackerland fahren. Wieder hatte ein Bauer im Polder aufgegeben – auch eine Folge der Politik, die immer noch auf zunehmend größere Einheiten setzte, wobei die Kleinen kaputtgingen, wenn sie sich nicht ganz besonders spezialisierten. Einige Biohöfe fristeten ihr Dasein, nur wenigen ging es finanziell wirklich gut. Die konnten es sich leisten, die Kühe, Schweine und Hühner frei rumlaufen zu lassen und damit zu werben – aber dementsprechend waren die Erzeugnisse für den Durchschnittsbürger auch kaum bezahlbar, wie August immer wieder betonte, wenn es sich um dieses Thema drehte. Er selbst war konventioneller Landwirt mit der festen Überzeugung, ökologischer zu sein als mancher, der sich so bezeichnete. Das war seine Meinung. Da hatte Wiard andere Ansichten. Aber diese Gedanken flogen ihm während des Melkens nur so zeitweise durch den Kopf. Wie sie eben kommen und gehen, wenn man gerade etwas ganz anderes macht. Eigentlich wollte er überlegen, was er zu seinem neuen Pachtland mitnehmen sollte, schließlich musste es für das Frühjahr so fit gemacht werden, dass er darauf aussäen konnte, und da war noch einiges vorzubereiten.
Auf dem Weg dorthin würde er kurz bei Wiard vorbeischauen, der nicht viele Leute im Polder hatte, mit denen er ernsthaft reden konnte. Und das tatsächlich besonders, seitdem er nicht mehr beim Finanzamt arbeitete. (»Da kannst mal sehen, worauf viele Leute ihre Urteile über andere gründen«, hatte er zu August gesagt. Dem war dabei ein Licht aufgegangen.) Aber Wiard hatte natürlich damals auch den Lohn- oder Einkommensteuerantrag einiger Polderbewohner auf den Tisch bekommen, was für fast alle der Anlass war, sich zwar mit ihm gut zu stellen, aber dennoch sehr zurückhaltend zu sein. Sie wussten nicht, für welche Buchstaben im Alphabet er zuständig war, und wenn er vielleicht nicht direkt ihre Anträge bekam, so kannte er ja doch die Kollegin oder den Kollegen (»Also, der Lüpkes weiß doch, dass das Zimmer, dass ich jedes Jahr als Arbeitszimmer absetze, nichts anderes ist als unsere Wäschekammer …«). Wiard hatte zwar öfter erklärt, dass er ohnehin über keinerlei Handhabe verfüge angesichts strenger Richtlinien und Maßstäbe der Finanzverwaltung (auch wenn immer wieder welche gekommen waren, etwa beim Sportfest, und Wiard einen ausgaben mit den nur wenig später folgenden Worten: »Du Wiard, du büst doch bi’t Finanzamt, kannst du neet so ’n bittje doran dreihen, dat ick neet jümmers so vööl Stüern betalen mutt, ik hebb da ’n Idee …«). Auch das hatte er schließlich aufgegeben. Den Leuten zu erklären, dass das eben doch kein Selbstbedienungsladen sei, der für die, die Beziehungen haben, mehr Kohle lockermache als für andere, dazu hatte er einfach keine Lust mehr. Gleichwohl wusste Wiard tatsächlich über die finanziellen Verhältnisse einiger Polderbewohner ganz gut Bescheid, hatte zwar Stillschweigen darüber zu bewahren, aber einige trauten ihm eben bis heute nicht. Seitdem er nun nicht mehr Amtmann war (nach den Sportfesten war er tatsächlich ein ums andere Mal voll wie ein Amtmann gewesen …), sondern freien Tätigkeiten mehr oder weniger nach Lust und Laune nachging, er außerdem besagte Hobbys weiterentwickelte, die in der Allgemeinheit des Polders und darüber hinaus eher als ›spinnert‹ abgetan wurden (»wat kann man dor mit denn anfangen?«), steckte er nun in einer Schublade. Und aus einer solchen kam er für die meisten Polderbewohner nicht mehr raus. Dazu beigetragen hatte wohl auch sein wachsendes Interesse an fernöstlichen Religionen, das wiederum auf sein Äußeres Einfluss nahm. Das kam nicht bei jedem gut an im Polder (»Kiek, Bhagwan ist weer unnerwegens …«, spottete manch einer), andere ignorierten es.
August und Henrike hatten den Kontakt nicht einschlafen lassen. Sie hatten sich mit Wiard während seiner Amtszeit gut verstanden, und das sollte sich nicht ändern – schließlich hatte jeder das Recht, sich für andere Wege zu entscheiden. Wiard war vielleicht kein Freund, aber ein guter Bekannter, der, solange er es umgekehrt genauso hielt, nicht einfach links liegen gelassen werden sollte. Außerdem hatte er immer eine Menge interessanter Dinge zu erzählen. Er war stets auf dem neuesten Stand der Politik und hatte auch sonst »viel Ahnung«, wie August betonte (»der hat ja auch die Zeit dazu, Zeitungen und Bücher zu lesen …«). Augusts Kinder mochten Wiard. Freerk meinte, der, ja, der hätte wenigstens mal Ahnung. August beeindruckte diese sich völlig von der Sichtweise vieler Polderbewohner unterscheidende Haltung seines Sohnes.
August Saathoff stieg gegen 10 Uhr auf seinen Deutz-Schlepper und startete den Motor. Er schaltete auf der gut ausgebauten Zuwegung zur Hauptstraße schnell in den dritten Straßengang, stellte das Radio an, wippte ein paar Mal in dem gefederten Sitz auf und ab und dachte: Tolle Maschine. Ihm fiel der alte Witz ein, in dem ein Autofahrer mehrfach seinen Händler aufsucht, weil sein Motor immer schon nach der ersten Fahrt kaputtgeht. Nachdem dieser ihm das dritte Auto mitgibt (»sie haben ja noch Garantie …«), will er dann doch wissen, wie der Mann denn fahre. Da erklärt der andere, dass er ganz normal anfahre, dann hoch schalte, erster, zweiter, dritter Gang. Dann in den vierten und wenn das Auto dann richtig schnell wäre, dann würde er auf ›R‹ – den Ralleygang – schalten. Mann, hatte der ’n Bart, aber August musste immer wieder darüber lachen. Auf Plattdeutsch machte er sich allerdings am besten, etwa, wenn Hannes Flesner ihn erzählte, auf einer dieser alten Platten.
Auch den Schlepper hatte August vor nicht allzu langer Zeit angeschafft. Günstige Konditionen bei der Bank, da er trotz der schon erheblichen Investitionen in den Hof und den neuen Kuhstall nebst Melkstand bereits ordentlich gezahlt hatte. Nun war er optimal ausgerüstet, und auf diesbezügliche Bemerkungen erwiderte er nur: »Und bis ans Lebensende verschuldet bis über beide Ohren …« (»Ach, macht dir doch nichts, Landwirte verdienen doch mindestens 135.000 netto«, ärgerte ihn sein Nachbar immer wieder, wenn sie im Dorf oder auch über die Hecke hinweg sprachen. Das Ganze endete meistens bei einem Bier im Garten und einem »Mit der Hälfte bräuchte ich mir schon keine Sorgen mehr machen« von August.)
Nach knapp zehn Minuten kam er an Wiard Lüpkes’ Haus vorbei. Er verlangsamte die Fahrt und hielt schließlich am Straßenrand. Das Haus verfügte über eine breite, stabile Zufahrt, aber August wollte sich nicht lange aufhalten und sparte sich ein Ein- und Ausfahrtmanöver. Kurz überlegte er sogar, ob er den Motor laufen lassen sollte, aber die Zeiten waren nun endgültig vorbei, der Klimawandel ließ grüßen, und es war auch nicht mehr notwendig, zumindest nicht aus Gründen des Nicht-wieder-Anspringens. Der Deutz lief immer an, auch bei extremen Minusgraden, wenn es die denn mal gab (»wor’t doch immer warmer bi de Treibhauseffekt …«).
Wiard hatte Augusts Ankunft bemerkt und stand schon vor der Tür, als Letzterer sie erreichte. Das kleine Landhaus war knapp 80 Jahre alt, von der Form her wie ein alter, großer friesischer Hof gebaut, aber eben in sehr kleiner Ausführung: vorne das Wohn-, hinten das Stallgebäude, roter Klinker, rote Dachziegel, weiße Fenster, »alles Thermopane, eingesetzt, als ich noch Amtmann war«, wie Wiard zu betonen pflegte. Dabei sprach er das ›Thermopane‹ wie sein verstorbener Onkel aus: Täär-mo-paaane.
»Moin Wiard«, grüßte August und riss gleich die Augen auf, als er den Verband um dessen Kopf gewahrte.
»Moin.«
»Was ist denn das?«
»Ein Verband, was sonst?«
»Bist du duhn gegen ’ne Laterne gelaufen, oder was?«
»Schön wär’s«, entgegnete Wiard mit etwas Bitterkeit in der Stimme, »nee, ich fürchte, das ist etwas Ernstes …«
»Wie, was Ernstes, was meinst du?« August verstand nicht. Wie auch.
»Hast du ein bisschen Zeit? 15, 20 Minuten? Ich möchte dir gerne etwas Vertrauliches sagen, aber so zwischen Tür und Angel geht das nicht, dann lieber etwas später.«
»Hm, eigentlich wollte ich noch vor Mittag mein neues Stück abschreiten und gucken, was noch so in diesem Herbst gemacht werden muss, heute Nachmittag komme ich da nicht zu, und wenn ich jetzt zu lange warte, klappt’s auch nicht mehr vor Mittag, und …«
»Lass man gut sein, ich bin nicht böse, wenn’s nicht gleich klappt. Hat Zeit, dann warten wir eben. Wenn du es drock hast, kann ich das verstehen. Ich find’s gut, dass du gleich vorbeigekommen bist – und dass Henrike nicht vergessen hat, es dir zu sagen. Außerdem bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Die Nacht im Krankenhaus war nicht so prickelnd, zumal es reiner Zufall war, dass Jan Peters mich gefunden hat. Der wollte nur noch auf ein Pils und einen Kurzen zu mir rüberkommen. Es war Licht, aber ich kam nicht an die Tür. Da offen war, kam er einfach rein und hat mich am Boden liegend gefunden …«
»Am Boden liegend?«, fuhr August dazwischen.
»Ja, am Boden liegend, verletzt, am Kopf eben. Der Blutfleck in meinem schönen Teppich ist nicht ohne …«
»Mann, was ist denn nun passiert, Wiard?«
»Habe einen auf den Deez bekommen. Erkläre ich dir heute Abend, das geht nicht so mal eben. Ich muss dir sowieso eine ganze Menge erzählen, deshalb habe ich Henrike Bescheid gesagt, und die hat ja dran gedacht.«
»Ja, Henrike, nee, die vergisst nicht so leicht etwas, ganz im Gegensatz zu mir. Also, gut, wenn du jetzt nicht erzählen willst … Wenn’s geht, würde ich heute Abend so um halb neun eben vorbeischauen, wenn die Kinder im Bett sind. Dann haben wir ’ne Stunde, ich bring zwei Jever mit.«
»Lass man, ich hab selbst ’ne Kiste da, obwohl’s noch ganz schön wummert, im Kopf, wenn der Blutdruck steigt«, lachte Wiard und streckte ihm schon die Hand zum Abschied entgegen.
»Prima, oder, was heißt prima, sieht echt böse aus. Also bis heute Abend!« August bestieg seinen Trecker und setzte die Fahrt voller Gedanken und mit schlechten Vorahnungen fort. Woher die kamen, wusste er allerdings nicht, doch erhaschte er noch einen Blick auf Wiard mit verbundenem Kopf.
August fuhr an verschiedenen Höfen, alten, kleinen und neuen, größeren Häusern vorbei, an der kleinen Kirche und am Feuerwehrhaus, bei dessen Anblick ihm einfiel, dass diese oder nächste Woche wieder ein Übungsabend ins Haus stand. Doch wohl nicht heute Abend?, dachte er, dann müsste er Wiard wiederum versetzen. Er ärgerte sich kurz über sein miserables Gedächtnis, sah dann aber schon von Weitem sein Stück Land und lenkte seinen Trecker an den Stacheldrahtzaun heran, der sich hier leicht öffnen ließ. Mit geübtem Blick schätzte er die Fläche auf knapp vier Hektar ein – nicht schlecht, und die jährliche Pacht war angesichts des guten, fruchtbaren Bodens durchaus angemessen. Leider zahlte er sie nicht dem ehemaligen Besitzer, der hatte alles verkaufen müssen, sondern einem Dr. Kümmermann in Düsseldorf, der das Hofgebäude zu Ferienwohnungen ausbauen wollte und mit dem Land ›nichts anfangen konnte‹. August ging konform mit vielen Polderbewohnern, die es nicht gut fanden, dass sich mehr und mehr Binnenländer die Höfe und Landstellen zu eigen machten, deren vormalige Eigentümer diese aus finanziellen Gründen oder mangels Nachkommen (oder deren Desinteresse am Polderleben) verlassen hatten und jetzt mitunter in kleinen Mietwohnungen in der Stadt lebten. So tummelten sich hier im Sommer zusehends mehr Touristen, was auf die ›gute, alte Dorfgemeinschaft‹ durchaus Auswirkungen hatte. Im Winter jedoch wurde es immer einsamer in diesem Landstrich. Das Geld saß eben in anderen Regionen der Republik. So war der Lauf der Dinge, was sollte man schon dagegen tun. Nutzte ja eh nichts.
Sommergerste wäre die richtige Entscheidung, dachte sich August, als er nach einer Umrundung seines neuen Ackers wieder an den Ausgangspunkt zurückgekehrt war. Vor seinem inneren Auge sah er schon die grünen, langen Grannen im Frühsommerwind hin- und herschwanken. Er mochte Gerste – es gab kein schöneres Getreide, und der Blick bei untergehender Sonne gen Westen über ein reifendes Gerstenfeld ließ sein Landwirtsherz höher schlagen.
Er würde sie am schönsten Gerstenfeld des Nordens entlang ins Glück führen, hatte er Henrike gesagt, als sie sich entschlossen hatten zu heiraten. Und bis jetzt hatte das Ganze ja auch gut hingehauen, obzwar Henrike gerne entgegnete, ein ›Entlang-der-Binnenalster-in-Hamburg‹ oder ›Über-den-Kudamm-in-Berlin‹ (»oder die Champs-Élysées in Paris, oder …«) wäre auch eine nette Alternative. Abwechslung hatte der Schnoor in Bremen geboten, zwei Wochenenden ohne Kinder und ohne Melken. Augusts Eltern hatten auf die vier aufgepasst, ein für alternde Leute nicht unbedingt leichtes Unterfangen. Ebenso wie bei dem Wochenende in Venedig, das war jetzt schon über fünf Jahre her, und August meinte immer noch, das sei wohl die sagenhafteste Stadt, die er je gesehen hätte, auch wenn es an zwei von drei Tagen Bindfäden geregnet hatte (am Markusplatz und in vielen Straßen und Gassen war Land unter gewesen, aber die Venezianer nahmen’s gelassen, zur Not kombinierte man eben den Anzug oder das kleine Schwarze mit Gummistiefeln). Weitere Touren hatten bislang sowohl der Hof als auch die Kinder verhindert. Es war nicht einfach, sie unterzubringen, denn die vier waren nicht leicht zu bändigen, auch wenn Freerk schon 16 war, Karina, die Große, schon sechs. Wienke war vier und Gero, der Kleinste, gerade eineinhalb Jahre alt. »Schon 16 Jahre«, dachte August nur, als er sich auf den 120er setzte und wieder nach Hause fuhr. Nach Freerks Geburt hatten August und Henrike zunächst noch viele Pläne, wollten eine Zeit lang gar bei einem Kind bleiben, hatten sich dann aber entschlossen, doch noch ein weiteres Kind zu bekommen. Das hatte erst einmal nicht so geklappt, doch schließlich waren sogar noch drei geboren worden.
»Da ist es dann plötzlich noch mal richtig rundgegangen bei den Saathoffs, hätte ich August gar nicht mehr zugetraut«, wie ihr Nachbar zu diesem Thema bei feierlichen Anlässen, spätestens nach dem dritten Bier und mit strahlendem Gesicht gerne zu bemerken pflegte. Henrike, die diesen Nachbarn, aber auch den Spruch nicht sehr mochte, pflegte dann zu entgegnen: »August brauchte ja auch nur seinen Senf dazugeben, das ist weniger kompliziert, die Arbeit liegt dann neun Monate bei der Frau, na, und danach …«, was den Nachbarn in der Regel zum Schweigen brachte.
Im Haus schlug August ein überaus wohliger Geruch entgegen, der ihm anzeigte, dass Henrike Mittagessen gemacht hatte. Es war fast 14 Uhr, die Kinder waren aus der Schule zurück, der Kleine würde vielleicht schon schlafen.
»Moin, min Muuske«, begrüßte er seine Frau, als er in die Küche kam, »das riecht aber gut.«
»Rouladen mit Kartoffeln und Bohnen, die beiden Letzteren aus unserem Garten«, entgegnete Henrike.
»Ha, wenn das nichts ist – ökologisch-dynamisch und trotzdem billig. Sonst was Wichtiges?«
»Freerk hat eine ziemlich miese Mathearbeit zurückbekommen. Mindestens eine Fünf, genau wollte er es mir nicht sagen. Im Moment ist er am Boden zerstört – vielleicht gehst du mal nach oben und erzählst ihm, wie du früher in Mathe warst.«
»Lieber nicht. Nachher schmeißt er die Schule und wird Bauer.«
Beide lachten, und obwohl August sich liebend gerne direkt an den Tisch gesetzt hätte, ging er zunächst nach oben, um ein Wort von Mann zu Mann mit seinem Sohn zu reden.
Eine Fünf in Mathe, mein Gott, es gab wahrlich Schlimmeres auf dieser Welt, dachte er, doch als er in Freerks Zimmer kam, sah es so aus, als denke dieser ganz anders darüber.
»Wenn’s man nicht schon die zweite wäre«, bemerkte er geknickt, als sein Vater hereinkam.