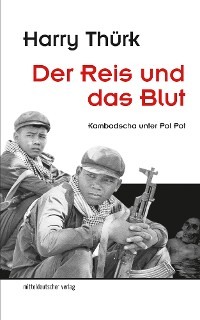Kitabı oku: «Der Reis und das Blut», sayfa 2
PHNOM PENH – Juli 1979
Die drei jungen Männer ähnelten einander. Nicht nur, daß sie annähernd gleich alt erschienen, sie sahen auch gleich zerlumpt aus in ihrer geflickten schwarzen Kleidung, ihre Gesichter waren gleich schmal, ausgemergelt, und selbst ihre Haare waren auf die gleiche Weise lieblos gestutzt, glichen Zotteln. Die Augen der drei verrieten eine seltsame Mischung von Abgeklärtheit und Neugier, Tatendrang vielleicht, und Hoffnung.
Der vierte in der Runde, die auf der ramponierten Balustrade eines ehemals prächtigen Pavillons am Ufer des Tonlé Sap saß, in der Nähe des nicht so recht in die Umgebung passenden Wassertanks, war anders. Er war kein Khmer, sondern ein Inder. Älter als seine drei Gesprächspartner, bedächtig fast sah er aus, wenn er sie anblickte, wenn er Fragen stellte, wenn er die Antworten nicht nur in ihren Worten suchte, sondern auch in ihren Blicken. Er war im Gegensatz zu ihnen exakt gekleidet, sein ergrauendes Haar war ordentlich gekämmt, und er trug eine elegante Goldrandbrille. Auch hatte er Schreibzeug bei sich und machte sich immer wieder Notizen. Aus seinem Gesicht war nicht abzulesen, was er dachte. Es wirkte verschlossen, als wolle der Mann eine Art schützenden Wall aufrichten zwischen sich und dem, was er auf seine Fragen erfuhr.
Er kannte die drei jungen Männer seit einigen Tagen. In einem notdürftig instand gesetzten Haus hatte er ein Büro ausfindig gemacht, das sich um die ausländischen Journalisten kümmerte, die den Prozeß der neuen Regierung gegen Pol Pot und seine Helfershelfer verfolgten, der soeben begonnen hatte. Es war dem indischen Reporter erlaubt worden, sich in der Zeit, die er nicht beim Prozeß verbrachte, mit Bürgern zu unterhalten, die das, was da verhandelt wurde, am eigenen Leib gespürt hatten – drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage lang, so oder so.
Im Flußhafen, wo die Hilfsgüter aus Vietnam ankamen, war er auf Kim Sar gestoßen, der Säcke mit Reis aus einem Lastkahn an Land trug. Ung Phim war später hinzugekommen, als Gesprächspartner, auch Yong Sok, der durch besondere Umstände in seinem Leben sogar die Zeitung kannte, die den Inder aus Delhi hierher, nach Phnom Penh, entsandt hatte.
Sie rauchten alle in Hanoi hergestellte »Thang-Long«-Zigaretten, und als der Inder das Aroma lobte, klärte Kim Sar ihn lakonisch auf: »Wir haben sie eingetauscht. Bei einem vietnamesischen Kapitän. Gegen ein chinesisches Fernglas. Das lag auf einem Haufen anderen Gerümpels, von irgendeinem Pol-Pot-Offizier weggeworfen …«
»Gibt es für Sie Anlaß zu Freude?« fragte der Inder. Die drei schwiegen. Dachten nach. Schließlich bemerkte Yong Sok, der bei genauer Betrachtung der Feingliedrigste, Schmalste von ihnen war: »Eine schwierige Frage, Mister. Natürlich freuen wir uns, weil wir überlebt haben. Jeder auf seine Weise. Daß wir nicht zu den drei Millionen Toten gehören, die das Regime Pol Pots hinterlassen hat. Aber – was für eine Art von Freude ist das? Sehen Sie sich unser Land an! Man hat es einmal die Perle Südostasiens genannt. Und heute? Zählen Sie die Ruinen, betrachten Sie die verwüsteten Städte, die Asche der Dörfer, verweilen Sie mit Ihrem Blick auf den herrlichen Zuckerpalmen, die rings um die ehemalige Markthalle von Phnom Penh wachsen – unter jeder von ihnen liegt ein Mensch begraben. Erschlagen und mit einem Palmensamen auf der Brust eingescharrt. Sehen Sie sich unsere Schulen an, die Krankenhäuser, die Pagoden, alles. Wenn Sie das getan haben, werden Sie spüren, daß Freude etwas anderes ist, als was wir heute empfinden. In uns ist das Salz der Bitterkeit. Die Asche der Toten trübt unseren Blick. Die Schreie der Sterbenden hören wir in den Nächten, im Schlaf. Was ist heute in unseren Herzen? Vielleicht erst eine Vorstufe von Freude. Erleichterung …« Der Inder erinnerte sich: »Einer der Ankläger hat gesagt, selbst die steinernen Apsaras, die Gespielinnen der ehrwürdigen Götter, verfluchen die Mörder …«
Ung Phim, der bisher geschwiegen hatte, nur gelegentlich mit den Fingern der rechten Hand über die Stelle an der linken strich, an der ihm zwei Finger fehlten, sprach vor sich hin: »Apsaras fluchen nicht, Mister. Sie klagen. Ich kann es hören, nachts. So wie Kim Sar und Yong Sok die Schreie der Erschlagenen hören.«
Der Inder gestand ihm: »Ich habe die Anklagen gelesen und einige der Zeugen gehört. Man hat mir in einem Gefängnis einen dreizehnjährigen Jungen gezeigt, der einhundertfünfundachtzig Menschen mit einer Rodehacke totgeschlagen hat, wie er selbst erzählte. In der ehemaligen Oberschule hier, die als Gefängnis diente, unter Pol Pot …«
»Tuol Sleng«, ergänzte Yong Sok. »Ich bin dort zur Schule gegangen. Zwölftausend sind es insgesamt gewesen, die man da ermordet hat. Und von jedem wurde vorher ein Foto gemacht.«
»Der Dreizehnjährige antwortete mir auf die Frage, warum er tötete, die Angkar habe es befohlen, das sei die höchste Autorität gewesen, die Organisation. Wer sich hinter dieser Bezeichnung verbarg, wußte er nicht genau, nur daß er bedingungslos ihre Befehle zu befolgen hatte. Die Getöteten seien alle Parasiten gewesen, nicht wertvoller als Kakerlaken. Im übrigen habe er es so gemacht, daß die Leute gleich beim ersten Schlag tot gewesen seien …«
Kim Sar drehte den Kopf zur Seite und tippte auf eine Stelle im Genick. »Hierhin schlugen sie. Man hatte sie belehrt, das sei die beste Stelle.«
»Warum?« Der Inder hob hilflos die Hände. »Was war diese ominöse Angkar? Konnte sie Menschen verzaubern? Aus Anständigen Bestien machen? Und – warum das viele Morden? Wie kam es dazu? Und wieder – warum?«
»Eine weitere schwierige Frage«, bemerkte Yong Sok.
»Können Sie sie nicht beantworten? Oder wollen Sie das nicht?«
»Wir können Ihnen erzählen, wie es begann«, sagte Kim Sar, »und wie es weiterging. Aber es würde Tage dauern, Ihnen alles begreiflich zu machen, Mister.«
»Ich habe viele Tage Zeit!«
»Nun gut«, meinte nach einer Weile Ung Phim. »Wir arbeiten alle drei an den Kais. Hier werden Leute gebraucht, die anpacken können. Aber wir haben stets drei Stunden Mittagsruhe, wenn die Hitze am schlimmsten ist, weil die Sonne am höchsten steht. Seien Sie um diese Zeit hier, unter dem Wassertank. Was wir wissen, werden wir Ihnen erzählen …«
Als der Inder sich am nächsten Mittag dort einfand, hockten die drei bereits im Schatten. Zigaretten glühten. Ung Phim wies auf Kim Sar. »Es wird am besten sein, wenn er beginnt. Seine Erfahrungen reichen am weitesten zurück. Durch besondere Umstände geriet er in den Führungskreis der Angkar. Und er hat da so manches über die Vorgeschichte der Tragödie erfahren …«
Am Kai war Motorengeräusch laut geworden. Eine Barkasse legte ab. Draußen im Strom, der eigentlich der Mekong war, zumindest ein Nebenarm von ihm, der hier den Namen Tonlé Sap trug und sich gute hundert Kilometer nordwestlich in den Großen See ergoß – von jeher ein reiches Fanggebiet für die Fischer –, ertönte der kreischende Schrei einer Bootssirene. Ein leichter Luftzug bewegte an den Resten einer Pagode unweit des Ufers das letzte, nicht zerstörte Glöckchen. Ein heller, einsamer Ton.
Der Inder blickte Kim Sar fragend an. Dieser nickte. Dann begann er zu berichten. Manchmal stockte er, als ob er nachdenken müsse. Dann wieder wurde seine Stimme leiser, als habe er jetzt noch Furcht vor dem, was er beschrieb.
Tage vergingen. Immer wieder saß der Berichterstatter um die Mittagszeit mit den jungen Männern unter dem Wassertank. Schrieb. Brachte schließlich, als auch die anderen erzählten, ein kleines Tonbandgerät mit und nahm auf, was gesprochen wurde. Die drei wechselten einander ab. Es schien ihnen ein Bedürfnis zu werden, dem Fremden alles mitzuteilen, woran sie sich erinnerten. Sie wollten, daß er sie verstand, das Ausmaß der Tragödie begriff, die sie durchlebt hatten und von der die Leute in der übrigen Welt Kunde erhalten sollten, über die spröden Berichte der Zeitungen hinaus. Nachempfinden – würde das möglich sein? Begreifen? Sie wußten es nicht. Und auch der Inder wußte nicht, wie er es anderen würde begreiflich machen können …
KIM SAR, 32 Jahre
Ich bin in Phnom Penh, in der Vithei Samdech Hinn, aufgewachsen, nicht weit von dem Platz, an dem unser Unabhängigkeitsdenkmal steht. Wir nannten es als Kinder die Pagode auf zwei Füßen, weil es so aussieht. Man kann hindurchgehen zwischen den Füßen, erst treppauf, dann treppab. Alles edler Stein. An Feiertagen stets besonders sauber geschrubbt. Sonst allerdings konnte es schon einmal vorkommen, daß ein Rikschafahrer sich dort vor dem Regen unterstellte, in der nassen Jahreszeit, wenn die Schauer plötzlich niederprasselten. Man erzählte sich sogar, Rikschafahrer hätten nicht selten unter dem Denkmal die Nacht hindurch geschlafen.
Wenn Sie unsere Stadt genau durchforschen, entdecken Sie, daß es sechs große, sehr lange Straßen gibt, sie verlaufen nahezu parallel, von Nordwesten nach Südosten. Vom Osten angefangen sind das die Monivong, dann die Trasak, die Pasteur, die Norodom, die Yukanthor und, am Flußufer, die Vithei Sisowath Terak.
Das Unabhängigkeitsdenkmal liegt am Ende der Norodom; eine Krone besonderer Art für die Dynastie. Wenn Sie vom Nordwesten kommen, biegen Sie an der letzten Kreuzung rechts ab, das ist die Vithei Samdech Hinn. Dort betrieben meine Eltern einen Gewürzgroßhandel. Gute Lage. Einen Kilometer von den letzten Kais entfernt, an denen die Lastkähne anlegten, die flußauf kamen, von Saigon.
Eigentlich war der Handel in Phnom Penh ja die Domäne der Chinesen. So wie Handwerke meist von Vietnamesen betrieben wurden. Man war das so gewöhnt, die Khmer waren das Staatsvolk, sie hatten in der Hauptstadt meist die Verwaltungsposten inne.
Aber mein Vater lachte immer, wenn er solche Einteilungen hörte. Er meinte, wie ein Mann sein Geld verdiene, hänge eher von seinem Unternehmungsgeist ab als von seiner Nationalität. Wobei die Nationalität ohnehin keine sehr große Rolle bei uns spielte, jedenfalls um die Zeit, als ich aufwuchs. Wie auch die Religion. Die Götter, so pflegten die Alten zu sagen, haben uns Toleranz gelehrt. Und die alten Könige von Angkor respektierten alle Götter, hinduistische wie buddhistische. Laßt doch die einen zu Buddha beten, die anderen zu Wischnu. Wieder andere verehren den Mann aus Arabien, den mit der Krone aus Dornenranken, der am Kreuz endete. In den Pagoden stehen die Figuren der verschiedensten Gottheiten ohnehin nebeneinander, das ist Tradition bei uns.
Die Cham, die meist in der Provinz Kompong Cham lebten, ein Urvolk, das eine primitive Auslegung des Islam betrieb, unterschieden sich in ihren Riten am meisten von uns anderen. Eigenartigerweise aßen sie kein Schweinefleisch, aber auch sie waren gleichberechtigte Bürger, wenigstens auf dem Papier der Gesetze.
Doch in unserem Lande gab es in der Tat keine Religionsfehden, nicht einmal die Christen, die so gern zu Märtyrern werden wegen ihres Glaubens, konnten darüber klagen, wenige, die sie ohnehin waren. Erst Pol Pots Regime begann Unterschiede zu machen. Neben den Hauptunterschieden, auf die ich noch zu sprechen komme, auch religiöse. In jedem Falle waren sie tödlich. –
Ich wuchs sozusagen mit der Unabhängigkeit auf. Als ich das erste Jahr zur Schule ging, damals ein Privileg der Hauptstädter, weil es in den meisten anderen Orten des Landes noch kaum Schulen gab, bekamen wir eines Tages kleine Fähnchen mit den Türmen von Angkor Wat in die Hand gedrückt und wurden am Straßenrand aufgestellt. Wir hatten Prinz Sihanouk zuzujubeln, der, wie man uns sagte, die Unabhängigkeit im Kampf gegen die französischen Kolonialherren errungen hatte. Monseigneur Papa, wie unsere Lehrer ihn nannten, der gütige Prinz aus der Dynastie der Norodom, der unser Schicksal wenden konnte.
Ich habe keine Erinnerungen an die Kolonialzeit, kann daher auch nicht sagen, daß ich mich sonderlich befreit fühlte. Zumal mein Vater, der eine Buchhalterseele hatte und alles dreimal von allen Seiten besah, bevor er es zur Kenntnis nahm – auch die Rechnungen für seine Gewürze übrigens –, nicht selten im Familienkreis lose Reden führte. So meinte er, der Prinz schmücke sich mit unechten Federn, wenn er sich das Verdienst der Unabhängigkeit so einfach allein zuschriebe. Es habe im Lande seit dem zweiten Weltkrieg, der für mich nur noch eine Legende war, Leute gegeben, die gegen die Franzosen und die Japaner gekämpft hatten. Eigentlich sei dieser Kampf von den Vietnamesen ausgegangen, habe auf uns, das Nachbarland, übergegriffen, ebenso auf Laos, den nördlichen Nachbarn. Im Frühjahr 1954 hätten die Vietnamesen die Franzosen bei Dien Bien Phu so katastrophal geschlagen, daß diese gezwungen waren, nicht nur Vietnam, sondern auch das übrige Indochina aufzugeben.
Sihanouk, der an einer französischen Universität in Saigon studiert hatte, wie das bei den Leuten unserer Oberschicht üblich war, hätten die Franzosen als Statthalter ausgewählt, damit nicht die tatsächlichen Kämpfer, die meist Kommunisten waren, an die Macht gelangten. Die Franzosen, so meinte mein Vater, hätten Sihanouk das Land sozusagen auf dem Silbertablett übergeben, weil er zugesagt habe, daß Frankreichs wirtschaftliche und politische Interessen wenigstens zu einem gewissen Teil weiter respektiert würden.
So gab es bei uns auch weiterhin französische Unternehmen, Kautschukplantagen beispielsweise, aber auch Schulen und Krankenhäuser. Das Militär zog ab, aber die Franzosen waren damit nicht ausgeschaltet, wie etwa im Norden von Vietnam und später im Süden, wo die Amerikaner an ihre Stelle traten – sie waren bei uns lediglich in gewisse Grenzen verwiesen. Aber das kennen Sie ja aus den Geschichtsbüchern …
Als ich zehn Jahre alt war, schickte mich mein Vater in das französische Gymnasium. Bildung, so meinte er, sei wichtig, auch das Erlernen von Sprachen. Das Gymnasium trug den Namen Lycée Kamputh Both. Französisch lehrte dort ein erst kürzlich vom Studium aus Paris heimgekehrter Herr namens Saloth Sar. Er hatte mit einem Stipendium des französischen Staates in Frankreich studieren können wie einige andere Auserwählte auch. Die Franzosen hatten diese Studien finanziert, wohl um sich im eigenen Land eine Art geistiger Elite heranzubilden, die dann später in der ehemaligen Kolonie verantwortungsvolle Posten bekleiden sollte, nicht zuletzt im Interesse jenes Landes, das ihnen so großzügig zu höherer Bildung verholfen hatte.
Herr Saloth Sar war ein untersetzter, etwas bullig wirkender Khmer, der oft lachte und dabei auf eine unnachahmliche Weise sein Pferdegebiß entblößte. Er war nicht ungerecht, und das Lernen bei ihm machte sogar Spaß. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, die eine andere Klasse mit ihrem Lehrer hatte, einem gewissen Ieng Sary, der schnell aus der Haut fuhr und dann laut schimpfte. Auch er war übrigens aus Paris zurückgekommen und mit Herrn Saloth Sar ziemlich eng befreundet. Am Gymnasium hatte ich nur einmal mit ihm zu tun, als er mir einen Brief übergab, den ich ins Lycée Norodom bringen sollte, zu einer Madame Khieu Thirit, Englischlehrerin und, wie ich erfuhr, die Frau von Herrn Ieng Sary. –
Unser Französischlehrer, Herr Saloth Sar, war aber bei weitem nicht nur an der Vermittlung von Sprachkenntnissen interessiert. Er war in vielen Fächern bewandert, so auch in der Geschichte und vor allem in der Politik. An unserer Schule gründete er damals den »Zirkel zur Analyse der Geschichte des Khmer-Volkes«. Eine von den Schulbehörden recht gern gesehene Ergänzung unseres Unterrichts, obwohl die Teilnahme freiwillig war. Ich erinnere mich an farbige Landkarten mit den Grenzen des alten Reiches Fu Nan, an Darstellungen der legendären Khmer-Metropole Angkor, in der vom 9. bis zum 15. Jahrhundert unsere Gottkönige herrschten. Wir Schüler bekamen einen Eindruck von der Größe und Bedeutung unserer Vergangenheit.
Wenn wir Herrn Saloth Sar lauschten, wie er von der Pracht und Herrlichkeit des Hofes erzählte, von der Gewalt, die sich dort verkörperte und die angewendet wurde, um das Land immer bedeutsamer zu machen, hatten wir durchaus ein wenig das Gefühl, einem auserwählten Volk anzugehören. Schließlich hatten die Gottkönige von Angkor es nicht nur verstanden, die Energien des einfachen Volkes völlig für die Größe der Dynastie zu mobilisieren, die sich in den gewaltigen Bauwerken von Angkor verkörperte – sie ließen die von Natur aus trägen Bauern, die sich mit dem bißchen Reis, das sie selbst aßen, mit ein paar Fischen und ein wenig Gemüse begnügten, zu riesigen Arbeitskolonnen zusammenfassen, die zwischen Saat und Ernte sogenannte gemeinnützige Vorhaben ausführten. Im ganzen Land legten sie engmaschige Wasserverteilungssysteme an, die der notwendigen Bewässerung der Reisfelder während der Trockenperiode ebenso dienten wie dem Schutz vor Überflutungen während der sintflutartigen Regenfälle.
Mit sichtlichem Stolz präsentierte uns Herr Saloth Sar immer wieder Landkarten, auf denen die einstmals für ganz Südasien beispielhaften Systeme der Stauanlagen und Kanäle im Kambodscha der Angkor-Periode verzeichnet waren. Er bewahrte diese Karten übrigens nicht in der Schule auf, sondern bei sich zu Hause.
Hier muß ich erwähnen, daß ich sozusagen zu seinen Lieblingsschülern gehörte, deshalb wurde ich von ihm oft mit kleinen Nebenarbeiten betraut, wie etwa die Karten von seinem Haus zur Schule und zurück zu tragen. Er hatte mich wohl auserwählt, weil ich eine gute Auffassungsgabe besitze. Französisch bereitete mir keine Schwierigkeiten, ebensowenig die englische Sprache, die ich als Wahlfach nahm.
Allerdings machte der außerschulische Zirkel mir bald mehr Spaß als die Schulfächer. Was Herr Saloth Sar uns über die glorreiche Vergangenheit des Khmer-Reiches erzählte, beflügelte meine Phantasie und gab mir ein wenig das Gefühl, als Khmer etwas Besonderes zu sein. Es schärfte aber auch meinen Blick für die Wirklichkeit, die mich umgab.
Kambodscha erlebte damals eine gewisse Blütezeit. Zwar wurden noch immer beachtliche Teile der Wirtschaft direkt oder indirekt von Franzosen kontrolliert; große Ländereien gehörten französischen Gesellschaften oder Privatpersonen, wie etwa die gesamten Kautschukplantagen des Landes, deren Ertrag nur zu einem geringen Teil Kambodscha zufloß, aber die Verhältnisse stabilisierten sich. Es wurde nicht mehr gehungert. Fisch und Reis waren in den dichter besiedelten Gebieten reichlich vorhanden, der Außenhandel entwickelte sich, die Städte bekamen nach und nach die Errungenschaften der modernen Zivilisation zu spüren – Busse fuhren, Kinos wurden gebaut. Man feierte die alten Feste: das Visak Bauchéa in der ersten Maiwoche, den Geburtstag Buddhas, dann Anfang Mai das Chrot Preah, das sogenannte heilige Pflügen der ersten Furche, oder das Prachum Ben im September, ein Tag, an dem den toten Ahnen Opfergaben dargebracht wurden.
Am schönsten war stets in der Hauptstadt das Fest des umkehrenden Wassers, gegen Ende Oktober, wenn der verringerte Zufluß des Mekong in den Nebenarm Tonlé Sap dazu führt, daß dieser nicht mehr, wie von Juli an, nordwärts in den Großen See fließt, sondern südwärts, zum Meer. Ein Dankfest, das dem Wasser gilt, dessen Fruchtbarkeit den Reis hat reifen lassen.
Tausende Boote schwammen da auf dem Fluß, ruderten um die Wette. Alles war mit Kerzen und Lampions geschmückt. Eine große Barke mit einem Altar setzte sich mit der Flut in Bewegung – es gab wohl keinen Hauptstädter, der nicht an diesem Tag festlich gekleidet am Ufer stand. Nicht einmal der Unabhängigkeitstag am 9. November mit seinen Paraden und Festreden konnte das Wasserfest übertreffen!
Wer Kambodscha um diese Zeit sah, mußte den Eindruck eines prosperierenden Landes haben. Dennoch war das nur die Oberfläche, die schöne Seite. Schon ein paar Dutzend Kilometer von den größeren Städten entfernt sah es wesentlich anders aus.
Den Blick für diese dunklere Seite der Realität schärfte uns Heranwachsenden an der Schule ganz wesentlich Herr Saloth Sar. Von ihm lernten wir, daß sich das System des Prinzen auf klug dosierter Ausbeutung und Unterdrückung aufbaute. So gab es etwa in den ausgedehnten landwirtschaftlich genutzten Gebieten eine schleichende Verschlechterung der Lebenslage unter den Bauern.
Da alles Land der Krone gehörte, dem Staat also, brauchten die Bauern zwar keine direkten Steuern zu entrichten, doch dafür gehörte ihnen das Land nicht, und es häuften sich eine Menge indirekter Abgaben. Die meisten selbständigen Bauern hatten Schwierigkeiten, die steigenden Preise für Saatgut, für Wasser und für den Transport ihrer Erzeugnisse zu zahlen. Sie mußten die Ernten verpfänden, sich bei Geldverleihern verschulden, immer höher, um selbständig bleiben zu können. Gaben sie auf, wurden sie zu Lohnsklaven reicher Landaufkäufer, ihr Lebensstandard sank weiter ab. An die Ausbildung ihrer Kinder war kaum noch zu denken.
Die Sihanouk-Dynastie selbst betätigte sich immer mehr als Wirtschaftsunternehmen und wurde zunehmend reicher. Dazu gründete sie – oft über Mittelsmänner – Industriebetriebe, deren Ertrag ihr allein zufloß. Sie ließ in den landschaftlich schönsten Gegenden, wie etwa bei Angkor, Hotels bauen. So entstand die Socièté Khmere des Auberges Royales, deren Kassen sich mit dem Geld der Touristen füllten; die Gesellschaft besaß so gut wie alle für Ausländer geeigneten Hotels im Lande. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man, selbst die unzähligen Bordelle der Hauptstadt würden von Strohmännern des Königshauses betrieben.
Unser Prinz widmete sich indessen den schönen Künsten. Er komponierte Musik und produzierte Spielfilme – es existierten nur wenige Gebiete des öffentlichen Lebens, an denen nicht die Norodom-Sippe, die Franzosen oder die einheimische Schicht der Zwischenhändler und Exporteure Millionen verdienten. Damit verglichen gab es Gegenden im Lande, die sich buchstäblich noch im Urzustand befanden, ohne die Hoffnung, daß sich das in absehbarer Zeit ändern könnte. Am schlimmsten stand es um die nordöstlichen und östlichen Provinzen, Mondulkiri etwa oder Ratanakiri. Aber auch Battambang war davon betroffen, Siem Reap, Koh Kong oder Svey Rieng, Kompong Speu, Takeo, Kampot.
Ein Studienfreund unseres Herrn Saloth Sar, ein gewisser Khieu Sampan, der an einer Hochschule Ökonomie lehrte, schob sich damals in unser Blickfeld. Herr Saloth Sar eröffnete uns, daß er und einige Mitstudenten sich bereits in ihrer Pariser Schulzeit grundlegende Gedanken über die Misere Kambodschas gemacht und auch eine Theorie für deren Überwindung entwickelt hätten.
Als Herr Khieu Sampan den ersten Vortrag in unserem Zirkel hielt, war das für die meisten von uns eine Art Erleuchtung. Wir begriffen, seine Überlegungen sahen nicht kleine Reparaturen an unserem unzulänglichen Staatssystem vor, sondern dessen gründliche und tiefgreifende Veränderung. Khieu Sampan verkündete, Sihanouk putze Phnom Penh und ein paar andere Vorzeigeplätze im Lande so auf, daß jeder Fremde, der dahin geführt würde, vor Ehrfurcht erstarre und darauf schwöre, der Prinz wäre ein Meister der Staatskunst. Auf diese Weise erschleiche sich die Regierung außenpolitische Meriten, während der größere Teil unseres Volkes dazu verdammt sei, auf unwürdige Weise zu leben. Das müsse man ändern. Er, Khieu Sampan, setzte nicht auf Reformen, sondern auf eine – wie er es nannte – »revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft«: Weg mit der korrupten Monarchie, in der ein Geier dem anderen das Futter stehle, weg mit der Schicht der nutznießenden Beamten und Verwalter, der Mittler und Zwischenhändler, die vom Schweiß anderer lebten, weg mit dem Geld, das nur die Reichen besäßen, weg mit allem überhaupt, was das Leben der Oberschicht angenehm mache und das der Armen bedrücke!
Herrn Khieu Sampan schwebte als Lösung eine Art locker organisierte, aber auf strikter Disziplin beruhende Gemeinschaft vor, mit einer nahezu militärischen Kommandostruktur. Hauptanliegen sollte die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte sein, bei absoluter Gleichheit aller an der Produktion Beteiligten, was den Verdienst betraf, der ohnehin nur in Naturalien bestehen sollte. Verwaltungseinrichtungen höherer Ebene sollte es nicht mehr geben. Eine Art Urgesellschaft, einfach und anspruchslos. Industrie war nur in geringem Umfang vorgesehen, und zwar soweit sie die Landwirtschaft unterstützte. Vorbild war in jeder Beziehung das ehemalige Angkor-Reich. Eine Umkehr also. Zurück zu den Ahnen und ihrer unbestreitbaren Größe. Aber auch zu ihrer Frugalität.
Wir waren, das darf man getrost sagen, fasziniert von diesen ungewöhnlichen Ideen. Herr Khieu Sampan, der uns ausführlich das Elend der Menschen in den entlegenen Provinzen, in den Wald- und Berggebieten beschrieb, sagte damals – ich habe es mir gemerkt: »Die; systematische Nutzung bisher ungenutzter Energien, die in den bäuerlichen Massen schlummern, wird die Landwirtschaftserträge verhundertfachen und dazu beitragen, Neuland zu erschließen, das mit Hilfe gigantischer Gemeinschaftsaktionen bewässert und vor Überschwemmungen geschützt wird – das bedeutet Sattsein und Reichtum für alle, nicht mehr nur für die parasitäre Schicht der Städter, Intelligenzler, Militärs und Händler.«
Es traf den Kern der Sache, meinten wir alle, die wir zuhörten. Wir sahen täglich mit an, wie sich in der Hauptstadt eine neue soziale Schicht bildete, protzend, überheblich, ohne Skrupel. Kaufleute, Zwischenhändler, Spekulanten, hohe Beamte und Militärs, ihre Weiber, Kinder, Mätressen und Huren – das waren die Leute, deren Lebensstil uns provozierte. Sie verbargen ihren neuerworbenen Reichtum nicht etwa, im Gegenteil, sie stellten ihn zur Schau, wo immer es möglich war. Kleideten sich wie die Amerikaner oder Franzosen, aßen nur noch in teuren Restaurants, gaben abends ihre geräuschvollen Partys in Luxusvillen. Wenn sie sich überhaupt in den Straßen der Hauptstadt bewegten, dann geschah das in Buicks oder Cadillacs mit langen Heckflossen, die an Haifische erinnerten.
Haie, das waren sie auch. Sättigten sich ohne Rücksicht auf andere. Ich will damit nicht etwa das rechtfertigen, was später geschah, ich will es nur in den rechten Zusammenhang rücken. Sprechen wir es offen aus: Der Feudalismus auf dem Lande war nicht abgeschafft worden.
Ein Bauer bei uns bewirtschaftete in der Regel etwa fünf Hektar Land. Er besaß vielleicht einen Büffel und einen Pflug. Der Staat, der Land an Bauern verpachtete, verlangte den Bodenzins in Naturalien. Dadurch erwirtschafteten die meisten Bauern fast kein Geld mehr, und es kam auf dem Markt ein Überangebot an Naturalien zustande, das in den Städten Üppigkeit vortäuschte, in Wirklichkeit aber die Preise ruinierte und die Bauern zwang, selbst noch für den Eigenbedarf benötigte Produkte zu verkaufen, um ein wenig Geld für die notwendigsten Ausgaben zu erlangen. Hunger und wachsende Verarmung waren die Folge. Die reichen Städter merkten das vermutlich gar nicht. Sie lebten in Villen, ausgestattet mit dem Luxus französischer oder amerikanischer Zivilisation – wie sollten sie da wissen, was Hunger auf dem Lande war! Sie mästeten sich förmlich. Wenn es etwas gibt, das von dem Regime, das hinter uns liegt, an Wahrheiten verkündet wurde, dann ist es die über das unglaubliche soziale Gefälle bei uns gewesen. Es machte den Leuten, die uns nachher in die Katastrophe stürzten, die Sache leicht.
Auf dem Weltmarkt wurde damals kambodschanischer Reis zu Schleuderpreisen angeboten. Ein gefährliches Phänomen. Der Ertrag der Arbeit kambodschanischer Bauern wanderte nicht mehr in einem großen Kreislauf ins Land zurück – er versickerte in den Kanälen der internationalen Valutaspekulation. Zudem muß man wissen, daß die paar Hektar Land, die ich als Durchschnittsbesitz erwähnte, mit der Zeit schrumpften. Unsere Bauern haben viele Kinder. Unter ihnen mußte das vorhandene Land von Generation zu Generation neu aufgeteilt werden. Das Land nahm nicht zu, aber die Anzahl der Kinder wuchs.
Der Prinz wollte die Misere der Bauern nicht sehen. Herr Khieu Sampan sah sie. Herr Saloth Sar auch. Und wir Jungen erkannten sie. War das verwunderlich? Die theoretischen Überlegungen des Herrn Khieu Sampan enthielten ja durchaus einen Kern, der auf Tatsachen beruhte. Damals hielt auch ich die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen für brauchbar. Heute habe ich Erkenntnisse gewonnen, die ich damals nicht besaß. Und ich habe miterlebt, daß das Land nicht nach den seinerzeit als revolutionär gepriesenen Methoden umgestaltet wurde, sondern etwas ganz anderes geschah. Noch während die große Tragödie lief, habe ich mich von dem getrennt, was ich einst für richtig gehalten hatte.
Aber kehren wir zu den damaligen Realitäten zurück, damit Sie verstehen, weshalb Leute wie ich Khieu Sampan und Saloth Sar zuhörten, ihnen sogar vertrauten.
Die Industrie in Kambodscha erbrachte zu Zeiten Sihanouks lediglich etwa 10 Prozent des Nationaleinkommens. Die erwirtschaftete sie allerdings mit Exporterzeugnissen – für den Bauern produzierte sie so gut wie nichts, wenn man von Seven-Up-Limonade und Bastos-Zigaretten absieht. So machte die Schicht der Exporteure und Industriemanager ihr Geschäft, während die Bauern in der Rückständigkeit versanken.
Daran änderte nichts, daß sich der Prinz gelegentlich vor einer Reihe von Traktoren fotografieren ließ und dazu die internationale Presse, das diplomatische Korps und überhaupt jeden ausländischen Pinsel einlud, den er erreichen konnte!
In den Städten rollten amerikanische Autos, plärrten japanische Fernseher und Recorder, es gab eine wachsende Schicht von Angestellten, die nur noch Dienstleistungen für die Großverdiener versah, vom Kraftfahrer über den Masseur und den Kellner im »Royal« bis zur Hure. Auf dem Lande fehlte hingegen selbst die Pinzette, mit der man eine Zecke hätte aus der Nackenhaut eines Babys entfernen können. In den Städten wuchs die Zahl der sogenannten Verwaltungsangestellten, während in den Dörfern die traditionellen Handwerker ausstarben, etwa der Mann, der eine Karrenachse hätte reparieren können – er wanderte, wie andere auch, in die Stadt ab, um dort Wasserklosetts für Neureiche zu bauen. –