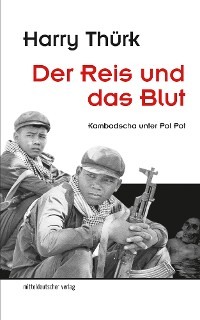Kitabı oku: «Der Reis und das Blut», sayfa 4
UNG PHIM, 30 Jahre
Haben Sie jemals etwas von Mong Sene gehört, Mister? Nein? Nun, ich kann Ihnen beschreiben, wie Sie dorthin gelangen. Sie fahren auf der großen Nationalstraße Nr. 5 von Phnom Penh in Richtung Battambang. Nach reichlich zweihundert Kilometern werden Sie eine Kleinstadt erreichen: Meng Svay Daun Keo. Dort sind Sie bereits in der Provinz Battambang. Eine Grenzprovinz. Vielgestaltig, ebenso fruchtbar wie auch versteppt und vom Dschungel bewachsen. Südlich liegt das Vorgelände der Phnom-Kravanh-Kette, die man auch das Kardamomgebirge nennt. Sie zieht sich weiter südwärts, in die Provinz Pursat.
Battambang ist schön, wenn man die Landschaft meint. Reis wächst dort ganz gut, wenn auch nicht überall. Bataten gibt es, Maniok, Mais. Es wird Vieh gezüchtet. In der Gegend um Pailin finden sich Edelsteine, dicht unter der Oberfläche des Savannenbodens; eine im Grunde reiche Provinz. Seltsamerweise gab es dort unzählige arme Leute. Aber – Sie werden ja aus Indien wissen, wie dicht Reichtum und Armut meist zusammenliegen.
Also – wenn Sie sich an der kleinen Stadt Meng Svay Daun Keo satt gesehen haben, ich meine an den Ruinen, die dort vermutlich von dem Marktplatz, von der Schule, dem Handelshaus, dem Hospital, den zweistöckigen Wohnhäusern an der Hauptstraße übriggeblieben sind, wenn Sie des Geruchs nach kalter Asche überdrüssig werden, verlassen Sie die Stadt auf der kümmerlichen Landstraße, die südwärts führt, in die schöne, aber menschenleere Landschaft aus Savanne, Waldstücken, grünen Niederungen und sanft ansteigenden Hügelketten. Sie werden links immer wieder einen Fluß sehen. Trübes Wasser, ruhig fließend, träge. Gelegentlich etwas Sumpfland rechts und links. Reiher fliegen dort, Ibisse. Alligatoren leben an den Ufern. Elefanten trompeten in der Ferne. Nachts ist man nie ganz sicher vor Raubkatzen. Die Tiger sind farbenprächtiger gestreift als anderswo; niemand weiß warum. Sie gehen Menschen nur selten an, aber wenn sie es tun, endet es fast immer tödlich für die Menschen, denn dann sind die riesigen Katzen hungrig und kennen keine Gnade, gleich, ob sie Vierbeiner vor sich haben oder Zweibeiner.
Sie fahren auf der mit rötlichem Splitt ausgelegten Straße eine Stunde, vielleicht etwas länger, dann erst erreichen Sie Mong Sene. Eigentlich nur ein Dorf, aber eines von denen, das sich infolge seiner günstigen Lage und des Unternehmungsgeistes seiner Bewohner zu einer Art Agrarzentrum entwickelt hatte.
Jetzt muß ich Sie warnen: Wovon ich erzähle, ist die Vergangenheit. Heute finden Sie dort gewiß mannshohen Busch, bis an die Straße heran, Ruinen von Ställen und anderen Anlagen, die Menschenhand schuf – und zerstörte. Auch die Überreste eines bescheidenen Staudammes werden Sie finden und die Überbleibsel einer Einrichtung, in der das gestaute Wasser zwei Turbinen betrieb und Strom erzeugte. Ein zufriedenes Dorf war das einmal, inmitten von Wäldern, grünen Weiden und Maisfeldern. Ein Musterdorf, wie der Prinz es auf den Bildern haben wollte, die er über sein Reich ins Ausland schickte. Vorzeigedorf. Idylle. Fragen Sie mich nicht nach dem Namen des Flusses, ich habe ihn vergessen. Dort oben nennt man die Flüsse ohnehin kaum beim Namen, sie sind einfach »das Wasser«. Es war dieses Wasser, das mich nach Mong Sene brachte …
Verzeihen Sie, ich bin kein geübter Erzähler. Zuerst hätte ich sagen müssen, daß ich hier, in der Hauptstadt, aufwuchs. Im nördlichen Vorgelände, an der Straße nach Kompong Thom, finden Sie, was von einer Limonadenfabrik übrigblieb nach Pol Pots Feldzug gegen Phnom Penh. Meine Eltern wohnten nicht weit von der Fabrik entfernt, und mein Vater arbeitete dort als Elektriker. Die Fabrik war modern, wurde zu der Zeit errichtet, als Kambodscha noch amerikanische Hilfe bezog. Seven Up hieß das Hauptprodukt. Eine aus Limonadensaft, Wasser, ein paar Gewürzen und Kohlensäure hergestellte Limonade, die in Amerika viel getrunken wird, wie man uns erzählte. Lizenzprodukt. Aber man füllte dort nebenbei auch andere Getränke in Flaschen. Einheimische, billige Limonaden, die ebensogut schmeckten, wenn Sie mich fragen.
Mein Vater hatte an der elektrischen Anlage mitgebaut; er war nach der Inbetriebnahme so etwas wie ein Hauselektriker. Kein schlechter Posten, er ernährte ihn, meine Mutter und mich. Ich war ebenso wie Kim Sar das einzige Kind. 1963, in dem Jahr, als der Staatschef Sihanouk die US-Hilfe kündigte, war ich vierzehn Jahre alt, und auf Fürsprache meines Vaters hatte ich in der Limonadenfabrik eine Lehrstelle bekommen. Als Elektriker. Mein Vater, der mit seinem Beruf sehr zufrieden war, wollte es so, und ich selbst interessierte mich ebenfalls für die Geheimnisse der Elektrizität, also war ich recht eifrig bei der Sache. Es war hauptsächlich mein Vater, der mich anlernte, denn er hatte inzwischen den Posten eines Meisters erhalten und führte die Aufsicht über das gesamte Stromnetz in der Fabrik. So lernte ich von jemandem, der bereit war, mir alles beizubringen, was er selbst beherrschte, bis zum letzten Trick, mit dessen Hilfe man einen Kurzschluß finden, ein durchgeschmortes Kabel schnell überbrücken konnte.
Aber drei Jahre später, einige Zeit nach den ersten Aufständen in Samlaut und Ratanakiri, von denen Kim Sar berichtet hat, wurde mir die Fabrik zu eng. Es waren gewiß nicht die Aufstände, die dieses Gefühl hervorriefen, beides fiel wohl einfach so zusammen. Um diese Zeit hatte die Firma Seven Up die Herstellung des Getränks nach ihrem Rezept und den Vertrieb unter ihrem Namen bereits verboten. Wir produzierten billige Durstlöscher aus einheimischen Grundstoffen. Ich hatte in der Zeitung gelesen, daß man in neu zu entwickelnden Unternehmen im Lande Elektrofachleute suchte.
Es war für einen jungen Burschen wie mich eine abenteuerliche Perspektive, an neuen Werken irgendwo im weiten Land mitzuarbeiten. Ich will nicht sagen, daß es Pioniergeist war, der mich bewegte, aber auf eine seltsame Weise bedrückte mich die Aussicht, mein Leben lang in der Seven-Up-Fabrik zu sitzen, unter Kollegen, die ich eigenartig folgsam fand, prinzentreu, wie mancher sagte, der genug Selbsterkenntnis aufbrachte. Sie taten ihre Arbeit, egal, ob man ihnen mehr oder weniger dafür zahlte. Sie fanden sich mit Extraabgaben ab, wurden nicht laut, als man die Mittagspause kürzte, so daß sie es nicht mehr schafften, sich außerhalb der Fabrik eine billige Mahlzeit zu kaufen. Und sie nahmen es widerspruchslos hin, daß die Firma eine Kantine eröffnete, in der die gleiche Schale Nudeln die Hälfte mehr kostete als irgendwo anders in der Stadt. Sie wagten es nicht einmal, darüber ihre Unzufriedenheit zu äußern. Als ich es tat, riet mir selbst mein Vater zu schweigen – es gäbe genügend Leute, die meine Arbeit zu jeder Bedingung übernehmen würden. Womit er übrigens recht hatte. Leider, wie ich fand.
Ich wollte nicht ungehorsam sein gegen meinen Vater, wollte ihn auch nicht in Verlegenheit bringen. Aber ich war anders als er. Ich brachte es auf die Dauer nicht fertig, zu jeder Ungerechtigkeit meinen Mund zu halten und im übrigen zuzusehen, wie unser Prinz unablässig verkündete, daß es den einfachen Leuten in Kambodscha von Tag zu Tag besser ginge. In Wirklichkeit war das Gegenteil der Fall.
Ich sehnte mich nach Gleichgesinnten, mit denen ich über diese Dinge wenigstens offen reden konnte. Duckmäuser schienen mir das hier zu sein, die sich an ihr Arbeitsverhältnis klammerten, ängstlich, es zu verlieren. Was hatte man aus diesen Leuten nur gemacht! Ich hoffte, die Bewohner weit entfernter Ortschaften würden vielleicht anders sein, ehrlicher und freier in ihrer Art, die Dinge zu sehen. Und so meldete ich mich als Elektriker für eine Arbeit in den sogenannten neu zu erschließenden Gebieten. Dafür wurde damals geworben – auch eines der Projekte des Prinzen. Egal, ich wollte weg. –
Mong Sene war für mich ein unbekanntes Land. Ich ließ mir im Anwerbungsbüro auf der Landkarte zeigen, wo es lag, und dann ging ich dorthin. Weit weg von der prinzlichen Metropole, ihrer Verlogenheit, ihrer Unterwürfigkeit, dem Wohlstand für die Wohlhabenden – dort, in jenem kleinen, unbedeutenden Ort schien für mich das Reich Zukunft zu liegen.
Sie müssen sich das so vorstellen: Zuerst fuhr man mit der Eisenbahn bis Battambang. Meist auf dem Dach, denn die Hitze in den gedeckten Wagen konnte einen töten, bevor man in der Provinzhauptstadt ankam. Auto wäre schöner gewesen, aber wie soll ein junger Mann zu einem Auto kommen, wenn er Elektriker ist? Und unsere Lastwagenfahrer – jedenfalls um diese Zeit damals – waren für Anhalter nicht sehr zugänglich. Sie hatten Angst, die Fremden würden sich als Räuber entpuppen. Wegen des Dachs – keine Sorge: Unsere Züge fuhren damals schon so langsam, daß es niemandem ernstlich schadete, wenn er einmal herabpurzelte. Er stand wieder auf und konnte bequem noch den letzten Waggon erreichen. Auf den sprang er dann auf und lief über die Dächer bis zu seinem alten Platz. Ich selbst habe das auf dieser Fahrt zweimal gemacht! Nun gut, von Battambang bis Meng Svay Daun Keo konnte man einmal in der Woche mit einem Bus fahren. Auch wieder auf dem Dach, und wenn es sich vermeiden ließ, nicht gerade in der Nähe eines Hühnerkäfigs aus Bambusgeflecht – wegen des Gestanks.
Als ich die Busfahrt hinter mir hatte, stand ich auf dem Marktplatz von Meng Svay Daun Keo, mit weiter nichts bei mir als der eingerollten Matte und einem Tragbeutel mit ein bißchen Wäsche, ein paar Konserven, die meine Eltern mir aufgedrängt hatten, und etwas Tabak. Man hatte mir in dem Anwerbungsbüro gesagt, einmal in der Woche würde dort auf dem Marktplatz ein Jeep der Gesellschaft für Bewässerungstechnik erscheinen, um Lebensmittel für die Arbeiter in Mong Sene abzuholen. Das stimmte. Ich mußte nur drei Tage warten, auf dem Pflaster neben dem Aushängebrett für die amtlichen Nachrichten schlafen, dann war der Jeep da. So gelangte ich ziemlich gut an meinen Bestimmungsort.
Sie müssen sich rund zwei Dutzend verstreut liegende Pfahlhäuser vorstellen. Dazwischen Ställe für Vieh. Außer Büffeln und Schweinen hielten die Leute dort unzählige Hühner. Die liefen frei in der Gegend umher, ebenso die Hunde. Eigentlich war es eine Idylle, dieses Mong Sene. Ringsum sanft gewelltes Flachland, mit Büschen durchzogen. Vor allem am Fluß standen sie dicht. Und der kleine, schmale Fluß hatte zwei Eigenarten, die von Wasserbautechnikern entdeckt worden waren: Er war erstaunlich tief und floß schnell. Das legte den Bau eines Kraftwerks nahe, zumal man eine Bodenvertiefung für den Stau nutzen konnte.
Worauf die beiden Eigenschaften des Flusses zurückzuführen sind, weiß ich nicht. Ich bestaunte sie wie alle anderen zehn Städter, die man hierhergeholt hatte. Wir hausten in einem großen Pfahlhaus, das die Gesellschaft eingerichtet hatte, die den Bau ausführte. Es stand in der Nähe des Flusses, ein bißchen von der eigentlichen Siedlung entfernt.
Hausen, ja, das ist der richtige Ausdruck. Männerwirtschaft. Man arbeitete, wusch am Abend sich selbst und seine Kleidung, aß und schlief. Das Essen kochte eine Frau aus dem Dorf. Alt und runzelig, im Gesicht wie in der Seele. So schienen alle Weiber dort zu sein. Ich habe nicht ein einziges junges Mädchen in Mong Sene gesehen. Wenn ich es mir jetzt überlege, frage ich mich, weshalb mich das nicht gleich stutzig machte. Auch kein junger Mann war in dem Dorf, obwohl er leicht hätte Arbeit finden können, beim Bau. Gut bezahlte dazu! Aber, wie gesagt, überall nur alte Weiber und ebenso alte Männer und ein paar Kinder.
Ich muß ehrlich sagen, wir machten uns keine Gedanken, wer sie in die Welt gesetzt haben konnte. Später erst erfuhr ich die tatsächlichen Zusammenhänge.
Etwa um die Zeit, als die Herren Lehrer, von denen Kim Sar sprach, sich aus Phnom Penh davonmachten, da steckten wir in der härtesten Arbeitsphase an der Stauanlage. Täglich rollten auf der dürftigen Straße, der einzigen Verbindung mit der Außenwelt, Kipper mit Beton heran, den wir in die Verschalungen der stahlbewehrten Staumauer stampften. Was wir an Strom brauchten, zum Schweißen etwa, lieferten Dieselaggregate, die ich zu warten hatte. Das Arbeitsgerät stammte aus Frankreich und Italien. Robuste Sachen. Weder Hitze noch Regen konnten ihnen etwas anhaben, vorausgesetzt, man nebelte sie jede Woche einmal mit Öldunst ein. Darüber wachten drei französische Techniker, die den Bau beaufsichtigten. Wir Arbeiter stanken nach Öl, ob wir uns wuschen oder nicht.
Ich selbst wurde nach einiger Zeit, als die Fundamente der Staumauer standen, zum Bau des Kraftwerks geschickt. Es war auch ein Betonbau, niedrig, aber stabil. Die Turbinen lagen geschützt. Nicht einmal ein Sturm, der das Dach wegfegte, hatte ihnen etwas anhaben können. Die Masten setzten wir in metertiefe Betonfundamente. Stahlmasten, zusätzlich mit einer Schicht rostschützender Plastlösung überzogen. Die Franzosen nannten das ganze ein Jahrhundertbauwerk. Ihnen war es gleich, wie teuer es wurde, es war ja nicht ihr Geld. Im Gegenteil, je länger sie daran arbeiteten, desto länger bezogen sie ein fürstliches Gehalt. Besser gesagt, ein prinzliches. Trotzdem – man konnte mit diesen Ausländern gut arbeiten. Keine Schinder. Leute, die ihr Fach verstanden und von den wir manches lernten.
Das Leben in Mong Sene? Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich dort das Reich Zukunft gefunden hätte, Mister. Nun, vielleicht sind Sie erstaunt, aber ich beantworte das mit Ja. Nicht das Abenteuer war es, o nein! Natürlich, da war dieses biestige Männerleben, ohne ein Stück weiblicher Haut, nach der es uns schon gelüstete, alle. Aber wir verstanden uns gut. Wer gemeinsam arbeitet, der findet zueinander, egal, welche Ansichten er haben mag. Das gibt einem das Gefühl, zu einem Team zu gehören. Vieles tritt dahinter zurück, Mister.
Man lernt, mit den Moskitos zu leben, mit den Ameisen, den weißlichen Würmern, die so gern Blut saugen an den Knöcheln. Man übersteht lachend Regengüsse und Durst, wenn man ganz oben auf einem Gerüst hockt. Man lernt, sich vor der Kälte in den Nächten zu schützen, und ein frisch gebratenes Hühnerei erscheint einem wie das Hauptmenü im königlichen Hotel »Royal« von Phnom Penh.
Es war nicht allein das Abenteuer, das uns zehn junge Burschen dort trotz aller Unannehmlichkeiten fesselte, es war vielmehr das Gefühl, an einer großartigen, einmaligen Sache mitzumachen. Ein Elektrizitätswerk, das Strom in entfernte Gegenden lieferte. Und das so ganz nebenbei dieses Nest mit seinen alten Leuten und den Kindern am Abend mit Strom versorgen, das ihre kümmerlichen Methoden, den Reis zu worfeln und zu schälen, in die Steinzeit verweisen würde. Ein Elektrizitätswerk, das Radiohören ermöglichte, sogar Fernsehen!
Und dann das Reservoir. Die Gegend hatte guten Boden. Nicht zu fett, aber trocken. Ein System von kleinen Gräben würde das Anlegen von dreimal soviel Reisfeldern erlauben wie bisher. Denn vorher mußten die Leute den ganzen Tag über das Wasser in Bambusbehältern an Tragestangen schleppen, um die Pflanzen feucht zu halten. Boote könnten auf dem Stausee fahren, Fische könnte man in großen Netzen fangen, statt sie, wie bisher, mit dem Speer im Fluß einzeln zu jagen. Von einem Schwimmbad träumten wir, ob Sie es glauben oder nicht. Wir hatten unsere Kraft entdeckt, das Leben zu verändern. Wir sahen da ein Stück kambodschanischer Zukunft wachsen, Mister. Unsere französischen Techniker belächelten uns zuweilen. Für sie war vieles Routine. Sie hielten uns für naiv. Kambodschaner seien große, liebenswürdige Kinder, hatte man ihnen schon zu Hause erzählt. Wie wenig sie von uns wußten!
Als der Damm fertig war, feierten wir ein Fest. Jemand hatte ein Schwein gestiftet, wir brieten es über Holzkohlenfeuer. Tanzten um die Flammen, sangen. Einer der Franzosen, er hieß Robert, teilte sich einen Becher roten Wein mit mir und sagte kopfschüttelnd: »Ich kann nicht begreifen, was euch so glücklich macht. Wenn wir hier fertig sind, werden alle auseinandergehen. Irgendwohin. Vielleicht gibt es Arbeit, vielleicht nicht. Und die Turbinen werden Strom erzeugen. Für Reismühlen und Ölpressen, für alle möglichen Dinge, an denen andere Geld verdienen. Für euch bleibt ein bißchen Musikgeplärr aus Radios, die Stimme des Prinzen, wenn er eine Rede hält und darüber schwadroniert, welch ein schönes Leben er für seine Untertanen schafft …«
Ich antwortete ihm, der Prinz sei mir ziemlich egal. Ich würde mich freuen, wenn meine Landsleute Licht hätten und die Räder in den Fabriken sich drehten.
»… für den Prinzen«, Robert grinste, als er das sagte. Dann trank er mir zu, und die Debatte war vergessen; bis wir eines Tages den Bau beendeten, lange nachdem die Leute in Samlaut rebelliert hatten. Wir hatten nur ungenaue Schilderungen gehört, was da vor sich gegangen war. Also konnten wir uns kein rechtes Urteil bilden, obwohl unsere Franzosen, die kleine Transistorradios besaßen, uns erzählten, es sei eine verdammte Schande, daß zuerst Lon Nol und dann auch noch der Monseigneur Papa selbst den Soldaten befohlen hätte, auf wehrlose Menschen zu schießen. Nur war das nichts so sehr Neues mehr; auf Unbewaffnete wurde bei uns in vielfacher Weise Jagd gemacht.
Ich merke erst jetzt, wie abgestumpft viele Kambodschaner damals waren. Selbstverständlichkeit: ein paar hundert Zivilisten von der Polizei getötet! Doch uns reizte das schon zum Nachdenken, zumal weder Lon Nol noch der Prinz selbst bei uns sonderliche Sympathien genossen. Es muß daran gelegen haben, daß wir uns oben auf der Staumauer oder im Gewirr der von uns gespannten Leitungsdrähte bedeutungsvoller und erhabener vorkamen als jeder andere Mensch.
Es kam der Tag, an dem wir den Fluß in sein neues Bett umleiteten und der See sich langsam füllte. Da hatten wir viel Freizeit, und wir halfen den Dorfbewohnern, Flutgräben auszuheben für die Felder, wenn wir nicht gerade eine Ausflugsfahrt in dem von den Franzosen gelieferten kleinen Motorboot über den See machten. Die Einwohner lohnten es uns auf eine überraschende Weise: Wir erfuhren zum ersten Mal, daß es auch in Mong Sene junge Burschen und Mädchen gegeben hatte, Frauen und Männer im Heiratsalter.
»Sie sind im Süden«, vertraute mir eine alte Frau an. Als vor Jahren Soldaten kamen und nach Roten suchten, die gegen die Franzosen gekämpft hatten, meldeten sich einige. Nicht alle, wie die Frau sagte. Es habe Mißtrauische gegeben. Die sich meldeten, wurden nach Battambang gebracht. Aber dort bekamen sie nicht etwa einen Orden, wie man es ihnen versprochen hatte – sie wurden eingesperrt. Als das in Mong Sene ruchbar wurde, und als neue Soldaten anrückten, die andere ehemalige Teilnehmer am antifranzösischen Widerstand mitnehmen wollten, flüchteten die meisten Männer mit ihren Frauen aus dem Dorf. Die Kinder ließen sie bei den Alten zurück. Ein Stück kambodschanischer Geschichte, Mister, das wir da kennenlernten. Wir waren betroffen. Als wir anboten, uns in Battambang für die vor so langer Zeit Inhaftierten einzusetzen, riet man uns, wir sollten uns die Mühe sparen, die Männer wären inzwischen hingerichtet worden. Die Anklage lautete auf verschwörerische Tätigkeit gegen das Königshaus.
Der Dorfälteste bestätigte es uns. Er sei von der Verwaltung über das Verfahren offiziell benachrichtigt und beauftragt worden, die Felder der Betroffenen an Leute zu verteilen, die keine Angehörigen im antifranzösischen Widerstand gehabt hätten. Was mich persönlich betraf, so war ich empört. Selbst unsere französischen Kollegen, gegen deren Landsleute die Erschossenen ja einmal gekämpft hatten, äußerten ihre Ablehnung. Sie waren ehrliche Männer, sagten offen, daß es sich um einen Krieg gegen eine Kolonialmacht gehandelt habe, den diese verloren hatte. Nach so einer Niederlage gehöre es sich, die Tatsachen anzuerkennen und auf neue Art miteinander zu leben. Sie selbst hätten das getan. Wären zu uns gekommen, um mit uns zu arbeiten, aus freier Entscheidung. Wir waren alle nicht in der besten Stimmung, als dann der große Tag herannahte: Chrot Preah, das Fest des heiligen Pflügens.
Dieser Brauch läßt sich bis in die Angkor-Zeit zurückverfolgen. Je nach der Mondstellung wird er datiert, meist um den Anfang des Maimonats, in der warmen Zeit, zu der sich der Nordostmonsun langsam verliert und die Trockenheit ihrem Ende zugeht. Das Fest ist brahmanischen Ursprungs, wie viele bei uns heimische Traditionen. Nach der Unabhängigkeit, so hatten wir schon in der Schule gelernt, hatte der Prinz es alljährlich wieder auf der Elefantenterrasse in Angkor Thom mit großem Pomp feiern lassen, viele internationale Gäste dazu geladen. Die Einheimischen trugen dabei ihre schönsten und kostbarsten Gewänder und die Ausländer schwarze Fräcke. Höhepunkt war stets das Ziehen der ersten Furche auf dem Reisfeld. Eine perfekte Show, Mister! Danach gab es dann Fröhlichkeit, meist bis in den nächsten Morgen.
Nun hatte Sihanouk herausgefunden, daß vor sehr langer Zeit Angehörige des Königshofes, Prinzen und Thronfolger, hin und wieder zur Zeit des Chrot Preah ein völlig unbekanntes Dorf mit ihrer Anwesenheit beehrten, um damit sozusagen die Götter der Fruchtbarkeit gnädig zu stimmen. Da unser Prinz viel auf Tradition hielt, belebte er diese Sitte neu. Womit ich zu einem weiteren Wendepunkt in meinem Leben komme, Mister. Der erste war mein Weggang von der Hauptstadt nach Mong Sene. Der zweite hatte einen völlig anderen Charakter. Kürzen wir die Sache ab: Prinz Sihanouk, so wurde uns an der Elektrostation gesagt, werde in diesem Jahr das Chrot Preah in Mong Sene zelebrieren. Das geschähe auch, um das neue Bauwerk einzuweihen. Immerhin lieferten wir bereits Strom in die Provinzhauptstadt, über eine eilig gebaute Leitung. Unnötig zu erwähnen, daß oft im Dorf der Strom ausfiel, weil die Städter ihn brauchten! Der kleine Stausee lag idyllisch an den leicht bewaldeten Ufern. Die ersten Silberreiher hatten sich eingefunden. Schilf, das es vorher nicht gegeben hatte, begann zu wachsen.
Ich selbst bekleidete mittlerweile den Posten eines Meisters im Elektrizitätswerk. Es dauerte nicht lange, da transportierten Lastwagen eine Kompanie Soldaten heran, die das Gelände absicherten und einen Landeplatz für den Hubschrauber des Prinzen herrichteten. Andere Wagen brachten Polizisten, aber auch Lebensmittel für ein Volksfest, Kleidung aus besseren Stoffen, Fahnen und Girlanden – überhaupt alles, was dem Ereignis den rechten Rahmen geben sollte. Podien wurden errichtet, auf denen Tänzerinnen in Apsara-Kostümen ihre Künste zeigen würden. Bauleute zimmerten auf dem See ein fest verankertes Floß, schmückten es mit Fahnen und Girlanden. Es sollte am Abend des Festes, feierlich beleuchtet, der Platz für eine Ansprache des Prinzen sein.
Natürlich kamen aus der Hauptstadt auch einige Instrukteure, die uns jeden Tag eine Stunde lang beibrachten, wie wir uns in Anwesenheit des hohen Gastes zu benehmen hätten. Fähnchen und bunte Tücher, mit denen wir winken sollten, wurden verteilt. Ein Reisfeld wurde bewässert, damit der Boden aufweichte, dann wurde ein Pflug mit Goldfarbe angemalt und der gutmütigste aller Wasserbüffel dazu ausersehen, das Gerät, hinter dem der Prinz schreiten würde, zu ziehen. Ein paar Dutzend Schritte nur, aber die Kerle aus der Hauptstadt taten so, als wolle Sihanouk an diesem Tag sämtliche Felder von Mong Sene für die Auspflanzung vorbereiten.
Daß die Dorfbewohner begeistert gewesen wären, kann man nicht sagen. Der Zorn und die Enttäuschung über die Ungerechtigkeit, die dem Dorf widerfahren war, saßen noch zu tief. Aber es gab keinen offenen Widerspruch. Wie hätte es ihn auch geben können, angesichts des bis an die Zähne bewaffneten Militärs und der schlagfreudigen Polizei? So bereitete man sich eben auf das Fest vor, das in jedem Falle ein Ereignis besonderer Art sein würde, denn trotz aller trüben Erfahrungen hielten die Leute den Prinzen für den rechtmäßigen Landesvater, für den von den Göttern auf den Thron gesetzten Abkömmling der Sippe Norodom. Ihm Respekt zu zollen war eine Selbstverständlichkeit.
Womit ich zu mir selbst kommen will. Ich sprach von einem zweiten Wendepunkt in meinem Leben. Er kam genau an dem Tag, an dem der Prinz, in einen Sampot aus Goldbrokat gekleidet, aus seinem Alouette-Hubschrauber stieg und lächelnd, die Hände zum Gruß vor der Brust gefaltet, ins Dorf schritt.
An dieser Stelle muß ich erwähnen, daß die Instrukteure gefordert hatten, jeder müsse im Angesicht des Prinzen auf die Knie fallen und dürfe sich erst wieder erheben, wenn der Prinz persönlich dazu aufforderte oder zehn Schritte weitergegangen sei. Während der Instruktion hatte ich mich zu dieser Anweisung nicht geäußert. Unsere französischen Techniker gaben uns zu verstehen, sie würden diesem Teil der Zeremonie nicht beiwohnen. Keine demonstrative Weigerung, dafür waren sie als Europäer zu klug. Sie schützten Unabkömmlichkeit aus Sicherheitsgründen vor, müßten, wie sie sagten, bei den technischen Anlagen bleiben und würden sich erst beim Volksfest zeigen.
Im nachhinein begriff ich, daß dies der bessere Weg gewesen war, seine eigene Würde zu bewahren. Aber da war es zu spät. Die Huldigung Seiner Hoheit hatte bereits begonnen. Ich weiß nicht genau zu sagen, was da in mir vorging, jedenfalls, als der Prinz, nach allen Seiten lächelnd und nickend, durch das Spalier der Leute ging, in dem auch ich meinen Platz hatte, sträubte sich alles in mir vor dem befohlenen Kniefall. Warum sollte ich mein Haupt vor einem Mann beugen, der veranlaßt hatte, dass jene Krieger, die in Wahrheit den Franzosen die Unabhängigkeit abgerungen hatten, erschossen worden waren? Ich brachte es nicht fertig. Ein wenig feige kam ich mir sogar vor, weil ich ihm nicht zurief, daß er am Schicksal der Bevölkerung von Mong Sene schuld sei.
Und so nahm die Sache ihren Lauf. Zwei Polizisten kamen auf mich zu und schlugen mich mit ihren Hartholzknüppeln. Ich solle gefälligst hinknien, wie sich das gehöre.
»Gehören würde sich, daß die Mütter der Getöteten ihn anspuckten!« sagte ich. Kniete nicht hin. Da schlugen sie härter zu. Ich wurde bewußtlos.
Als ich wieder zu mir kam, war es schon dunkel. Ich konnte den Lärm des Volksfestes hören, aus einiger Entfernung. Ich sah auch die bunten Lichter der Lampions. Aber ich konnte weder Hände noch Füße bewegen. Man hatte mich gefesselt und an die Wand einer der Baracken gelehnt, in denen Ersatzteile für die Turbinen gelagert wurden. Nach einer Weile konnte ich in der Dunkelheit einen Gendarmen ausmachen, der mich offenbar bewachen sollte. Aber er interessierte sich nur wenig für mich, glaubte wohl, ich wäre sicher genug verwahrt, und beobachtete von einer günstigen Stelle aus das Treiben auf dem Festplatz.
Um diese Zeit war der Prinz, wie ich später erfuhr, längst nicht mehr in Mong Sene. Er hatte unter dem Applaus seiner Begleitung, in den die Dorfbevölkerung einfiel, eine Furche in das Reisfeld gezogen, dann, wie er das immer so tat, die Hände zum Gruß gefaltet, eine Weile im Gebet verharrt und war schließlich, würdevoll nach allen Seiten nickend, wieder zu seinem Hubschrauber gegangen. Nicht ohne ein paar Kästen Limonade für die Dorfbewohner, Bier für die Soldaten und Ansteckplaketten mit seinem Konterfei für die Kinder dagelassen zu haben. Die Freude darüber, so hörte ich später, soll sich in Grenzen gehalten haben, ausgenommen bei den Empfängern des Bieres.
Was tun? fragte ich mich. Mir wurde klar, daß mir Schlimmes bevorstand. Sollte ich abwarten, bis die Polizisten mich erneut verprügelten, nachdem das Fest vorbei war? Mich von ihnen ins nächste Gefängnis schleppen lassen, wo man, wie ich wußte, Leute jahrelang in dunkle Zellen gesperrt hielt, bis sie an irgendeiner Krankheit starben? Beleidigung des Prinzen – das war ein Kapitalverbrechen. Ich prüfte den Sitz der Fesseln – sie waren solide, ich würde sie allein nicht lösen können.
Während ich überlegte, wie ich das Seil, das meine Hände band, vielleicht durchscheuern könnte, hörte ich hinter mir plötzlich die Stimme des Franzosen Robert. Er flüsterte meinen Namen. Ich gab ebenso leise Antwort. Robert war unbemerkt in die Baracke gelangt. Jetzt hatte er das Fenster über mir geöffnet und forderte mich auf: »Beuge dich nach vorn, so weit du kannst!«
Ich tat es, merkte sogleich, wozu das gut sein sollte. Robert, den ich nicht sehen konnte, schob durch das Fenster eine Stichsäge zwischen meine Handgelenke, und dann begann er, sie auf und ab zu bewegen, bis der Strick riß. Die Fußfessel konnte ich mit der Säge, die mir Robert überließ, selbst lösen. Immer hatte ich dabei den Polizisten im Auge, der ahnungslos dem Festtrubel zusah, etwas sehnsüchtig wohl auch, weil man ausgerechnet ihn hierherbeordert hatte, wo es doch im Dorf so viele ansehnliche junge Tänzerinnen gab, die aus der Hauptstadt eingeflogen worden waren …
»Haben sie dir was gebrochen?« erkundigte sich Robert flüsternd.
»Nein. Ich kann mich bewegen. Nur der Kopf tut weh.«
Robert flüsterte: »Bleib nicht länger hier; hau ab! Irgendwohin. Am besten südwärts. In den Kardamombergen soll es Leute geben, die sich gegen den Prinzen zusammengefunden haben. Sie werden dir helfen können, wenn das überhaupt jemand kann. Und – am Seeufer, dort, wo wir die Steine aufgeschichtet haben, liegt das kleine Motorboot. Kannst du den Motor bedienen?«
»Ich habe es oft genug getan!«
»Gute Fahrt, mein Junge! Lauf zum See, spring in das Boot und verschwinde. Südwärts; merke es dir!«
Es waren die letzten Worte, die ich noch verstehen konnte. Der Polizist hatte sich umgedreht und sah nach mir. Etwas war ihm wohl eigenartig vorgekommen, vielleicht, daß ich nicht mehr an der Wand lehnte, sondern vorgebeugt saß. Robert mußte das Fenster schließen. In meinen Händen, die immer noch auf dem Rücken lagen, ungefesselt jetzt, spürte ich die Stichsäge. Ein viertel Meter langes, scharfzahniges Werkzeug mit einem Holzgriff. Ich hatte gerade noch Zeit, meine rechte Hand um diesen Griff zu schließen, als der Polizist auch schon vor mir stand. Er war klein; ein kräftiger Mann, mit einer Maschinenpistole bewaffnet, wie alle anderen. Die Waffe baumelte vor meinem Gesicht, als er sich über mich beugte, um sich vom Sitz der Fesseln zu überzeugen. Da, Mister, rettete ich mein Leben, indem ich ihn tötete. Ich sprang auf, und als er die Maschinenpistole mit dem Kolben an die Schulter ziehen wollte, riß ich ihm die Säge über die Kehle.