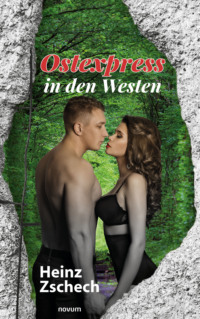Kitabı oku: «Ostexpress in den Westen», sayfa 6
„Alle zehn Jahre rückt er weiter nach oben“, glossiert der Armenier die Karriere von Wassilis Vater. „In dreimal zehn Jahren hat er nur noch unter sich einen winzigen Rest von den auserwählten Gesalbten: dreimal gewünscht, dreimal darfst du raten, dreimal geht es in die Hosen. Es hängt an der einmaligen Höhe, und die hängt bis sie fällt – die hängt, bis sie henkt. Sein Vater hofft auf das Letzte. Er will in den Himmel.“
„In dreimal zehn Jahren ist sein Vater dort, wo sein Banknachbar stand“, unterbricht ihn Wolodja.
„Vielleicht. Aber die Überlebenden leben heute sehr lange“, widerspricht ihm der andere.
„Zu Hause bei uns klebt ein Foto im Schrank“, erzählt Wasili weiter, „die ehemalige Klasse des Vaters von Moskau: In der vordersten Reihe, Seite an Seite, sitzen mein Vater und Dubček.“
„Es war nicht die richtige Seite gewesen“‚ weiß Samuel jetzt.
„In Moskau waren sie das allererste Mal zusammen, und auch das letzte Mal war es in Moskau gewesen. Das war Jahre danach.“
„Vor dem letzten Tag Dubčeks“, ironisiert der Armenier.
„Sie saßen da noch vor kurzem in Moskau hart auf der Bank, alle gemeinsam, die Genossen. Mein Vater sagte zu ihm: ‚Wir sind doch Freunde gewesen!‘ – Dubček sah sich um und fing an zu … weinen. Von den Bänken tröstete man ihn. ‚Wir sind das letzte Mal Freunde gewesen!‘“.
„Danach hat er ihn nie wieder gesehen.“
„Siehst du, Fritz, so schnell kann das gehen! Einmal probiert und dann in die Sterne gerotzt. Und du willst im Institut Vorträge halten! So etwas ist für die Fotz. Nimm dir ein Mädchen und schlaf mal darüber!“
„Ein Mädchen? Als wäre das hier bloß so einfach.“
„Du Klöppel bist natürlich verwöhnt. Bei euch lassen ja auch die Kinder schon an die Möse.“
„Na, na.“
„In Europa nehmen die kleinen Mädchen bereits Pillen“‚ bestätigt Wasili. „Was heißt ‚kleine Mädchen‘?“, fragt Martin.
„Dreizehn, vierzehn, fünfzehn usw.“‚ sagt Sjoma.
„Das glaube ich nicht“‚ zweifelt Wolodja.
„Oh ja! Ich leg dir die Eichel unter den Hammer. Da findest du garantiert keine mehr, die Jungfer noch wäre.“
„Ganz so schlimm ist es nicht“, streitet der Bulgare. „Samwel übertreibt wieder wie immer.“
„Meine Fresse! Übrigens, Fritz, erzähl doch mal! Bei euch gibt es jedes Jahr im Frühjahr ein Fest.“
„Hm. Und?“
„Und? – Da werden die kleinen Schnecken geknackt. Alle vierzehnjährigen Mädchen springen über die Klinge. Stimmt doch?“
Sarodnick wird rot, stottert, lacht hilflos und spürt die Augen auf sich gerichtet: „Na?“, fragen sie, und „Das kann doch nicht sein!?“ – Was soll er ihnen nur antworten? „Es gibt bei uns sicher für die Kinder, die die achte Klasse beenden, eine Feier …“
„Na bitte!“
„Nein! Das ist so eine … das ist die Konfirmation.“
„Was für Zeug?“
„Oder auch Jugendweihe.“
„Was hab ich gesagt? Weihe. Sakrale Weihe, wie zu vorchristlichen Zeiten: Das Mädchen wird dem Schwanze geweiht.“ – Und Sarodnicks abwehrende Worte verschlucken sich unhörbar im lauten Gelächter.
13
Beides hatte Martin damals gewollt, wünschen müssen unter Nachhilfe und Druck: Konfirmation für die Eltern und für das Dorf, die Jugendweihe jedoch für die Schule, für seinen Lehrer, der geradeheraus ihm erklärte: „Ohne Weihe – keine Oberschule, und ohne Oberschule – kein Studium.“ – Damit hatte man ihm freilich die Unschuld genommen, die Unschuld der freien Entscheidung, das, was vor der Vergewaltigung steht.
Die Bibel und „Weltall, Erde, Mensch“ schenkte man ihm: zwei Bücher – für jede Hand eins, für jeden Glauben einen Titel oder für den Nicht-Glauben eine Erklärung. Als Vorhang oder als Fortsetzung las sich die Heilige Schrift als ein hinter dem Weltall, ein „Was kommt nach dem Buche der Erde und unseres Alls“. – Sie war Strenge für Martin, schwarzer Ornat, war weiße Gesichter und auswendig gelernte Gesänge. Die Konfirmation indes war das Dorf, die Isolation, war das Ghetto der Religion.
Manchmal hörte man hinter dem Altarraum Gelächter, das aus den Ruinen kam, welche die Kirche – die selbst fensterlos, turmlos, mit abgeschlagenem Haupte – umgaben, umtrauten, trauerten, den Krieg beschworen und „Gott bewahre“ noch schrien. Dieses Lachen war ein Schieflachen also, eins aus den Trümmern, in denen die Stadtkinder Tabak verteilten und Seiten aus ihren Heften fetzten, um sich Zigaretten zu drehen. Zu Hause sagten sie „Religionsunterricht!“, hier aber starrten sie in die Asche, die glühte, verschluckten das Husten, und ihre Augen warteten auf das Wunder.
Zwei Mal in der Woche, zwei Mal Gottesdienst mit ängstigen Fragen, die oben hängenblieben im dritten Gestock, im wurmkränkelnden Gestühl, das knarrte, wenn man dranstieß. Unten freilich saßen bloß die Dorfkinder in der Buße, Kinder mit Eltern, die von früh bis abends auf den Feldern rackerten, die wussten, dass es zu Essen nichts gab, wenn die Ernte verreckte. Wer könnte da schon helfen, wenn nicht der liebe Gott? Wer könnte die Arbeit verfluchen, sonntags und feiertags und abends und nachts? Und wer könnte verzeihen und die Verzweiflung nehmen und geben und nehmen und weinen und wissen, dass jemand einem zuhörte, wenn die Eltern schon nicht, die abgenutzt, Ohren verschlossen, und verschlissen die letzte Kraft gaben für Schläge, um den Ärger irgendwo in die Ecke zu werfen? Die Schuldigen saßen zu weit. – Zwischen diese Kinder, zwischen Dorf und die Stadt, zwischen Arbeit und Tun, zwischen Demut und Trotz hatte sich Martin gesetzt. Er fuhr die fünf Kilometer in die Schule und nur in die Schule, denn für mehr, für Freundschaften, für Spaziergänge war die Stadt für ihn Ende der Welt, „für den Hund“, unrückbar, unreichbar, und selten gewährte man ihm den längeren Atem dorthin. Immer war es nur ein Moment, ein Blitzmoment, ein Sprung, ein „Satz“ und geschafft. – Das Dorf lag näher gewiss, aber für Martin war es noch weiter, um in sein Leben zu greifen: Andere Kinder, andere Fragen, andere Welten wuchsen da drin. Er wohnte dazwischen, war Zwischenkind – mitten hinter dem Walde, mitten hinten und vorn. Sein Vater war Lohnarbeiter, seine Mutter und Großmutter waren Bauern, das machte zusammen einen schönen Arbeiter- und Bauernsohn wohl. Wäre es bloß so einfach dieses Gemisch aus Eigentum und geeignet fürs Schuften! Der Bauer gab dem Arbeiter Fressen, und am Sonntag gingen beide zur Kirche. Ein Rucksackarbeiter war der Vater, und auf dem Rücken hatte er immer etwas in stiller Reserve – kein Arbeiter also, kein echter, keiner nach Marx, denn er ging freiwillig in die Fabrik. Aber auch kein richtiger Bauer, denn zwei Kühe machten die Sahne nicht fett. Dafür waren die Brotstullen dicker, und der Sohn lief zum Religionsunterricht – wie alle im Dorf. In diesem Punkt war Martin also das Dorf, im anderen hingegen standen die Jugendweihe und die Arbeiterluft. Martin schnüffelte an beiden: Fuhr zur Schule in die Stadt und war nachmittags auf dem Feld, ging in die Kirche und ebenso zur neuen Aufklärungszunft.
„Weltall, Erde, Mensch.“ Da gab es Filme und Exkursionen, und da besuchte man das Hygienemuseum mit mahnenden Worten: „Wer onaniert, dem steigt es zu Kopfe! Oder: Wer onaniert, dem bläst es den Geist aus, und er wird demzufolge ein Blöder. – Finger davon!“, sagte der Leiter, „das könnte ins Auge gehen und tiefer.“ – Und die Kinder schauten sich in die Augen und suchten darin zu begreifen, wer unter ihnen ein Blödian wär’.
Im Frühjahr reisten die Kinder nach Weimar zu Goethe und Schiller, während Nietzsche stillschweigend im Grabe verblieb, grabstill, ohne ein Wort, denn bestimmt hat so einer auch nicht gelebt, hat vielmehr den Geist sich überschnappen lassen von der Un-Onanie, vom Gar-nicht-geliebt oder doch von Onanie auch: Sich ruiniert in dem Kopf von der Sich-Liebe, vom „Immer nur begatten das Ich“. – Darüber aber sprachen sie nicht, diese Kinder, die sich aufklären ließen von deutscher Klassik und vor Goethes Ei im Gartenhaus staunten. Von Weimar chauffierten sie zu Fichte und ins Weltplanetarium nach Jena. Das war eine Kugel in Weiß, oder eine Halbkugel besser, ein zerschnittener Globus, in dem die Bänke drum herum ellipsenförmig aufgestellt waren. Die Kinder starrten auf die Decke, warteten auf die Erscheinung, dass die Tünche zerfließt und der Globus zerplatzt. Ziemlich dicht saßen sie, waren erregt, und auch Angst spielte dazu, als das Licht schnell verlosch und lange nur Dunkelheit herrschte. Eine Hand fasste plötzlich Martins, ein Mädchen drückte sich enger an ihn, suchte die Augen und suchte den Mund. Die Sterne kreisten um ihn, und die Schatten zogen über Gesichter, die hinauffuhren in Monde, in Milchstraßen – ins All. Martin hatte die Lippen des Mädchens, hatte seine Zähne im Mund, sah die Sterne in seinen Haaren, auf seiner Brust, und er tastete in die Sonnen, berührte die Wangen, spielte zu den Himmelskörpern hinauf. Aufgerührt spürte er den Kosmos in sich, griff in das All, das mählich sich drehte, und die Lichtpunkte flohen und flossen ins Ich. „Nicht gehen!“, flüsterte sie, „ich halte sie fest.“ – Und Martin nahm die Sterne, saugte das Licht zwischen das Dunkel und atmete es gierig in sich. Schmerzhaft erschrocken rauschte es hin. Ihre Hände glitten herab, er küsste ihre Brüste im Wall, und seine Finger fanden die Bahnen in Gräben. Das Blut rann auf der Lippe, die Hände klammerten, öffneten die Gestirne und ließen die Freude, steigen ins All, in die Unendlichkeit, in den Fluss, in den Sprung, in das Nichts. –
Das Kreisen wurde ein Karussell, die Lichtfetzen jagten die Bahnen, und zwei Sterne stürzten in eins. Das Mädchen schütterte, taumelte, das Beben lief wie eine Schlange zu ihm, kehrte im Kreise, zog über die Erdwelle hin. Fasern spannten in Lust, und die Hände glitten am Ende ins Zittern, ins Herz mit dem Schlage aus Glut. Er ergoss in die Wonne, lief über die Arme, mischte sich mit den Sternen – wurde zum Milchstraßenfluss. – Hernach erloschen sie alle, das Kreisen beschloss, der Globus wurde zur Decke, und die Decke zum Kalk. Man rieb sich die Augen, die Lampen schmerzten darin, man suchte zu kennen und verzagte vor Mut. Sie war Ricarda, mit Lippen, die rot-schwollen waren. „Martin“, sprang es von ihnen, „ich fühl dich im Fuß.“ – „Du hast Sternschnuppen im Kleid“‚ sagte er und war für lange entsprungen. –
Später traf er sie wieder – am ersten September, am Tag, als für ihn eine neue Schule begann: Ober-Schule, ein Gymnasium für heute, eine Schule für die, die besser waren als die anderen, besser nach Meinung der Lehrer, nach Meinung der Zettel, die man zweimal im Jahre verteilte. Eine Belohnung war es, und die zog über vier Jahre sich hin, eine Standleiter, die von Grundschule, Mittelschule, Oberschule bis zur Hochschule sich streckte. In die andere Richtung aber wäre nur Sturz, wäre ein infantiles Geheule. Nach acht Klassen waren es vier für Sarodnick noch in der oberen Schule – angesammelt, gesiebt, geordnet aus den vielen mittleren Schulen im Kreis. Ein kleines Häufchen sammelte sich zum Viellernen, Besserlernen, Vergessen. – Unter ihnen saß auch Ricarda aus Neudorf. Neudorf, weil neues Dorf, und neues Dorf hieß ein Ort mit einer schon vor Jahren geschaffenen Genossenschaft für die Bauern, war so viel wie Vorreiterposten, eine Aktivistengemeinde, ein Voraktivist. Ricarda Kaiser war das Kind vom Vorsitzenden dieser Genossenschaft, der ein Abkommandierter vom Landwirtschaftsrat im Bezirk war, der den rückgewandten Bauern der anderen Dörfer auch vorführen konnte und vor allem sollte, was Zukunft hieß und was ihre Stunde geschlagen. Aus diesem Grunde konnte seine Tochter auch nur eine Jugendweihtochter sein – ohne dieses Halbe und Halbe. Noch dazu damals in diesem entscheidenden, in diesem wichtigsten Jahr, als der Sturm auf die Bauern anhob, als der Auszug der Vorposten begann und zum Einzug der Noch-Besitzer ins Allgemeinwohl und Habenichts Stadium führte: Die Proletarisierung der Bauern, das vollprozentige Genossenschaftsdorf nannte es sich.
Ricardas Vater streifte durch Lande, rührte kräftig die Trommel, redete Stunden, zerredete Nächte, hob warnend den Finger, die Fäuste, gab zu denken, zu schenken: Den Ersten kam er mit Autos, den späteren mit Zement und mit Schlachtscheinen – die Letzten bissen die Schweine. Auch in Martins Dorf, in Sorbwinkel war Vater Kaiser gewesen – bei Metaschk, bei Paulik, bei Petschick, bei Sarodnicks in dem Haus und agitierte, propagierte und drohte. Seither kannte man ihn nicht mehr, wollte man ihn nicht mehr sehen und hören, sagte: „Was mischt der sich hier bloß ein!“ – Martins Mutter hatte schnell ihre Kühe verkauft, hatte sich verkleinert, verwinzigt von sechs Hektar auf ganze drei Morgen, wurde vom Bauern zum Groß-Schrebergarten-Besitzer. „Schuld hat die Kolchose“, schimpfte sie, „die LPG, der Fortschritt, der Kaiser.“ – Zwar kam man gerade noch einmal herum – von dem Genossenschaftlichen, von dem Gemeinen – , aber zurückblieb der Bauer, zurück blieben die eigene Milch und die Butter, blieben die fetten Jahre, der Acker, der 16-Stunden-Tag und das Jahr ohne Urlaub. Martin wurde zum Arbeiterkind, zum ganzen, zum echten, ohne Geruch von Sahne im Haar. — Ricarda jedoch war stolz auf den Vater. Die Schlacht war gewonnen, der Staat 100-prozentig – ein Volk, eine Gemeinde –, und der Bauer eingegliedert ins Wohl und Wehe für alle. Ricardas Vater schritt ganz vorne mit an. Martin indes verfluchte die Tochter oder schämte sich wegen der verlorenen Sterne.
So oder so, er ging ihr aus dem Wege, obgleich sie in derselben Klasse saßen und lernten. Er konnte den Vater ihr nicht verzeihen oder ihren Fortschritt, ihr Weiter-Sein, ihre Überlegenheit in den Fragen – „In welchen eigentlich denn?“ –, in Fragen der Liebe. Martin spürte es, fühlte, dass sie ihn mochte, möchte für immer, für lange, für mehr – für das ganze Milchstraßensystem. Allein, er hatte ihr nur die Furcht zu bieten und ein wenig seichtes Gesabber und kaltes Gelächter dazu: Einer, der nimmt sich selber nicht ernst. Er ging seiner Wege, Umwege, um sie weit herum und sah vier Jahre ihr nicht mehr direkt in die Augen. Ab und an nachts wohl, wenn er träumte, wenn der Stoff haftete am Leib, und er am Morgen sich abwusch vom Schleim, spürte er sie: ein grausames Spiel – Spielverderber, verdorbenes Ei. Vier Jahre. Beinahe.
Einmal noch, in der Hälfte der Zeit drang er in sie ein, verstohlen, wie ein Dieb, in ihre Wäsche, in ihre Gedanken: Er hielt ihr Tagebuch in den Händen, wollte lesen, blätterte drin. Seinen Namen konnte er entzifferte, und der Kopf tat ihm weh – das Kreisen wie damals begann, die Nacht, das Zeitlose, das All. Dann war sie plötzlich in die Klasse getreten, berührte ihn, sagte irgendetwas und suchte den Blick. Der aber war in dem Absatz, im Wegfall, mit Augäpfeln ganz weiß und Erschrecken. Roh stieß er sie fort, und das Buch fiel schreiend zur Erde. – Martin wurde daraufhin, als Konsequenz und wegen sträflichen Verhaltens aus dem Schulensemble ausgeschlossen, erhielt einen strengen Verweis, und sein Name wurde ausgehängt in der Halle wie vor dem Richter: „Sarodnick, Martin – ein Dieb!“ – Ricarda hatte sich beklagt und geklagt: „Der dort hat mir die Tasche gestohlen!“ –
Endlich aber war da noch einmal ein kurzes Aufblitzen, ein Zusammenstoß, ein „Noch-einmal-Vergessen“. Das war kurz vor dem Abitur, vor dem letzten, vor dem Auseinandergehen für immer. Ricarda sollte Nachhilfestunden in Mathe bekommen, und der Lehrer bestimmte Martin dafür. Seltsamerweise. Obwohl Sarodnick in Mathematik nicht schlecht gewesen, gut, vielleicht sehr gut war. Aber warum er, warum ein Junge, warum überhaupt dieser Kram? Doch es gab kein „Nein“ und kein Aufbäumen: Vor dem Abitur hielt jeder das Maul, „bloß durchkommen“, „Glück haben“, „nur nichts verscherzen!“ – Sarodnick nickte und ließ sich seine Arbeit diktieren. Drei Mal lief alles recht gut. Sie lernten gleich nach dem Unterrichtsschluss, und sehr viele Leute rumorten auf den Korridoren laut. Martin streifte nicht seine Hemmungen ab, das ist, seinen Humor oder, besser, seinen Sarkasmus, streifte nie seinen Blick ab von der Tür und ließ sich die Zeit abrollen in bloßer Routine. Eines Tages freilich konnte Ricarda nur am Abend erscheinen, und ihr Vater sollte sie dann abholen um elf. – Leicht erhitzt betrat Martin die Klasse. Die Sonne stand schon tief, und wie ausgebrannt wirkte die Schule. Ein Windlächeln drückte von außen ins Fenster, und Ricarda spielte im Haar. „Es ist heiß“, sagte sie. „Früher haben wir bei so einem Wetter Hitzeferien bekommen.“ – Aber nun waren sie Abiturklasse, und niemand gab ihnen frei. „In vierzehn Tagen ist alles vorbei“, antwortete Martin lässig. „Dann machst du sowieso, was du willst.“ – Und der Sinus huschte über die Tafel, die Kreide zeichnete auf der Haut und fiel mehlig auf die nackten Füße von ihm. „Wir müssen nochmals Kurven berechnen!“, versuchte er besonders wichtig zu sein. Wenn nur die Sonne noch bliebe und der Abend noch einen Tag währte – vor dieser Nacht! Draußen heulte ein Motorrad laut rufend auf, und Martin erhob seine Stimme. „Da könnte man singen.“ – Der Schwamm schmierte trocken über die Tafel. Man müsste ihn waschen, man müsste alles neu wischen, saubermachen, wieder ins Reine bringen. Drunter auf der Tafel tauchten die Konturen des Vormaligen auf: „Man sollte wenigstens einen Lappen hier haben. Die alten Kurven erscheinen, verwirren das Bild. – Verdammt, es ist schon zu dunkel. Aber kein Licht! Das Geschmiere – kein Licht! Ich sehe, was du nicht siehst …“
Und Ricarda war still, sagte etwas später bloß: „Ich setze mich näher, von hier sehe ich nichts.“ – Doch „Licht“ sagte sie nicht. „Das hat sie vergessen. Vielleicht haben sie in Neudorf auch keins? Nur Kerzen. Oder liegen um diese Zeit schon im Bett. – Quatsch! Ein Dorf ohne Licht! Außerdem hat ein Vorsitzender alles. – Noch einmal von vorne! Von Anfang. Wir waren bei Minus …“, reflektiert Martin.
„Du hast Kreide im Haar“, meinte sie plötzlich, und Martin verhaspelte sich, schluckte Mut und schielte auf ihre Stimme. Ihre Zehenspitzen drückten sich ab, und ein Mund hauchte ihm Wärme ins Ohr. Sie knickte ein in den Knien, lachte: „Ich bin wohl zu klein“, und Martin hielt ihre Schultern im Arm. Schatten gerannen, die Helle machte sich rar, und auf den Boden glitten zwei Rücken. Ihr Hals beugte sich zu den Lippen, und von der Tafel sprangen die Kurven ins Kleid. Haut suchte Kühle, sprengte die Hülle, wollte die andere Haut reißen an sich, und die Finger spielten im Hirn. Eine Öse rollte über die Dielen, und er spürte das Heiße, spürte die Beine an ihm, fühlte das Vibrieren unter dem Nagel, benetzt von dem Haar. Herzschläge zerrten in ihm, Hochschläge und Auffall – ein leichtes Rauschen im Sinn. Es verlangte Unendlichkeitsgründe, wünschte den Abgrund, die Metamorphose, begehrte das eine: über in sie. – Ihre Füße krümmten sich weg, legten sich breit. Martin ging über Nacktes, über den Leib, und das Mädchen strebte zu ihm. „Nein!“, löste sich überströmend sein Schrei in die Angst, und der Sinn sickerte ihm über den Boden – dem Mädchen zum Trotz. – Sarodnick suchte den Schwamm, suchte das Du und fand sein eigenes nicht. Fluchtträchtig entleert in der Hoffnung, hatte das Mädchen auf den Falschen gesetzt.
Draußen aber heulte wieder dieses Motorrad, und die Schläfe litt von dem Klang. Ein Vater schaute nach seiner Tochter, und in dem Zimmer brannte kein Licht.
„Ach guten Tag, Herr Kaiser! Wir sind gerade fertig.“ – Doch fertig war Sarodnick bloß, und Ricarda fiel durch das Mathematikabitur. Die Schuld war wohl in den Sternen verwirkt.
14
Im Frühjahr reist Petra nach Moskau. „Oh, endlich!“ – Sarodnick wird ihr die Stadt zeigen, den Kreml, die Universität, die breiten Boulevards. Doch Martin kennt die Stadt nicht, kennt die Straßennamen nicht, nicht die Plätze, die Vororte, die Museen – er sollte anfangen bei null: „Hier ist null. Siehst du von weitem die Stellen hinter dem Komma? –
Ein Buch sollte ich kaufen. Drei Tage Moskau, von hinten bis vorne, auswendig lernen und hinbeten zum Staunen: ‚Wie viel hat der doch gelesen!‘ Ein Buch – drei Tage für Petra, im Frühling in Moskau. – Was habe ich nur die übrige Zeit angestellt? Studiert bis in die Nacht und gedacht, das Internat stände mitten drin in der Welt. Mit Monika hätte ich die Gegend abfahren sollen. Aber von Monika lieber kein Wort, kein Wort an Monika für die paar Tage mit Petra!“ —
Mit Wolodja holt Sarodnick Petra vom Flugplatz. Der Freund ist besser im Bilde.
„Das ist übrigens …“ Sarodnick drückt Petra ungeschickt mit dem Mund auf den Mund. „Wie schön!“
„Guten Tag, Petra!“, artikuliert Wiadimir geschickt. Er hat Deutsch in der Schule gelernt. „Und das dort ist ein Denkmal, Panzer-Stopp. Hier waren Deutsche – bis hier.“
„Oweia! So weit? Man kann von hier Moskau schon sehen“‚ ist Petra überrascht. Normalerweise sieht sie Moskau von den Ansichtskarten nur, die Martin ihr schickt, formt dieses Land aus den Albträumen des Vaters einst und der vielen Väter daheim.
„Von dort fahren die Schiffe ab über die Moskwa zur Wolga. – Hier an diesem Bahnhof bin ich angekommen mit dem Zug, damals im Sommer.“ – Petra streichelt die Hand:
„Ich bin sehr glücklich bei dir.“
Sarodnick schläft im Hotel Bukarest an dem Fluss, und die beiden sind froh, sich wiederzusehen, wieder zu spüren nach so langer Zeit. „Wann habe ich bloß das letzte Mal im Hotel …? Habe ich überhaupt im Hotel …?“ Im Hotel ist alles inklusive: die Wäsche, die Liebe, das Wasser im Bad. „Wie lange haben wir uns nicht mehr gefasst?“
„Es ist wie …“
„Du.“ – Ein Hauch weht über die Lippen.
„Hast du etwas bemerkt?“
„Nein. Das ist Moskau, über dem Fluss.“
Sie fahren mit der reisenden Gruppe im Bus, und Sarodnick erlebt die Stadt zum ersten Mal als ein Tourist.
„Ist die aber groß!“
„Da kannst du mal sehen.“
„Jeder Pavillon war früher unseren fünfzehn Sowjetrepubliken gewidmet“, erklärt Wolodja in der Volkswirtschaftsausstellung. „Man kann die Konturen und Buchstaben von den vormaligen Losungen noch erkennen: Stalin und Stalin und Stalin … – Lissitzky hatte dem Bau die Hand anlegen wollen. Als wäre man noch bei 1920 gewesen!“ Im Panoramakino kugeln sich die drei fast ihren Kopf aus für hundert Kopeken, als seien sie mitten dabei. Und sie ducken sich von den Schmerzen im Rücken.
„Das ist die Zukunft des Films“, erläutert ihnen Wladimir. –
„Das ist Semjon-Sjoma, das ist Ljuba, das ist Jura – ein Film-Ökonom“, stellt Martin seine Freunde ihr vor.
„Zum Einfließen schön ist deine Petra“, sagt Samwel, und geniert öffnet Wladimir die Flasche mit Wodka. „Ich tuckel nur Wein“, bemerkt der Armenier, und Wladimir gesteht:
„Ich trinke eigentlich nicht.“ – Galant ausgeschwungen spricht er zu Petra, aber das Mädchen kann nicht schwingen mit ihm – sie lässt es sich übersetzen, unübersetzt.
„Dieses mit den Kanonen vor der Blende über dem Tor …– haben Sie es schon visitiert?“ Petra lacht über den Ton.
„Das ist das Museum der Revolution!“ Sie entschuldigt sich rasch: „Bei meinen paar Tagen! Ich kann nicht alles besuchen.“
„Schade. Sehr schade. Einmal war es der englische Club, und man speiste dort ein Menü à la Zar – extravagant und superb.“
Jura hat für Samwel Portwein für einen Rubel zwanzig besorgt.
„Auf ihrer ersten Voyage in unserem Land!“, prostet Wowa und hebt das Glas. Rasch hat der Ökonom, der Ukrainer aus Kiew, den Klaren aus dem Auge verloren, und er lacht nur noch aus Spaß.
„Das kann heiter noch enden!“ –
„Auf Deutschland. Prost!“
„Ihr Vater war in Russland gewesen?“
„Keine Geschichten!“, ermahnt Samwel den Ukrainer.
„Dort in der Passage hat sich Majakowski erschossen.“
„Dann wollen wir nicht mehr stören“, rüstet die schüchterne Ljuba zum Abgang. Doch die Getroffenen bleiben stumm und stumpf in den Sesseln. Nur Wladimir weiß, was sich gehört, und er küsst die Hand der „Deutschen Madame“: „Auf Wiedersehen! Es war mir eine sehr große Ehre, mit einer solchen Dame zu konversieren.“ – Wolodja und Ljuba verlassen das Paar. Die anderen aber prusten, lallen und lecken den mickerigen Rest aus den Flaschen.
„Du musst nämlich wissen, Wowa, der spinnt“‚ wird der Armenier sehr deutlich. Für Petra aber ist alles prima und „nett“: „nette Leute“, „netter Abend“, „nettes Gespräch“. „So viel habe ich lange schon nicht mehr getrunken!“
Ein normaler gewöhnlicher Tag: Alle besaufen sich, umarmen sich, schlecken sich ab und finden – „welch ein Wunder!“ – hinterher noch ihre Betten. Am nächsten Morgen kommt man natürlich zu spät zu den Seminaren, und der Kopf brüllt zum Schreien: „War ich gestern voll leerem Stroh!“ – Jetzt aber spielt es keine Geige, die Saiten sind vollzählig, sind mit Seife geschmiert, und es rutscht wie in den besten Konzerten. „Auf unser schönes deutsches Mädchen!“ – Und man prostet die ganze Familie und lässt sie in Toasten und Trinksprüchen hochleben. Es bleiben die Toten noch über: „Tränke man bis zum Jüngsten Gericht …!“ „Um die Ecke, zur Neglinnaja hin, war einst der deutsche Bezirk“‚ weist Samwel ausschweifend breit aus und lässt noch einmal sich nachschenken. „1914 wurde er reif zum Prügeln und Massakrieren geschlagen.“
„Was konnten denn die armen Leute dafür, für den Krieg?“, fragt Petra.
„Wer konnte dafür? Pogrome sind Abwehr. Das geht weit ins Abstrakte“, antwortet Jura.
„Einige wurden sogar selbst von den eigenen Leuten inszeniert und dann an die große Glocke gehängt. Siehe Odessa“, erinnert der Armenier.
„Stimmt! Wie im Film.“
„Bloß die Ausländer hatten die Genehmigung mit Wodka zu handeln.“
„In Russland! Stellst du dir das mal vor? Das Trinken kommt hier noch vor dem Saufen.“ –
Sehr spät löst man das Häufchen auf in dem Glück. Man hat sich getroffen. Halb fallend stützen sich Jura und Samwel in die wartende Taxe.
Martin schläft sich bei Petra, hält inne, überlegt: „Ist es Zeit? – Noch ein Weilchen. Es ist so gut, nahe zu sein.“ – Er küsst ihre Zähne, wechselt den Takt und verendet im Nabel: „Es ist kummervoll, sich trennen zu müssen.“
Auf dem Flugplatz, am Arm, ist Petra wieder sehr traurig. Der Koffer, die Souvenirs, der Sekt … „Wann seh’ ich dich wieder?“
„Im Sommer. Du organisierst ihn wie immer für mich?“
„Martin.“ Sie küsst ihn und schaut noch einmal über die Barriere vom Zoll, schaut prüfend, streichelnd, ein klein wenig jedoch höher auf seine Stirn, da wo die Augenbrauen beginnen.
„Wie ihr Vater damals, als er uns zum Bahnhof gefahren“‚ fällt es – wie die Schuppen vom Haar – Sarodnick ein.
Martin hatte sich damals mit Petra im Hecksitz versteckt, brav, ängstlich: Der Vater führte vorn auf dem Bock. Ihre Finger berührten sich keusch, und der „Fahrer“ sagte den Weg über kein Wort, hatte die Hände, die durch lederne, kleinlöchrige Handschuhe mattfarben schimmerten, spielend auf das Lenkrad gelegt. Ordentlich hielt er das Wagenfenster geschlossen, wegen der Hitze draußen und auch der Haare schon wegen, die im Fahrtwinde ihre Fasson einbüßen könnten und selbst ihren pomadigen Glanz. Er blickte nicht in die Seite, und er fuhr sehr schnell durch die Stadt. „Hat er es eilig? Oder ist er nervös?“, überlegte Martin. Petra hatte ihm doch bestätigt, dass der Vater nicht dagegen war, dass sie verreiste mit ihm. – Der Handschuh fingerte an dem Spiegel, und der Blick des Vaters in ihm fiel auf den Jungen. Der stahl sich hinaus, wich diesem Blickfeld, drehte zum Fenster sich ab, kam zurück, zu Petra, knöpfte am Hemd. Der Blick aber spiegelte ihn. „Was begafft er mich wie einen Esel“, fragte er sich und wurde sesshaft, standhaft, heftete sein Auge ins andere Auge, ins Auge im Spiegel: „Na und?!“ – Der frierende Guck wurde weicher, vom „Lang-Sehen“ weich, streifend-streichelnd. Und abweit verschleierte er sich in den Brauen des Jungen. Wieder und wieder spiegelte Martin – eine Wand, eine Fläche, ein See. „Es kann mich sehen, wer will!“ – Plötzlich stieß sein Kinn hart gegen die Lehne des Vordersitzes auf. Er rieb es, schaute auf: Der Rückspiegel war ein Hochhinaus-Spiegel geworden, abgedreht in den siebenten Himmel, mit mattem Gesicht – ein Stückchen Plastik und Glas.
Der Vater chauffierte langsamer nun, bremste alsdann, streifte den rechten Handschuh vom Arm und reichte der Tochter die Hand: „Und keine Dummheiten, hörst du!“ Und er ließ sich die Wange küssen von ihr. Mit dem löchernden Handschuh aber klopfte er Sarodnick auf die Schulter: „Seien Sie vor-sichtig!“, mahnte er leicht, vorbeischauend am Haar. Er dehnte das „vor“, als würde er es verschluckt haben in irgendwelcher starken Erregung. –
Drei Wochen später wurde Petras Vater verhaftet. Er hatte in seinem Betrieb einen Lehrling verführt. Nach dem 12. Verhör verstarb er plötzlich. „Herzinfarkt“ war die offizielle Version. Obwohl er in seinem Leben schon ganz andere Verhöre erlebt und überlebt hatte. Das war damals nach Stalingrad, als er in die russische Kriegsgefangenschaft kam und als hoher Wehrmachtsoffizier so manches Märchen zu erzählen hatte. Die einfachen Landser dagegen wühlten inzwischen in der sibirischen Taiga im Morast, fällten ausgehungert bis zum Umfallen riesige Bäume und krepierten dabei wie das Ungeziefer in den löchrigen Decken und die Ratten in den winddurchlässigen schiefen Baracken. Die höheren Grade indes, hochgradig schuldig und mit viel Dreck an den Knochen, schliefen tatenlos ihren vierjährigen Totentanz auf weicheren Eisenmatratzen und aßen Doppelportionen vom Schwarzbrot, vom Magermilchbrei mit gelegentlich Fleischklößen dazu. Die dienten danach zum Aufwärmen, zum Reinbeißen, Reiben, Lecken und Striegeln der Offiziere, um kraftspendend an die Reserven, ans frische Fleisch der ehemaligen Kriegskameraden gehen, besser liegen zu können – bis zum Absprung und verbotenen Abspritzmanschetten. Die Rangordnung – die strammsten und wuchtigsten Mit-Glieder – bestimmte das Untergestelle dabei.
Petra hat darüber geschwiegen, auch vom Erfurter Gefängnis wollte sie nicht reden, von dem bezaubernden Lehrling mit dem Besenstil von seinem Meister im Griff seiner Faust. Das war alles ein Schandfleck für sie, ein Stoß in die falsche Richtung, ein Schiss in die Hose oder einfach nur ein Fauxpas, der letztlich nach hinten losging.