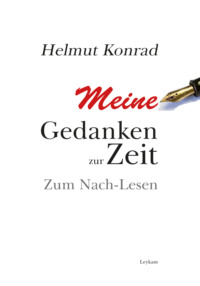Kitabı oku: «Meine Gedanken zur Zeit», sayfa 2
Gestohlene Erinnerungsstücke
Österreich gilt weltweit als ein sicherer Staat. Wir haben eine geringe Kriminalitätsrate und die relativ wenigen Verbrechen werden in einem hohen Maß aufgeklärt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt ist man bei uns im Regelfall nicht wirklich bedroht, durch kriminelle Aktionen Leben, Gesundheit oder Eigentum zu verlieren.
Auch ich musste über 60 Jahre alt werden, bis ich mit der schmerzlichen Erfahrung, Opfer eines kriminalistischen Aktes zu werden, konfrontiert wurde. Während meine Frau auf Kur und ich selbst im Kosovo war, um bei der Neugestaltung des Universitätssystems zu helfen, wurde in unser Haus eingebrochen. Dabei liegt unser kleines Reihenhaus in einer ruhigen Wohngegend, wo alle Nachbarn, wie in einem Dorf, einander gut kennen und auch wechselseitig auf die Häuser achten.
Die Einbrecher kamen über den Gartenzaun und hebelten die Terrassentür aus. Leider gab es reiche Beute. Der gesamte Schmuck meiner Frau ist weg, und da waren Erbstücke dabei und Geschenke, die ich ihr zur Geburt der Kinder, zu runden Geburtstagen oder zur Silberhochzeit gemacht habe. Für die Kinder haben schon meine Großeltern eine Münzensammlung begonnen, die nun verloren ist. Mich schmerzt vor allem aber, dass mir die Rektorskette, die Erinnerung an eine der prägenden Epochen meines Lebens, gestohlen wurde, und dazu noch der Ehrenring, den mir Bundespräsident Jonas 1973 anlässlich meiner Promotion unter den Auspicien des Präsidenten überreicht hatte und der den Start meiner wissenschaftlichen Laufbahn symbolisiert.
Die materielle Seite ist wohl von geringerem Interesse als die emotionale. So viele Erinnerungen hängen an den Stücken, die für Ereignisse oder Abschnitte des Lebens stehen. Mit der Entwendung hat man das Gefühl, ein Stück der eigenen Geschichte verloren zu haben. Jemand ist in unser Leben eingedrungen, in unsere Intimsphäre und in unsere Erinnerungen. Das schmerzt viel mehr als die Tatsache, dass der materielle Schaden nur zum Teil durch die Versicherung gedeckt ist. Für die Täter sind die meisten Stücke einfach Wertgegenstände, sie bedeuten nicht mehr. Allein die Vorstellung, dass irgendwer nun die Rektorskette trägt, der die Symbolik nicht kennen kann und will, das lässt mich in der Nacht schweißgebadet hochfahren. So ist das Gefühl der Sicherheit, das mich mein ganzes Leben begleitet hat, derzeit nicht vorhanden.
Aber die Geschichte hat auch ihre positiven Seiten. Da gab es mitten in der Nacht freundliche und kompetente Polizisten des Wachzimmers Andritz, die die materielle und emotionale Seite der Situation gut erfassten. Sie fanden die richtigen Worte und setzten die richtigen Schritte, gaben Unterstützung und vermittelten den Eindruck, die Sache auch zu ihrem Problem zu machen.
Und da gibt es die Nachbarn, die zur Stelle waren, mich am Abend ablenken und nicht allein im Haus sitzen lassen. Sie sind Ansprechpartner und gute Freunde, die wirklich aufmuntern können. Und dann ist da die Universität, die seit einem Jahrhundertviertel mein Bezugspunkt ist, und die ja auch geschädigt ist, ist der Stern an der Kette schließlich ihr Eigentum. Da gab es Zuspruch und sogar den Willen, auf Kosten des Hauses die Replik anfertigen zu lassen. So fühle ich mich eigentlich gut eingebettet, und die täglichen Telefonate mit meiner Frau tragen zur Stabilisierung der Situation bei.
All das zeigt, dass wir noch immer in einem sicheren Land leben. Verbrechen sind nicht Alltag, sondern Sondersituationen. So reagieren die Menschen auch – sie sind nicht abgestumpft durch die Alltäglichkeit von Kriminalität, wie dies in anderen Gegenden der Welt der Fall ist. Wenn man in Los Angeles oder irgendwo in einer Großstadt Europas überfallen wird, ist man weit einsamer als hier bei uns im friedlichen und sicheren Österreich.
Natürlich denke ich darüber nach, wie ich mich und meine Familie in Zukunft besser schützen kann. Eine stabilere Tür, vielleicht ein Bewegungsmelder, eventuell eine Kamera. Und ganz sicher eine Anpassung der Versicherungssumme. Aber ich möchte mir das Gefühl nicht nehmen lassen, dass man in der Regel von freundlichen und wohlmeinenden Menschen umgeben ist. Diese Menschen gehen wie ich davon aus, dass der Mensch nicht des Menschen Wolf ist, sondern dass ein gut organisiertes, friedliches und gewaltfreies Zusammenleben von Nutzen für alle ist. Wir haben im Prozess der Zivilisation die physische Gewalt an den Staat delegiert und lösen Probleme nicht mehr selbst durch den Einsatz von Fäusten oder Pistolen. In den Ritualen unseres Miteinander hat Gewalt keinen Platz, und das ist gut so. Der Staat kann Gewalt einsetzen, aber nur entlang genauer Regeln. Auch ein Polizist greift nicht einfach zur Waffe, sondern nur in definierten Situationen. Wir haben also gelernt, friedlich und innerhalb von Regeln miteinander umzugehen. Verbrecher brechen diese Regeln und bedrohen somit das Konzept des Miteinander. Aber wir dürfen nicht überreagieren, sondern wir sollten auf die von uns mitgetragenen und durch unsere Steuern finanzierten Sicherungssysteme vertrauen. Und mein Vertrauen in die Polizei, mit der ich bisher ja wenig zu tun hatte, wurde durch die geschilderten Ereignisse jedenfalls verstärkt. Dafür habe ich zu danken.
Sendung vom 1. März 2009
Muttertag
Seit einem knappen Jahrhundert wird in großen Teilen der Welt am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag gefeiert. Und heute ist es wieder einmal so weit. Kinder haben Gedichte gelernt, Geschenke gebastelt. Sie richten Frühstück oder sie führen, wenn sie schon größer sind, die Mütter heute in die sicherlich übervollen Gasthäuser der Umgebung.
In dem Jahrhundert, das die Zeitspanne der Muttertagsfeiern beschreibt, hat das Mutterbild entscheidende Wandlungen erfahren. War meine Mutter noch voll und ganz Hausfrau und Mutter, um sich den vier Kindern und deren Erziehung zu widmen, was neben der Führung eines Haushaltes, der anfangs weder Waschmaschine noch Kühlschrank kannte, genügend Last war, ist heute oft Mutterschaft anders definiert. Familienstrukturen sind nicht mehr zwangsläufig auf Dauer fixiert, jede zweite Ehe scheitert. Und meist ist es die Mutter, der dann als Alleinerzieherin die Verantwortung für die Kinder zufällt. Da müssen dann Beruf und Kindererziehung vereinbar sein, was ohne familiäres oder gesellschaftliches Netz oft wohl nur sehr schwer möglich ist. Väter sind schließlich großteils nicht da, wenn sie gebraucht werden.
Heute haben die Frauen viel selbstbestimmter als in früheren Jahrzehnten die Möglichkeit, sich für oder gegen die Mutterrolle zu entscheiden. Und selbst die Wahl der Lebensform – Ehe, Partnerschaft oder Singledasein – ist heute meist nicht mehr vom Schicksal oder Zufall aufgezwungen, sondern kann auch selbst eingeschlagener Weg, also die eigene Entscheidung, sein. Aber das ändert nichts daran, dass die Mutterrolle noch immer nicht nur die Gegenwart, sondern besonders auch die Zukunft prägt. Hier wird die nächste Generation geformt, hier werden kulturelle Muster eingeübt, Normen und Werte weitergegeben.
Das formt das ganze Leben. In mir ist meine vor 24 Jahren verstorbene Mutter voll gegenwärtig. Sie war der Mittelpunkt für uns. Früh verwitwet, war sie für meine Geschwister und mich und für die Enkelkinder da. Sie hat uns zusammengehalten, ihre kleine Wohnung im Gemeindebau war unser Fluchtpunkt. Und sie hat die so unterschiedlichen Entwicklungen ihrer Kinder, die verschiedenen Temperamente, die unterschiedlichen Überzeugungen und Lebenswürfe in Harmonie verknüpft. Vielleicht verklärt die Erinnerung, aber meine Mutter hat instinktiv immer gewusst, was richtig ist. Oft will ich sie heute noch etwas fragen oder sie teilhaben lassen an den Erfolgen oder den freudigen Ereignissen. Mein Bruder und ich waren die ,,Buben“, wie sie uns im Gespräch mit anderen auch dann noch bezeichnet hat, als wir längst mitten im Berufsleben standen.
Natürlich, heute haben Mütter auch andere Aufgaben, als nur Mütter zu sein. Sie müssen den Lebensunterhalt verdienen, müssen sich in einer Welt behaupten, die nicht immer Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse einer Frau, deren Lebensrhythmus auch von Bedürfnissen eines oder mehrerer Kinder geprägt ist. Der Weg zum Kindergarten oder zur Schule, zum Zahnarzt, zum Sport, zum Musikunterricht, all das muss organisiert werden. Und hat ein Kind noch spezielle Bedürfnisse durch eine Behinderung, eine Krankheit, eine Allergie, oder hat es Schwierigkeiten in der Pubertät, dann wird der Spagat zwischen der Mutterschaft und den Anforderungen von außen manchmal dramatisch.
Natürlich gibt es zumindest drei ansprechbare Hilfen: erstens den Vater des Kindes, der sich aber nur allzu oft aus der Verantwortung verabschiedet; dann die vorherige Generation, also Eltern, die bei der Betreuung helfen. Und dann gibt es die öffentliche Hand, die langsam lernt, dass nur ausreichende Betreuungseinrichtungen und materielle Sicherungen Beruf und Familie vereinbar machen. Und das ist ja ein großes politisches Ziel.
Mutterrollen haben sich vielfach im Lauf der Zeit gewandelt. Aber ein Kern ist geblieben: Stärker als die Väter sind die Mütter noch immer die wichtigsten Bezugspersonen für die meisten Menschen. Mütter trösten und trocknen die Tränen der Kleinsten, Mütter verteidigen ihre Kinder in den Konflikten von Schule und Alltag, Mütter sind für die Begleitung ins Erwachsenenleben mit all den Ecken und Kanten zuständig, Mütter sind als Großmütter die Stützen in der Bewältigung von Alltag und von Sondersituationen.
Dabei ist es zweitrangig, ob die Mutter in einer traditionellen Ehe lebt, ob sie eine ledige oder eine geschiedene Mutter ist. Sie kann wiederverheiratet sein oder in einer neuen Partnerschaft leben. Von der Patchwork-Familie bis zur gleichgeschlechtlichen Beziehung: eine Mutter ist immer auch und vor allem Mutter, der Schutz für ihre Kinder und die Ursache für Geborgenheit. Das gilt am Land und ebenso in der Stadt, in traditionellen Verhältnissen oder in postmodernen. Und obwohl ich selbst etwa eine partnerschaftliche Beziehung lebe und wir uns die Haushaltspflichten teilen, ist das Verhältnis unserer Kinder zu meiner Frau doch noch durch Elemente gekennzeichnet, die sich mir als Vater verschließen.
Heute aber sollten wohl alle den Tag nutzen, um ihren Müttern zu danken. Meine Generation kann das meist nur mehr im stillen Gedenken tun. Die etwas Jüngeren werden wohl ihre Mütter besuchen, ausführen, mit ihnen feiern. Und die ganz Kleinen sind wohl schon sehr aufgeregt, was denn Mama zum Gedicht, zum Blumenstrauß, zum Billett oder zum Frühstück sagen wird. Aber wir alle sollten nicht nur am heutigen Tag dankbar für das sein, was unsere Mütter für uns getan haben und tun. Ein wenig von dieser Dankbarkeit sollte auch das Jahr über spürbar sein.
Sendung vom 9. Mai 2010
Grundnahrungsmittel Brot
Obwohl unsere Gesellschaft viele arme Menschen kennt, und obwohl das Ausmaß der Armutsgefährdung erschreckend hoch ist, leben wir in einem der reichsten Länder der Welt. Österreich ist im Durchschnitt also Teil der Wohlstandsgesellschaft, wenn das auch nur ein ganz schwacher Trost für jene ist, die sich am unteren Ende der Skala befinden und die ohne fremde Hilfe ganz ernsthafte Probleme haben würden.
Wohlstandsgesellschaften sind Wegwerfgesellschaften. So war vorige Woche in der Kleinen Zeitung zu lesen, dass uns das Ende der Brot-Zeit ins Haus steht. Brot landet zu 20 Prozent im Müll, also einer von fünf Brotlaiben wird nicht gegessen, sondern entsorgt. Mich hat der Artikel ziemlich nachdenklich gemacht. Meine Generation ist überwiegend mit der von den Eltern vermittelten Überzeugung groß geworden, dass man keine Lebensmittel und vor allem kein Brot wegwirft. Wir verarbeiten heute noch altes Weißbrot zu Knödelbrot oder Brösel und heben altes Schwarzbrot für die Pferde einer Freundin auf. Im Müll landet Brot nur dann, wenn es schimmlig geworden ist, was aber selten vorkommt.
Stärker als die meisten anderen Nahrungsmittel ist Brot symbolisch aufgeladenes Kulturgut. Es spielt seine Rolle im religiösen Ritus, und die wundersame Brotvermehrung ist eine der schönen biblisch überlieferten Legenden. Brot hat zudem starke regionale Zuschreibungen. Wer in Amerika gelebt hat, der weiß, dass man nichts vom alten Kontinent so vermisst wie gutes Brot. Und schon in Wien ist es nicht einfach, ein Brot zu finden, das den Vorstellungen des Auges, der Nase, des Gaumens und manchmal auch des Ohres, wenn es so schön knacken soll, entspricht. Und in der Erinnerung an die Kindheit und Jugend spielt Brot eine größere Rolle als alle Fleischspeisen oder Geburtstagstorten.
Wenn im oberen Lavanttal die Tante auf ihrem kleinen Bauernhof die Laibe aus dem Holzofen holte, war die ganze Umgebung von einem Duft erfüllt, der unbeschreiblich gut war. Noch lange Jahre fuhren wir dort hin, um einen Laib mitnehmen zu können in die großen Städte. Damit war ein Stück von zu Hause bei uns, wurde guten Freunden angeboten, um sie teilhaben zu lassen an der kulinarischen Erinnerung. Mich treibt es zumindest jeden zweiten Samstag auf den Markt am Kaiser-Josef-Platz, wo es Brot zu kaufen gibt, das dieser Erinnerung an alte Zeiten zumindest nahe kommt. Und das wird aufgegessen, es hält auch locker zehn Tage, ohne an Qualität zu verlieren. Und es steht so für mich symbolisch für die ganze Angebotspalette an naturnahen Produkten, die der Markt bietet. Wir essen nur Eier, die wir dort kaufen, das Gemüse der Saison, die prächtigen Hühner und die Beeren, die Früchte und die Pilze. All das wird regional produziert, geerntet und in der Region verkauft. Die Fische kommen aus der Weizbachklamm, die Äpfel aus Eggersdorf, das Brot aus Hitzendorf und das Gemüse aus Hausmannstätten.
Und da schreckt die Nachricht auf, dass wegen der großen Brände in Russland auch bei uns das Brot teurer werden soll. Das wird wieder die Armen besonders treffen. Sicher, es gibt den Weltmarkt, und die Getreidebörsen waren schon historisch Orte der sozialen Konflikte, an denen sich, wie früher vor den Getreidespeichern der Wucherer, die Wut der Hungernden entladen konnte. Und es ist auch verständlich, dass bei allen regionalen Bemühungen manche Rohstoffe nur am Weltmarkt zu erhalten sind. Die Versuche, diesen durch soziale Projekte und spannende Initiativen zu unterlaufen, sehen sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert. So droht gerade ein Vorzeigeprojekt, nämlich Kakaobohnen fair zu produzieren und in Lateinamerika Kleinbauern zu helfen, von der Kokainmafia loszukommen und ein gesundes Produkt wie Kakao selbstbestimmt zu erzeugen, an der Gewalt vor Ort zu scheitern. Da ist viel Geld im Spiel und natürlich auch einfach sehr viel Spekulation. Der Weltmarkt ist ja nicht nur ein realer Ort des Austausches von Waren oder Dienstleistungen gegen Geld, er ist Ort von fiktiven Geschäften, künstlich erzeugten Verknappungen, von Umtrieben im Graubereich von Seriosität und Moral. Der Wächter mit dem Schwert vor den Getreidelagern im alten China, der Schieber der Dreißigerjahre, der den Schwarzmarkt bediente, haben längst den anonymen Anzugträgern Platz gemacht, die mit Produkten handeln, die sie nie gesehen haben.
Die Globalisierung ist Realität und das ist auch der Weltmarkt. Aber wir sind nicht gezwungen, uns all den Regeln, die er vorgibt, zu unterwerfen. In vielen Punkten unseres Konsumverhaltens sollten wir einfach regionaler agieren. Man muss nicht das ganze Jahr Paradeiser essen. Aber jetzt wachsen sie in meinen eigenen Töpfen und die Bauern am Markt haben Steigen voller prächtiger Früchte. Man kann die heimischen Erdäpfel im Frühjahr abwarten und der Salat ist bei uns ohnehin besser als überall sonst und nicht vergleichbar mit den in Plastik eingeschlossenen Importwaren. Regionale Lebensmittel zu kaufen ist meist gesünder, ökologisch sinnvoller und nicht teurer, als hier auf das globale Angebot zu setzen. Die Glitzerwelt eines amerikanischen Supermarktes mit Lebensmittelabteilungen, die oft die Gesamtgrößen unserer größten Einkaufsmärkte übertreffen, gaukeln 24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr die Verfügbarkeit aller Produkte vor. Die Ökobilanz ist dann vernichtend, und der Geschmack ist großteils beim Transport entwichen.
Regional zu handeln ist kein Gegensatz zum globalen Denken. Man kann die Weltzusammenhänge sehen, man kann die Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten nutzen und trotzdem nicht nur aus sentimentaler Erinnerung an die eigene Jugend, sondern aus durchdachter Entscheidung regional agieren. Ich freue mich jedenfalls über die wenigen Produkte im eigenen Garten und über die erfreuliche Vielfalt, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und ich genieße es, den Jahreszeiten entsprechend die Bandbreite unseres Landes auch auf meinem Teller zu finden.
Sendung vom 29. August 2010
Miteinander leben
Als ich mit meiner Familie vor fast 28 Jahren nach Graz übersiedelt bin, um hier an der Universität zu arbeiten, hatten meine Frau und ich recht klare Vorstellungen von einer optimalen Wohnumgebung. Grün sollte vorhanden sein, die Stadt aber gut erreichbar. Luftqualität, Verkehrsberuhigung und Schulen waren wichtige Entscheidungskriterien.
So landeten wir im Jänner 1985 in einer kleinen Reihenhaussiedlung am nördlichen Stadtrand, ohne jeden Durchzugsverkehr und mit einem riesigen Spielplatz direkt neben den Häusern. Die 28 Häuser waren rasch alle bezogen, fast durchgängig von Jungfamilien wie uns. Und weil die Wohnqualität hoch und das Nachbarschaftsklima gut war, zog auch fast niemand weg, sodass bis heute zumindest drei Viertel zu den Erstbewohnern zu zählen sind.
Aber wir alle sind über ein Vierteljahrhundert älter. Die vielen Kinder, die in den achtziger Jahren die Siedlung belebten, sind ausgezogen, zurück blieben wir, entweder Menschen im Ruhestand oder knapp davor. In ein paar Häuser sind aber Jungfamilien gezogen, die genau das schätzen, was wir so genossen haben: dass die Kinder den Spielplatz haben, dass die Privatstraße eine sichere Erweiterung des eigenen Gartens ist und dass die Kinder daher in einer gesunden und wenig bedrohlichen Umgebung aufwachsen können. Nur: drei Viertel der Bewohner sind 60 und älter und viele sind Kinder nicht mehr gewohnt. Ein ganz seltsamer Generationenkonflikt bahnte sich an: Die Kinder sind zu laut, ihre Dreiräder hindern die Bewohner am Zufahren und vieles mehr. Kurzum: die jungen Familien werden als Kontrapunkt zur eigenen Lebenssituation, zum Rückzug in den gepflegten kleinen Garten empfunden.
Mich stimmt das traurig, denn ich kann dem gemeinschaftlichen Weg in eine Alterswohnsiedlung wenig abgewinnen. Ich mag die Kinder. Klar, oft kann man kaum im Garten lesen, wenn nebenan alle herumtollen, aber ohne unsere drei entzückenden Kinder von nebenan wäre auch unser Garten viel weniger von Zukunftshoffnung und von positiven Gefühlen erfüllt. Jeder Ball, der über den Zaun fliegt, jedes begeisterte Kommentieren der Kletterkünste unserer Katzen aus Kindermund bringt Leben und Freude in unseren Alltag.
Überall in der Welt spricht man davon, dass man Wohnsituationen ethnisch, sozial und altersmäßig durchmischen sollte, um Spannungen abzubauen, Integration zu erleichtern und Toleranz zu lernen. Aber die Realität ist meist eine andere. So auch bei uns: innerhalb weniger Monate zog eine bestimmte Alterskohorte und ein bestimmtes soziales Segment, nämlich der gehobene Mittelstand, in die Siedlung ein und es gab wenig Antrieb, von hier wieder wegzuziehen. Städte wachsen nicht kontinuierlich, sondern schubweise. Wenn etwa auf den Reininghausgründen in Graz ein neuer Stadtteil entstehen sollte, wird dieser zweifellos jüngere Bewohner haben als die übrige Stadt und in drei Jahrzehnten schließlich überaltern. Und schon jetzt kann man die potenziellen Generationenkonflikte am Horizont erkennen.
Ist es zwischen den Generationen schon schwierig genug, so potenziert sich das noch mit ethnischen und sozialen Fragen. Wenn in eine günstige Wohngegend plötzlich größere Gruppen von armen Migrantenfamilien ziehen, wenn Stadtteile sich nicht nur im langsamen Altern ändern, sondern plötzlich mehr als nur laute Kinder neu sind, sondern wenn auch andere Sprachen gesprochen, andere Gerichte gekocht werden. Durchmischung ist nicht immer die Zauberformel.
In den USA und in Kanada kann man sehen, dass Zuwanderer auch in den großen Städten eigene Subeinheiten besetzen: Chinatown, Little Italy kennt man über das Kino oder über touristische Erfahrung, aber auch die Polen, die Burgenländer, die Bayern bilden kleine Inseln mit einer vertrauten Sprache und vertrauten Regeln in den fremden Großstädten. Es dauert zwei bis drei Generationen, bis man wirklich ungeniert hinaustreten kann und Teil der neuen Gemeinschaft geworden ist. Eine zu rasche, vielleicht sogar erzwungene Durchmischung fördert nur Ängste auf der einen, Vorurteile auf der anderen Seite. Behutsamkeit, Neugier, administrative Hilfe und vor allem schulische Kontakte helfen hingegen.
Unsere Kinder waren in den USA etwa in Programmen, die Kinder aus aller Herren Länder Englisch als Zweitsprache vermittelten. Das waren spannende Integrationsschritte und auch Begegnungen zum Abbau von Barrieren. Deutsch als Zweitsprache, ein Hinführen zur Kultur unseres Landes, das könnte auch bei uns helfen und tut es, wo es angeboten wird, ja auch tatsächlich.
Klar – Zusammenleben in unterschiedlichen Sprachen, Religionen, sozialen Situationen, Generationen, Normen und Gewohnheiten ist schwer zu organisieren und in der Tendenz konfliktträchtig. Der eingangs geschilderte kleine Generationenkonflikt in unserer Wohnsiedlung ist angesichts der mancherorts sichtbaren echten Konfliktlagen wohl ein Luxusproblem, das sich mit etwas gutem Willen ganz leicht lösen lassen sollte. Rücksichtnahme und ein wenig Toleranz reichen aus, um die letzten Meter zum eigenen Haus im Schritttempo zu fahren oder aber Kinderstimmen als Bereicherung zu hören. Aber auch die Kinder sollen lernen, mit den Älteren umzugehen.
Neben- und miteinander zu leben bedeutet, Kompromisse zu finden und nicht nur die eigenen Regeln gelten zu lassen, sondern auch Lösungen zu suchen, die für alle Betroffenen nicht nur akzeptabel, sondern auch einsichtig sind. Da bedarf es professioneller Hilfe, da müssen Personen im Einsatz sein, die Mediation, also das Ausgleichen, gelernt haben. Aber vor allem müssen wohl alle Betroffenen einsehen, dass niemand 100 Prozent seiner Vorstellungen durchbringen sollte, denn das bedeutet Gewalt. Und in den großen Metropolen der Welt kann man die Lehrbeispiele beobachten, wie ein verkorkstes Miteinander sich eruptiv und blutig entladen kann. Vorbeugen ist bei uns jedenfalls besser und klüger, als heilen zu müssen.
Sendung vom 28. August 2011