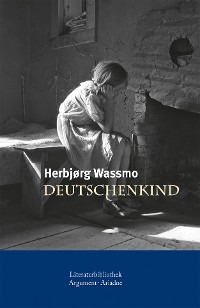Kitabı oku: «Deutschenkind», sayfa 2
Sie zeigten ihre Angst vor der Dunkelheit nicht so offen, die Kerle.
An dem Tag, als Einar in die Dachstube über der Veranda gezogen war, hatte er kritisch nacheinander beide Klotüren geöffnet. Und nachdem er festgestellt hatte, dass das Frauenklo gemütlicher und einladender war, ging er dort hinein und verriegelte vorsichtshalber die Tür. Das war ein großer Fehler, den Einar da im Tausendheim machte. Er wurde ihm nie richtig verziehen.
Als er wieder auf die Klotreppe hinaustrat, ohne sich die Hose anständig zugeknöpft zu haben, waren bereits drei Fenster zum Hof hin aufgerissen worden.
Drei Frauengesichter kamen zum Vorschein. Das eine erboster als das andere. Elisif war die Erste gewesen. Sie hielt die Strickjacke mit festem Griff über der üppigen Brust zusammen und öffnete den Mund zu einem spitzen Trichter. Ihr weißes Gebiss funkelte bedrohlich, und die Worte kamen wie Peitschenhiebe an diesem lichtblauen Tag.
»Was machste aufm Frauenklo, wenn ich fragen darf?«
Einar stand halb abgewendet auf der schiefen Holztreppe, die rechte Hand am Hosenlatz und die linke am Türhaken. Sein Unterkiefer klappte einen Augenblick herunter, als er den Kopf drehte und die drei Frauenköpfe an der unsauberen Hauswand entdeckte. Drei unversöhnliche, weiß gemeißelte Gesichter vor dem gespenstisch grauen Hintergrund.
Einar schluckte. Dann fasste er sich, zog blitzschnell die rechte Hand aus dem Hosenlatz und versteckte sie hinter dem Rücken. Er wagte nicht einmal, sie in die Tasche zu stecken, so verdutzt war er über diese enorme Kuckucksuhr von Haus, wo gleichzeitig drei Köpfe mit weit aufgerissenen Schnäbeln draußen waren und schrien. Einar schluckte noch einmal, bevor ihn der Zorn wie ein stechender Frostschmerz überfiel und er schwer atmend und mit rauer Stimme rief: »Was zum Teufel krähste da oben? Darf man hier nicht mal mehr scheißen?«
»Du warst aufm Frauenklo! Ich hab dich gesehn!« Elisif kannte keine Gnade. Eine strafende Donnerstimme in hoher Tonlage.
Aber Einar hatte sein Selbstvertrauen wiedergewonnen. »Ist da ein Unterschied zwischen Männer- und Frauenklo? So fein wie hier in Stranda war’s nicht mal beim Pastor, wo ich herkomm. Dem Pastor seine hatte keinen so piekfeinen Arsch, dass sie ein Klo für sich haben musste wie die Weiber hier im Tausendheim.« Und ohne sich weiter um Elisifs Gekeife zu kümmern, schritt er über den Hof und betrat den mittleren Eingang. Er schloss die Verandatür mit einem Knall und stapfte wütend die alte Holztreppe hinauf, so dass die Messingbeschläge ganz außen an jeder Stufe leicht zitterten.
Kurz darauf saß Einar auf seinem Sofa und blinzelte unfreundlich die Wand an. Der Teufel sollte die Weiber holen. Er wollte sich selbst nicht eingestehen, dass er immer noch Herzklopfen hatte.
Er benutzt das Frauenklo nie mehr. Trotzdem guckt er jedes Mal böse auf Elisifs Fenster, wenn er über den Hof geht, um seine Notdurft zu verrichten. Und wenn er irgendwo im Haus ihre hohe, dünne Stimme hört, bekommt er ab und zu ein ganz unangebrachtes Herzklopfen, dessen er nicht Herr wird. Das macht ihn rasend. Denn Einar ist ein Mensch, der in jeder Beziehung allein im Leben zurechtkommt. Er fürchtet weder Pastor noch Weiber.
4
Das Tausendheim! Der große Holzbau aus der Zeit der Jahrhundertwende zeigte Reste aus stolzer Vorzeit und Spuren menschlicher Dummheit.
Man konnte beides deutlich an den alten, verwitterten Dachvorsprüngen sehen. Von dem mit Steinen beschwerten Dach mit Moos und Möwendreck bis zu den dicken Grundmauern aus handbehauenen Steinen und bis zu einem Meter tief in die Erde hinein roch es nach einem Fischereibesitzer alten Stils und nach Großkapital. Das Haus hatte drei Etagen und einen Keller und eine Menge hohe, zugige Fenster.
Das Gartenhaus war eine vermooste Fallgrube geworden, in die Elisifs Fünfter eines Sommers hineinfiel und sich den Fuß brach. Aber an klaren, kalten Tagen lag der Rauch noch wie in alten Zeiten über dem geflickten Dach und kam aus drei Schornsteinen gleichzeitig. So flößte das Haus noch immer Respekt ein.
Aber Großverdiener gab es keine mehr. Sie waren bereits in den schwierigen dreißiger Jahren verschwunden. Und danach wurde das Haus dem Verfall und den Wunden überlassen, die das gemeine Volk ihm zufügte.
Denn in das Tausendheim kamen die Armen. Die, welche schwer zu tragen hatten und arm waren an irdischen Gütern. Und einige waren auch arm an Geist.
Sie drängten sich um die drei Treppenaufgänge zusammen, und manchmal brauchte man sie noch, wenn im Ort eine Lücke entstanden war. Ob das nun an den Kais war, bei den Hausbesitzern oder unter den verschmutzten Zimmerdecken bei anständigen Leuten zum Hausputz.
Die Leute im Tausendheim dachten nicht daran, dass sie das Erdenreich wegen ihrer Sanftmütigkeit besitzen sollten. Daran dachten sie am allerwenigsten.
Aber wenn im Spätherbst der Mond über Veten und Hesthammeren stand und die Mütter ihre Ältesten beauftragt hatten, die kärglichen Kartoffeln vom Gemeinschaftsacker zu ernten, mit dem jährlichen Streit, wo Elisifs Grenzen aufhörten und Arnas und Peders Grenzen begannen, beruhigten sie sich auf ihre Weise unter den Lampen. Wenn sie jung waren, lungerten sie in Været herum, und wenn sie noch jünger waren, spielten sie in dem dunklen Keller Verstecken.
Der Mond streute sein prächtiges Silber über den alten Drachenkopf am Südfirst (am Nordfirst war er bereits vor dem Krieg heruntergefallen), und die Gemüter im Tausendheim erhoben sich über ihre eigene graue Sanftmut.
Wenn die Sonne endlich wiederkehrte und auf das schneebedeckte alte Dach schien, kamen die Männer mit Kabeljau und Rogen heim. Die Mandelkartoffeln wurden aus dem Keller geholt, und der schwere, friedliche Dunst von gekochter Leber durchzog das Haus.
Da riefen sie sich durch die offenen Fenster zu, dass die dunkle Zeit vorbei sei, und die Frauen halfen einander mit den Schubkarren bis zur Flussmündung, wo sie die wintergelben Laken zum Bleichen auf den Felsen und den alten Schneewehen ausbreiteten.
Die Poesie lag in den Details. In den segensreichen Tropfen aus der abgebrochenen Dachrinne zum Beispiel. Aber sie war scheu, und sie wurde kaum beachtet, wie ein armes Kind, das keine stillen und dem niemand Liebe geben will.
Das Magische daran, überhaupt am Leben zu sein, ging einem armen Teufel selten auf. Das begriff er höchstens bei Sturm und Schiffbruch.
Es konnte passieren.
In der Dachstube über der Veranda im Tausendheim wohnte viele Jahre eine alte Witwe. Sie strickte für die Kinder im Haus und verprügelte sie der Reihe nach, wenn sie Unfug trieben. Sie warf Steine auf streunende Hunde und putzte die Treppen, ob sie dran war oder nicht. Da hatten die im mittleren Treppenhaus Glück. Aber dann fing sie an, die Küchentücher im Nachttopf zu waschen, und vergaß sich selbst und die Treppe. Schließlich musste sie ins Altersheim nach Breiland gebracht werden. Da war sie genau einen Tag und eine Nacht. Dann war es aus mit ihr.
So wurde die Dachstube frei für Einar, der von dem neuen Pastor vom Pfarrhof gejagt wurde, weil er die Eier unter den Hühnern und den Speck aus dem Vorratsspeicher stahl. Die Dachkammer befand sich oberhalb der alten Glasveranda. Da war übrigens nicht mehr viel Glas. Der Südwestwind hatte gewütet und die kleinen Glasscheiben eine nach der anderen zerbrochen. Die Männer hatten an der Südwestseite Holzteile und Platten davorgenagelt, um Wind und Wetter abzuhalten.
Wenn die Außenlampe eingeschaltet war und in dem schaumgekrönten, jähzornigen Meer glitzerte, sah die ganze Glasveranda wie ein blindes Auge aus. Nur zwei kleine Scheiben hatten überlebt. Sie schielten trotzig und verwundert in den Himmel.
Die Dachstube war ziemlich fußkalt.
Dagegen zog es kaum durch das Fenster. Das kleine Dachfenster ließ nämlich nicht den Wind durch, sondern weinte. Es tropfte und rann, wenn Schnee und Regen das Fenster blind machten.
Einar hatte schnell denselben Trick entdeckt, den auch die Kalla-Witwe angewandt hatte. Er stellte eine Waschschüssel darunter. Auf dem Boden unter dem Fenster war ein verschwommener, rostiger Kreis von der Witwenschüssel. Einar begriff den Sinn dieses Kreises sofort und setzte beim ersten Unwetter seine Schüssel dorthin. Durch das segensreiche Guckloch im Dach schaute Gottes uralter und launischer Himmel herein – falls das Wetter es zuließ. Man brauchte keine Vorhänge gegen neugierige Blicke, und es gab kein Fensterbrett für Topfpflanzen. Das war Einar nur recht.
Tobias A. Brinch und Waldemar E. Brinch hatten einstmals jedes Lebewesen und jede Bewegung auf Øya besessen. Sie steuerten aus der Ferne jedes Fischerboot südlich von Vagen und steuerten den Überschuss in die eigene Tasche.
Von zwei Herrschaftshäusern mit Dienstboten, Gesellschaften und Festlichkeiten aller Art gingen die Befehle über Leben oder Verhungern in fernen Zeiten aus. Der Pfarrhof war der dritte Machtfaktor, und der konnte wohl mithalten, auch wenn hier nicht von Kronen und Öre die Rede war.
Gegen Ende der dreißiger Jahre geschah das Unbegreifliche: Die Dorfbesitzer Brinch gingen in Konkurs. Die Kais, der Laden, der Grund und Boden, alles war beliehen und gepfändet. Schlechte Zeiten und Spekulation, sagten die, die mit so etwas Bescheid wussten.
Das Haupthaus war das größere und gehörte dem älteren der beiden Brüder, Herrn T. A. Brinch. Mit seinen geschnitzten Dachfirsten und der Glasveranda bot es unten in Stranda einen prächtigen Anblick. Zuerst war ein Herr aus Bergen gekommen und hatte einen Winter und einen Sommer lang die Konkursmasse verwaltet. Er wurde von einer Firma in Bergen bezahlt, um die Räder in Gang zu halten, aber es schien dem wohlhabenden Mann und Junggesellen da oben unter dem Nordlicht und bei Möwengeschrei allmählich zu einsam zu werden. Jedenfalls verschwand er an einem schönen Frühlingstag und ward nie mehr gesehen.
Jetzt beherbergte das Hauptgebäude so viel Menschengewürm und Dreck, dass es wohl zu Recht Tausendheim hieß.
Weiter oben am Hang stand der »Hof«, etwas kleiner zwar im Umfang als das Tausendheim, aber höher angesehen, nachdem die Fassade zweimal weiß angestrichen worden war. Er diente als Schule und wurde beheizt und instand gehalten von dem alten Almar aus Hestvika.
Während des Krieges entdeckten die Deutschen den Hof. Die zerbrochenen Tür- und Fensterangeln wurden in Ordnung gebracht, und die verblichene Seidentapete wurde übermalt. Derbes Gelächter und Gegröle erscholl unter dem Dachgebälk, und es setzte sich ein unausrottbarer Geruch nach Leder und Uniformjacken in den Räumen fest.
Es verging ein Friedensjahr, bis man es für moralisch vertretbar hielt, unschuldige Kinder in dieses Haus hinaufzuschicken, aber die Leute vermehrten sich wie verrückt, und das alte Schulhaus unten auf der Landspitze wurde zu klein. So kamen die Kinder und Almar und nahmen den Hof in Besitz. Aber für die alten Leute mit großem Respekt vor den Mächtigen früherer Zeiten war es ein schlimmes Zeichen, dass der Hof von Hand zu Hand ging. Und sie nahmen in Verbindung mit dem Hof auch niemals das Wort »Schule« in den Mund, ebenso wenig wie sie »Kaserne« oder »Deutschenlager« gesagt hatten.
Aber Almar war nicht von der Nostalgie ergriffen. Endlich hatte er einen sicheren Lebensunterhalt. Kinder produzierten die Leute bereitwillig drauflos, und geheizt werden musste, wenn die Rasselbande sich im Winter nicht zu Tode frieren sollte.
In den wunderbaren Sommermonaten hatte er dann seine Ruhe draußen im Fjord und konnte fischen.
Während der Schulmonate heizte Almar den meterhohen Ofen, leerte die Aborte und sammelte Abfall auf.
In dem großen, zugigen Klassenzimmer im zweiten Stock stand ein wackliger schwarzer Ofen und grübelte über die wahre Größe der guten alten Zeit.
Am Fußboden zog es vom Meer her, und in Gesichtshöhe schlug ihnen die Hitze entgegen wie glühendes Eisen. Den Kindern lief die Nase, wenn sie in der Nähe des Ofens saßen, und der Kopf schwitzte, aber die an der Tür froren am ganzen Körper. Öfen hätten keinen Verstand, deshalb könnten sie nicht nach unten wärmen, sagte Almar, wenn die Kinder sich, selten genug, beklagten. So tauten sie die Füße in den Schultaschen auf. Tora hatte ihren Platz direkt vor dem Katheder. Fräulein Helmersen hatte große Filzpantoffeln an und saß da oben wie eine rosa oder gelbe Blume über dem lackierten Tisch. Fräulein Helmersen hieß Gunn und war sehr jung. Jünger als einige von den Eltern. Sie hatte Grübchen und viele große weiße Zähne. Die sahen ganz echt aus.
Gunn war schön, fand Tora. Schöner auch als die Mutter, weil sie fröhlicher war.
Das Haar war blond und gelockt, wie bei dem Engel auf dem großen Glanzbild, das Tora eingerahmt über dem Bett hängen hatte. Die Kinder nannten Fräulein Helmersen Gunn und bekamen einen ganz sanften Blick, wenn sie von ihr sprachen. Bei vielen Vätern war das auch so.
Sie war fertig ausgebildete Lehrerin, obwohl sie noch so jung war. Man schuldete ihr großen Dank dafür, dass sie aus dem milden Süden und von frommen Eltern hier herauf nach Øya gekommen war, ans Meer, zu Kälte und Dunkelheit.
Elisif hielt es für eine göttliche Fügung, dass sie Gunn noch ein zweites Jahr behalten durften.
Die Kinder suchten einen Vorwand, um auch am Nachmittag hinauf zum Hof zu gehen, sie stellten neugierige Fragen und brachten Kabeljauzungen und selbstgebackenes Brot mit. Tora sah Gunn vor sich, wenn sie abends allein in ihrer Kammer lag und nicht schlafen konnte.
Sie sah sie immer mit großem, offenem Mund und mit tiefen Grübchen in den Backen. Es war so, als ob jemand den Zeigefinger in ihre Backen gedrückt hätte und die Druckstellen nie mehr verschwunden wären.
Tora träumte, dass sie Gunn war. Sie löste manchmal die Zöpfe und kämmte sich die Haare nach oben, damit es so aussah wie bei Gunn. Aber ihr Haar hatte eine ganz andere Farbe, und sie hatte einen ganz anderen Kopf. Sie kletterte auf einen Stuhl und betrachtete ihr Spiegelbild über dem Ausguss.
Es half nichts, soviel sie auch bürstete und sosehr sie auch lächelte. Toras Gesicht war und blieb schmal und grau mit dünnen Lippen und einer allzu großen Nase. Diese Nase war übersät mit Sommersprossen. Die Haare waren dicht und widerspenstig und gänzlich ohne Locken. Sie umrahmten das kleine Gesicht wie die Borsten einen abgenutzten Besen.
Sie war Tora. Da war nichts dran zu ändern. Elisif hatte ihr mehr als einmal gesagt, dass sie nicht verstehen könne, dass eine so schöne und gut gebaute Frau wie Ingrid sie bekommen habe. Es müsse das fremde Blut sein und der Sünde Sold, die das bewirkt hätten.
Tora verstand allmählich, was sie meinte, und wurde rot bis zu den Ohrläppchen.
Das fremde Blut war das Schlimmste, das gehörte zum Krieg, von dem die Mutter niemals sprach. Das mit der Sünde Sold nahm Tora nicht so schwer. Da konnte man schummeln, das hatte sie gesehen. Aber wenn auch der Spiegel über dem Ausguss Tora erzählte, wer sie war, so lebte sie doch ihr eigenes geheimes Leben unter dem Federbett in ihrer Kammer. In der Dunkelheit und allein mit sich war sie die, die sie sein wollte. Da streifte sie unter dem kleingeblümten Bettbezug ihre Haut ab, wärmte sich mit ihren eigenen kalten Händen, liebkoste sich selbst, während sie eine andere Tora heraufbeschwor. Wenn sie allein zu Hause war, konnte sie die eigentliche Tora vollständig vergessen.
Für eine Weile konnte alles, was am Tag an ihr nagte, verschwinden, als ob es nie da gewesen wäre. Die Gefahr? Die verschwand auch.
Sie war lieb zu ihrem eigenen mageren Körper, bis er glühte und zitterte und die Füße warm wurden. Sie war frei von allen Stimmen und Augen und bestimmte selbst, wer sie sein wollte. Sie wusste, dass sie »so etwas« mit sich eigentlich nicht machen durfte. Aber wenn sie es tat, ohne sonderlich viel dabei zu denken, dann konnte es wohl nicht so gefährlich sein.
5
Seit dem Tag, als Ole ihr erzählt hatte, dass sie aus der Fotze ihrer Mutter herausgekommen sei, musste Tora sich beinahe erbrechen, wenn sie daran dachte, dass die Leute so etwas machten … Dass die Mutter und Henrik … Oder der Pastor! Der Pastor hatte vier Kinder!
Und Elisif, die so fromm war, ließ sich von Torstein hereinlegen, so dass jedes Jahr ein neues kam.
Da war es besser, es selbst zu machen und die Gefahr zu vergessen. Trotzdem konnte sie lange im Dunkeln in der Kammer liegen und darüber nachgrübeln, wie sie es eigentlich machten, was Ole da erzählte.
Sie war einmal mit Jørgen und einigen anderen Kindern hinter dem Hügel gewesen, und sie hatten die Pferde beobachtet, die dort weideten.
Der Hengst vom Pastor wurde ganz wild und kam in den Pferch, um eine Stute zu besteigen. Tora konnte nicht verstehen, dass ein Hengst vom Pastor sich nicht besser benahm. Aber gleichzeitig wurde sie von dem seltsamen Wunsch ergriffen, zuzusehen. Der Hengst zeigte sein großes Glied, und Tora spürte die Gefahr und gleichzeitig eine quälende Neugier.
Die Pferde jagten eine Weile an der Einzäunung entlang, und als Tora merkte, dass es ernst war, tat sie so, als ob sie die Augen im Ärmel versteckte. Aber sie hätte sich die Mühe sparen können. Niemand hatte Zeit, auf sie zu achten. Alle standen mit offenem Mund und feuchten Augen da und starrten auf den Pferdepimmel. Als der Hengst ihn in der falben Stute verschwinden ließ und wieherte und schnaubte, konnte sie deutlich sehen, dass Elisifs Jørgen gleichsam in den Knien zusammensackte und Ritas Zungenspitze im einen Mundwinkel erschien.
Blitzartig wusste Tora, dass sie alle hier am Zaun auf den Hengst starrten, wie er bei der Stute pumpte, und dass alle das seltsame heimliche Ziehen im Unterleib verspürten wie sie selbst. Sie erlebten etwas gemeinsam, ohne dass sie es wagten, einander anzusehen. Tora versuchte sich vorzustellen, wie es wohl wäre, gerade jetzt die Stute zu sein. Erst hatte sie gezittert. Dann stand sie nur da. War gleichsam gar nicht beteiligt. Vielleicht schämte sie sich? Das musste es sein!
Sie mochte es wohl nicht, dass die Kinder zusahen. Es musste auch schrecklich wehtun, bei dem großen Pimmel.
Nein, so sah es nicht aus. Dann hätte die Stute nicht stillgestanden. Es liefen warme und kalte Schauer durch Tora hindurch. Es war wie so lange und so schnell zu laufen, dass sie Blutgeschmack im Mund hatte, wie an dunklen Herbstabenden Versteck zu spielen. Ja, das hier war beinahe aufregender, als auf den Eisschollen in der Bucht zu segeln.
Schließlich knickte der Hengst über der Stute zusammen und schnaubte. Er schleuderte den Kopf in die Höhe, dass die Mähne nur so flog.
Dann glitt er ermattet von der Stute herunter und zog auch den Pimmel mit. Das ging Tora zu schnell. Erst hatte sie geglaubt, dass alles schön sei. Der Hengst, der den großen braunen Kopf hochwarf, und die Mähne, die im Wind flatterte.
Nun schien der Hengst nicht mehr viel zu taugen. Der Pimmel schlenkerte schlaff von einer Seite zur anderen und schrumpfte vor den Augen der Kinder ein. Er tropfte ein wenig.
Rita glotzte noch eine ganze Weile, nachdem alles vorüber war, dann brach es aus ihr heraus: »Das Schwein! Hat in die Stute gepinkelt!«
Jørgen sah sie verächtlich an, spuckte aus und schleuderte ihr ins Gesicht: »Das ist Samen, kapierste, du doofe Nuss!«, und spuckte noch einmal.
Und dann hielt er einen kurzen Vortrag über allerlei Dinge. Und Ole mischte sich ein und sagte, dass sie alle aus der Fotze ihrer Mutter gekommen seien und dass man sich deswegen nicht zu schämen brauche.
Sie sprachen übrigens mit keinem Erwachsenen über dieses Ereignis. Und sie fragten niemals danach, was sie so gerne wissen wollten. Aber gelegentlich saßen sie auf der Kirchhofsmauer und stritten sich, was sie denn nun wirklich damals auf der Weide aus so kurzer Entfernung gesehen hatten.
Jørgen wollte den Pimmel des Hengstes immer noch größer machen, als er eigentlich gewesen war.
Rita schalt ihn einen Lügner. Sie zeigte mit gespreizten Fingern in der Luft die Größe, aber Jørgen beharrte auf seinem Standpunkt. Schließlich schubste Jørgen sie von der Mauer.
Es hätte ein Ende mit Schrecken nehmen können, wenn nicht die wortkarge und schüchterne Lina plötzlich gesagt hätte, dass sie einen richtigen Männerpimmel gesehen habe. Die Münder öffneten sich entzückt und erschrocken zugleich. »Ne-ee«, kam es ungläubig.
Lina warf triumphierend den Kopf zurück und entfernte mit einem Hölzchen den Dreck aus den abgetretenen Profilen ihrer Stiefel. Sie spitzte den Mund, bis er aussah wie ein kleiner Schnabel, und schaute in die Luft und wollte die anderen nicht ansehen.
»Bah, du lügst! Die sind kein bisschen blau. Du bist verrückt!« Jørgen war entrüstet. Ole und die Mädchen sahen ihn an. Es ging ihnen auf, dass er sich für sein Geschlecht schämte und um keinen Preis mit einem blauen Pimmel in Verbindung gebracht werden wollte.
Ole unterstützte Jørgen vorsichtig und winkte Lina ab. Aber sie behauptete: »Jungenpimmel sind eben nicht das Gleiche wie Männerpimmel, verstehste das nicht?«
Nein, Ole und Jørgen verstanden das nicht.
Allmählich gingen sie dann zu einem anderen Gesprächsthema über, denn die Argumente waren verbraucht, und sie wollten eigentlich auch lieber über die Sache reden, als darüber in Streit zu geraten.
Tora grübelte trotzdem darüber nach, was Lina gesagt hatte. Am Abend, unter dem Federbett, bekamen alle ihre Traumgesichte eine blaue Farbe, und die Phantasie kroch ihr sozusagen unter die Haut. Über dem Ganzen lagen der Ekel und die Gefahr und Zerstörung. Alles Geflüstere zwischen der Mutter und Tante Rakel, alle Geräusche aus dem Zimmer, wenn die Mutter und Henrik glaubten, dass sie schlief.
Alle nicht zu Ende erzählten Witze unten in den Fischerhütten, alle Geschichten, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren. Sie konnte das nicht voneinander trennen, konnte nicht wissen, wo sie hingehörte. Sie wusste nicht, ob sie Ekel empfand oder …
Manchmal schämte sie sich über sich selbst und war froh, wenn niemand sie in der Dunkelheit sah.
Sie hatte das Gefühl, nicht mehr sie selbst zu sein. Die empfindlichen Kuppen auf der Brust schienen gar nicht richtig zu ihr zu gehören. Sie machte den Rücken krumm, damit niemand sie sah. Wollte sie gewissermaßen in sich verstecken. Aber das half wenig. Sie waren schuld daran, dass ihr alle Kleider oben zu eng wurden. Sie wünschte, sie wäre ein Junge. Lina und Rita waren noch flach. Sie konnten im letzten Sommer bei Ebbe unten am Strand nur in der Unterhose herumlaufen. Tora erfand alle möglichen Entschuldigungen, um nicht dabei sein zu müssen. Sie hatte nicht nur die kleinen Knospen, derentwegen sie sich schämte. Es schienen auch überall Haare zu wachsen. Und manchmal roch es nach alten Nelken, der Geruch kam sowohl von ihr als auch aus den Kleidern. Er erinnerte sie an eine Beerdigung. Ein widerlicher, süßlicher Geruch, jedes Mal, wenn es ihr warm oder wenn sie nervös wurde. Sie hielt sich jetzt meist an Sol, die beinahe zwei Jahre älter und die an manchen Stellen reichlich dicker geworden war. Samstags machte Tora in ihrer Kammer Feuer und trug das Waschwasser und die Handtücher hinein.
Im letzten Winter hatte sie noch in der Zinkwanne vor dem Küchenofen gebadet. Aber dann hatte sie sich ihrer Mutter widersetzt und sich geweigert. Es könnte ja jemand kommen. Einmal war Henrik gekommen, während sie in der Bütte saß. Er betrachtete sie. Es war nicht auszuhalten. Sie blieb sitzen, bis er wieder ging. Er hatte den Körper gesehen, der nicht der ihre war. Dann hatte sie wochenlang nicht gebadet. Die Mutter wurde böse und sagte, dass die Würmer sie noch auffressen würden. Schließlich ließ sie dann durchblicken, dass Tora in ihrer Kammer heizen und dort baden könnte, wenn sie wollte.
Tora fühlte dabei eine weiche, warme Zuneigung für die Mutter. Sie hätte sie am liebsten umarmt, konnte sich aber nicht dazu überwinden. Es schien ein Meer zwischen Mama und ihr zu liegen – in diesen Dingen.
Während des ganzen Frühlings und Sommers hatte sie sich in der Kammer gewaschen und ein Messer zwischen Tür und Türrahmen gesteckt. Das war das einzige Schloss, das sie besaß. Man konnte das Messer gut von außen wegdrücken, aber es war doch eine Art Verschluss, eine Ankündigung, dass sie allein sein wollte, ohne dass sie etwas zu sagen brauchte.
Vor dem großen Pult in der Schule konnte sie auch allein sein. Da hatte sie nur Gunn vor sich.
Alle Augen waren hinter ihr. Sie konnte so tun, als ob sie Gunn zuhörte, und dennoch ihre eigenen Gedanken denken. Sie konnte seelenruhig die wunderlichsten Dinge fantasieren. Gunn war sehr darauf bedacht, dass Ruhe im Klassenzimmer herrschte. Sie hatte eine seltsame Macht über die Kinderschar, um die sie sogar der alte Lehrer hätte beneiden können. Und sie ließ solche Kinder wie Tora mit ihren Gedanken in Frieden.
Ihre Autorität war nicht fassbar, weil sie so ganz anders war als die, welche die Kinder in Form von Ohrfeigen und Prügel von ihren Vätern kannten. Gunns Methode verwirrte vor allem die älteren Jungen. Sie sah sie an. Ließ sie mit dem Blick nicht los.
Manchmal legte sie ihre Hand auf den Nacken des Missetäters. Dann hob sie mit einer bestimmten Bewegung seinen Kopf und sah ihm in die Augen, bis es ganz still im Klassenraum wurde und der Schlingel aufgab.
Aber es dauerte nicht lange, bis Gunns Grübchen wieder zum Vorschein kamen, und alles war gut.
Tora ging gern in die Schule. Sie liebte den Geruch von Staub und Kreide. Man musste nur seine Arbeit ordentlich erledigen, dann hatte man seine Ruhe. Jedenfalls während des Unterrichts. Man konnte Gunn alles fragen – beinahe alles. Und man bekam eine Antwort.
Aber der Hengst des Pastors und die Gefahr gehörten zu den Dingen, nach denen man keinen Erwachsenen fragen konnte. Es war auch nicht so, dass man immer draußen auf der Straße fragen konnte. Das ging nur, wenn es sich gerade ergab. Wie damals auf der Weide.
Im Herbst war Tora in dieselbe Klasse gekommen wie Sol. Die beiden letzten Jahrgänge wurden zusammengefasst.
Sol hatte ein Jahr Vorsprung vor Tora, aber sie prahlte deshalb nicht. Eine vom Tausendheim konnte es sich nicht leisten, eine Freundschaft für Bagatellen zu opfern.
Tora fand Jørgen nicht mehr so aufregend wie die ganzen Jahre zuvor. Der Alltag und die Jahre veränderten sie alle. Und Jørgen schlug sein Wasser in ihre Schuhe ab und versteckte Sols Schulbücher, er fluchte, wenn die Mutter gerade nicht zuhörte, und es zog ihn immer wieder hinunter zu den Kais. Sol war schweigsam, aber sie kannte sich in den meisten Dingen aus, die zwischen den vier Wänden vor sich gingen und die in vielen Irrgängen des Lebens verborgen waren. Sie war die älteste von sieben Elisif-Kindern, und sie hatte mehr oder weniger unfreiwillig Geburt und Empfängnis mitbekommen, in den Nächten all der Wochen und Jahre im Tausendheim.
Aber Tora konnte Sol nicht danach fragen, worüber auf der Straße gesprochen wurde, sonst würde Sol sie am Ende für ein kleines Kind halten.