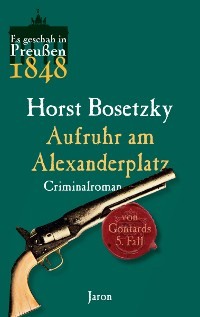Kitabı oku: «Aufruhr am Alexanderplatz», sayfa 2
In ihrem Gesicht arbeitete es einen Augenblick, dann lächelte sie, leicht maliziös, wie ihm schien, stand auf und streckte ihm ihre Hand entgegen. »Oh, que c’est beau de vous voir encore une fois, mon ami une fois tant aimé .”
Gott sei Dank hatte sie das auf Französisch gesagt, und die anderen im Wartezimmer Sitzenden verstanden es offenbar nicht. Nur der Junge, der neben ihr saß, grinste anzüglich.
»Auch für mich ist es ein Vergnügen, Ihnen, Mademoiselle Flora, in diesem Leben noch einmal zu begegnen.« Gontard küsste ihr die Hand.
Sie wies auf den grinsenden Jungen. »Darf ich vorstellen? Mein Sohn Jean-Paul.«
Gontard erschrak, denn er hatte schnell zurückgerechnet. O nein, diese Ähnlichkeit! Aber wenn Jean-Paul wirklich sein Sohn war, warum hatte sich Flora nie gemeldet? Und jetzt? War sie etwa aus Paris zurückgekommen, um ihn, wie die Berliner sagten, auszunehmen wie eine Weihnachtsgans? O Gott, der Skandal, wenn Henriette davon erfuhr! Und all die preußischen Beamten, die ihn wegen seiner liberalen Tendenzen schon lange im Visier hatten! Plötzlich hatte er eine Schreckensvision vor Augen: Flora wurde in Berlin ermordet – und für Werpel wie auch den Polizeipräsidenten von Minutoli gab es da nur einen möglichen Täter, nämlich ihn. Ihm wurde siedend heiß. Was tun? Fliehen oder standhalten?
Wer ihn rettete, war sein Freund, denn gerade in diesem kritischen Augenblick öffnete Kußmaul die Tür zum Sprechzimmer und erfreute die Wartenden mit der Aufforderung: »Der Nächste bitte!«
Da sprang Gontard vor, drängte einen Rentier zur Seite, presste die rechte Hand auf den Unterbauch und stöhnte: »Herr Doktor, mein Blinddarm! Ich sterbe!«
Dr. Kußmaul ahnte natürlich nichts von den Zusammenhängen, begriff aber sofort, dass Gontard in Not war, und ließ ihn an sich vorbei ins Behandlungszimmer schlüpfen, wo er dann auch über alles aufgeklärt wurde.
»Was nun, Fritz?«, fragte Gontard, nachdem er seinem Freund die Geschichte erzählt hatte.
Der Arzt musste nicht lange überlegen. »Ich lasse dich jetzt durch die Hintertür entkommen, und du gehst rauf zu meiner Frau und lässt dir einen Baldriantee aufbrühen.«
Der tat dann auch bald seine Wirkung, aber noch mehr half Gontard der Trost, den ihm Luise Kußmaul zuteilwerden ließ. »Deine Henriette hat ein großes Herz, und sie wird es hinnehmen, dass du noch ein drittes Kind gezeugt haben könntest – es war ja alles vor ihrer Zeit.«
»Aber was ist, wenn Flora Geld von mir haben will, viel Geld, und damit droht, sonst einen Riesenskandal zu entfesseln?«
»Dann hast du uns an deiner Seite, und du kennst selbst eine Menge einflussreicher Leute. Was soll da schon passieren?«
Gontard war verzweifelt. »Falls sie umgebracht wird, werde ich als ihr Mörder verdächtigt werden.«
Luise Kußmaul sah ihn verständnislos an. »Warum sollte sie denn umgebracht werden?«
»Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl …«
Und von diesem Gefühl kam er auch am Abend nicht los, als er mit Kußmaul durch Berlin streifte, um herauszufinden, ob es irgendwo Anzeichen für ein bevorstehendes politisches Erdbeben gab. In Mailand, Palermo, Neapel und Padua hatte es schon Unruhen gegeben. Breitete sich die Revolte von dort nach Norden aus? Wurde München, wo Lola Montez weiter für Aufregung sorgte, als erste deutsche Stadt erfasst? Dies alles fragten sich die Berliner, insbesondere die Intellektuellen, die im Roten Salon des Lesecafés Stehely oder im Lese-Cabinet der Berliner Zeitungs-Halle am Gensdarmen-Markt beisammensaßen und diskutierten. Zeitungen mussten in Preußen von der Zensur genehmigt werden, aber viele ausländische Blätter wurden im Reisegepäck nach Berlin geschmuggelt. Besonders begehrt waren die aus der Schweiz, wo das liberale Bürgertum gerade einen grandiosen Sieg errungen hatte. Wer eine der raren Zeitungen aus Zürich oder Bern ergattert hatte, stellte sich oft auf einen Stuhl und las den anderen laut daraus vor. Diesmal erlebten Gontard und Kußmaul den Tierarzt Friedrich Ludwig Urban in dieser Rolle. Es hieß, Urban sei prädestiniert dafür, das Volk anzuführen, wenn es in Berlin zu einer Revolution kommen sollte.
»Gott«, murmelte Gontard, »einen preußischen Danton oder Robbespierre hätte ich mir anders vorgestellt. Dieser Urban ist doch nur eitel und geltungssüchtig und viel zu romantisch und gefühlsselig, als dass er die Massen mitreißen könnte.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, widersprach Kußmaul ihm.
Wesentlich besser gefiel Gontard später der Kellerhalsredner Heinrich Carrenzien, den sie in der Weinmeisterstraße erlebten. Kellerhalsredner hießen Leute wie er bei den Berlinern, weil sie auf den niedrigen, überdachten Treppen standen, die in die Kellerlokale führten, und von dort aus zu den anwesenden Gästen sprachen.
»Ihr Männer alle«, rief er mit Stentorstimme, »erhebt euch, um für das zu kämpfen, was für euch am wichtigsten ist: das Recht auf Arbeit! Fordert die Einrichtung von Nationalwerkstätten, wo man euch mit gemeinnützigen Arbeiten beschäftigt und gut entlohnt. Das sichert euer Überleben und den allgemeinen Wohlstand.«
»Dann soll der Carrenzien mal den Karren ziehn«, reimte Kußmaul. »Und zwar aus dem Dreck.«
Sie hätten ihm gern noch länger zugehört, doch hinter ihnen gab es einen kleinen Auflauf. Zwei Männer waren in eine heftige Schlägerei geraten. Offenbar ging es um ein auffallend schönes Mädchen. Wie Gontard und Kußmaul den Zurufen der Umstehenden entnehmen konnten, handelte es sich bei den Herren um den Arbeitsmann Ferdinand Dünnebier und den Tischlergesellen Gottlieb Letschinski und bei der Dame um eine gewisse Auguste Gärtner, offenbar eine Dienstmagd. Jeder drohte dem anderen, ihn auf der Stelle umzubringen.
»Dir is wohl schon lange keen blutijet Ooge übers Chemisett jekullert!«
»Dir hau ick uff ’n Kopp, dette in keen Sarg mehr passt!«
»Een Schlag, und deine Neese sitzt hinten!«
»Ick schmeiß dir an de Wand, dette kleben bleibst und der Criminal-Commissarius dir abkratzen muss!«
Kußmaul wandte sich an Gontard. »Da scheint es endlich mal einen Fall für dich zu geben.«
Gontard wehrte ab. »Nicht doch, du beleidigst mich. Wer da der Täter ist, findet sogar Werpel auf Anhieb heraus, das ist weit unter meinem Niveau.«
Drei
Franz Theodor Kugler saß mit Adolph Menzel am 14. Februar, einem Montag, im Hotel Ruppiner Hof in der Spandauer Straße No. 79. Die beiden verband nicht nur eine innige Freundschaft, sondern auch eine gemeinsame berufliche Erfahrung: Menzel hatte für Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen rund vierhundert Zeichnungen angefertigt und damit zu dem großen Erfolg des Werkes beigetragen. Menzel war es dadurch außerdem gelungen, sich als Künstler einen Namen zu machen und Kontakte zum Hof zu knüpfen. Kugler hatte schon vorher einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, nicht zuletzt durch sein 1830 erschienenes Skizzenbuch mit dem Volkslied An der Saale hellem Strande. Er war Mitglied der Sing-Akademie zu Berlin und der literarischen Vereinigung ›Tunnel über der Spree‹.
»Wie geht es bei dir zu Hause?«, wollte Menzel nun von Kugler wissen.
Kugler lächelte. »Danke, gut, wenn auch manchmal recht hitzig.« Das war eine Anspielung darauf, dass er vor fünfzehn Jahren Clara Hitzig geheiratet hatte, die Tochter von Julius Eduard Hitzig. »Wir haben drei sehr lebhafte Kinder.«
Da schwieg Adolph Menzel. Wegen seiner »Gnomenhaftigkeit« – 1,40 Meter maß er lediglich – war er nicht nur als untauglich für das Militär erklärt worden, sondern wurde auch von allen Frauen übersehen, die ihm gefielen. Die menschliche Wärme fand er bei seiner Mutter und seinen Geschwistern, mit denen er auch zusammenwohnte.
Menzel griff nach seinem Weinglas. »Ich hoffe nur, wir schaffen es zeitlich wie finanziell, in diesem Sommer einmal zu verreisen.«
Kugler legte ihm die Hand auf den Unterarm. »Warte nur, bis sie deine Bilder überall ausstellen und dich zu allen Vernissagen anreisen lassen.«
»Ja, Dresden, Wien, Paris – das wäre wunderbar!«
»Und Breslau nicht?«, fragte Kugler. Dort war Menzel am 8. Dezember 1815 zur Welt gekommen – wie so viele echte Berliner.
Menzel winkte ab. »Über Breslau habe ich erst letzte Woche mit Borsig geredet, der kommt ja auch von daher.«
»Willst du nicht eine seiner Lokomotiven malen, wie sie durch die Schöneberger Wiesen dampfen?«, fragte Kugler.
Menzel fasste sich an den Kopf. »Gott, Franz, das habe ich doch schon letztes Jahr getan!«
Kugler seufzte. »Dass ich das vergessen konnte! Wie kann ich das nur wiedergutmachen?«
»Ganz einfach. Sorg dafür, dass sie mich aufnehmen in diesen Verein mit dem Namen ›Tunnel über der Spree‹.«
»Versprochen.«
Damit leerten sie ihre Gläser, zahlten die Zeche und nahmen Abschied voneinander. Danach machten sie sich auf den Heimweg, was ein ziemliches Abenteuer war, denn eine elektrische Straßenbeleuchtung gab es in Berlin noch lange nicht, und man musste sich darauf verlassen, dass etwas Licht aus den Wohnungen fiel und die trüben Gaslaternen an den Hauseingängen nicht vom Wind ausgeblasen worden waren. Dazu kam, dass die Bürgersteige nur grob gepflastert waren und zum Fahrdamm hin von einer breiten Rinne gesäumt wurden, durch die das Regenwasser abfließen sollte. Ab und an gab es schmale hölzerne Stege, auf denen man sie überwinden konnte.
Aber Kugler hatte es nicht weit, er wohnte in der Stralauer Straße, gleich hinter dem Molkenmarkt, brauchte also nur die Spandauer Straße hinunterzugehen. Das war eigentlich in ein paar Minuten zu schaffen – und dennoch dauerte es heute eine gute Stunde, ehe er zu Hause war. Denn an der Nikolaikirchgasse stolperte er über einen menschlichen Körper.
»Heh, Wache!«, schrie er in die Dunkelheit. »Hier liegt ein Betrunkener. Kommt den mal holen, sonst erfriert er noch.«
Als der Nachtwächter mit seiner Laterne heran war, erkannte Kugler den Mann: Es war Ferdinand Dünnebier, ein Dienstmann, der ihm schon oft beim Tragen schwerer Lasten geholfen hatte.
»Der is ja gar nich besoffen«, stellte der Nachtwächter fest, nachdem er sich zu Dünnebier hinuntergebeugt hatte. »Der ist tot, dem hamse ’n Schädel einjeschlagen. Sehn Se det Blut hier hinten am Koppe …«
Der Criminal-Commissarius Waldemar Werpel wohnte schon seit einer halben Ewigkeit in der Oberwallstraße. Die begann Unter den Linden, quetschte sich zwischen Kronprinzen und Prinzessinnenpalais hindurch Richtung Süden und endete am Hausvogteiplatz. Direkt neben ihm, im Hause No. 4a, hatte August Neidhardt von Gneisenau gelebt, einer der großen preußischen Heerführer in den Befreiungskriegen, und das erfüllte Werpel, der Preuße durch und durch war, mit nicht geringem Stolz.
Wie an fast allen Abenden langweilte er sich auch an diesem. Seine acht Kinder schliefen schon, ebenso seine Frau. Das war bedauerlich, weil er sich gern wieder einmal als Ehegatte betätigt hätte. Nun war er mit Minna schon seit über zwanzig Jahren verheiratet, und da sie zudem in letzter Zeit sehr in die Breite gegangen war, begehrte er sie eigentlich nicht mehr, doch am Tage hatte er in seiner Amtsstube die Tänzerin Flora Morave zu Besuch gehabt, der man Geld gestohlen hatte, und seitdem war er sexuell derart aufgeladen, dass er es ohne Kopulation kaum noch aushalten konnte. In ein Bordell zu gehen, was das Naheliegendste gewesen wäre, verbot ihm sein Amt. Was tun? So saß er beim Schein seiner Rübenöllampe am Küchentisch, tat so, als würde er Akten studieren, und ließ seine rechte Hand ihr Werk vollbringen. Gerade nahte die Erlösung, da wurde kräftig an seine Haustür gebummert.
»Herr Commissarius, schnell, kommen Sie!«, schrie jemand von der Straße her. »Ein Mord an der Nikolaikirche.«
Werpel fühlte sich um seine Lust betrogen und verfluchte Gott und die Welt. Aber was half ’s? Über allem standen Dienst und Pflichterfüllung. Also knöpfte er eilig seine Hose zu und lief auf den Flur. »Wer ist denn da?«
»Der Kugler.«
»Pardon, ich eile!« Werpel war natürlich nicht entgangen, dass Franz Theodor Kugler beim König ein Stein im Brett hatte. Er öffnete, bedankte sich in blumigen Worten für die Aufmerksamkeit des Schriftstellers und lief dann zur Kammer seines Ältesten. »Johannes, zieh dich an, und lauf zu Constabler Krause! Er soll sich auf der Stelle an der Nikolaikirche einfinden. Wir müssen sogleich herausfinden, um wen es sich bei dem Ermordeten handelt.«
Kugler lächelte. »Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Es ist der Dienstmann Ferdinand Dünnebier.«
Werpel zuckte zusammen. Alle taten so, als wäre er ein Kretin. »Hat Ihnen das der Oberst-Lieutenant von Gontard verraten?«
»Nein – wieso? Der war doch gar nicht an der Nikolaikirche.«
»Gut, dann wollen wir mal!« Er sagte noch schnell seiner Minna Bescheid, die schlaftrunken in den Flur getreten war, dann machte er sich an der Seite Kuglers auf den Weg zur Nikolaikirche. Sie liefen über die Französische Straße zum Werderschen Markt und weiter zum Schloßplatz, um die Spree zu überqueren. Hier stank es fürchterlich, denn die sogenannten Latrinen-Emmas hoben gerade die Fäkalieneimer, die sie in den anliegenden Straßen aufgeladen hatten, von ihrem Handkarren und kippten sie in den Fluss. Beim Einbiegen in die Poststraße kam ihnen der Constabler Krause entgegen.
»Welchen Wirt soll ick festneh’m?«, fragte er Werpel.
»Welchen Wirt Sie festnehmen sollen?«, wiederholte Werpel, der sich darauf beim besten Willen keinen Reim machen konnte.
»Na, den, der det zu dünne Bier ausjeschenkt hat.« Werpel seufzte. Es stimmte leider, was viele von Krause behaupteten: dass er dümmer sei, als die Polizei erlaubte. Er erklärte ihm, dass der Ermordete den Namen Ferdinand Dünnebier trug.
»Det muss doch ’m dummen Menschen jesagt werden«, maulte Krause.
»Darum sag ich’s Ihnen ja.« Werpel wandte sich an Kugler, da sie nun das Gotteshaus erreicht hatten und auf der Nordseite umrundeten, um in die Nikolaikirchgasse zu gelangen. »Wo genau liegt denn nun der tote Dünnebier?«
»Da drüben, vor der Wenzel’schen Holz- und Kohlenhandlung.«
Werpel staunte, als sie die besagte Stelle erreicht hatten.
»Da liegt aber keiner!«
»In der Tat«, musste Kugler einräumen.
»Dabei is doch noch ja nich Himmelfahrt«, stellte Krause fest.
Vier
Christian Philipp von Gontard hatte als Königlich Preußischer Oberst-Lieutenant viele dienstliche Pflichten, und eine von ihnen war die Teilnahme an den Beerdigungen hochrangiger Militärs. Die wurden – sofern sie denn einen Platz in Anspruch nehmen mussten, weil sie keinen eigenen Landbesitz in Preußen hatten – auf dem Invalidenfriedhof beigesetzt. Inzwischen lagen hier viele Helden der Befreiungskriege, und im Februar 1848 waren Leopold Hermann Ludwig von Boyen und Johann Friedrich Constantin von Lossau dazugekommen. Letzteren schätzte Gontard ganz besonders, weil dessen Standardwerk Ideale der Kriegsführung, in einer Analyse der Thaten der größten Feldherren für seine Lehrveranstaltungen im Fach Kriegsgeschichte unentbehrlich war. Die Entscheidungen von Alexander dem Großen, Hannibal, Caesar, Gustav Adolf, Turenne, dem Prinzen Eugen, Friedrich dem Großen und Napoleon wurden darin kenntnisreich diskutiert. Dabei teilte Gontard Lossaus Meinung voll und ganz, dass nur derjenige Feldherr auf Dauer erfolgreich sein konnte, der seine Entscheidungen nicht nach starren Regeln der Kriegskunst, sondern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und besonderen Verhältnisse traf und konventionellem Denken nicht verhaftet war.
Als der Trauerredner über Lossau sprach, hörte Gontard ganz genau zu und machte sich sogar heimlich Notizen, um das Gehörte in seine Vorlesungen einfließen lassen zu können.
»Johann Friedrich Constantin von Lossau wurde am 24. Juli 1767 als Sohn eines preußischen Generals der Infanterie in Minden geboren. Bekannt geworden ist er vor allem als Militärhistoriker …«
Auf dem Weg von der Kapelle zur Grabstelle hatte Gontard einen Mann mittleren Alters vor sich, der ihm irgendwie bekannt vorkam. Er war untersetzt und ging mit leicht schlurfenden Schritten. Mit seinem Nebenmann unterhielt er sich leise in einer Sprache, die Gontard erst für Polnisch, dann für Litauisch hielt, von der er aber kein Wort verstand außer »Lossow«.
»Taip, mūsų draugas buvo labai puikus vyras Lossow, ir dabar mes turime vykdyti jį jo kape …«
Als sie dann am offenen Grab Aufstellung genommen hatten, um den letzten Worten des Garnisonpredigers zu lauschen und zu warten, bis sie ihre drei Hände Sand auf den inzwischen herabgelassenen Sarg werfen konnten, drehte der andere ihm sein Gesicht zu, und bei Gontard zündete es sofort: Richard von Randersacker, Schießplatz Wahner Heide. Nach Ende der Zeremonie fand er dann Gelegenheit, Randersacker anzusprechen. »Christian Philipp von Gontard, Oberst-Lieutenant und Lehrer an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule Unter den Linden. Sie erinnern sich an unsere erste Begegnung?«
In Randersackers breitem und etwas teigigem Gesicht begann es zu arbeiten. »Nein, ich bedauere sehr …«
Gontard half ihm auf die Sprünge. »Schießplatz Wahner Heide. Das Vergleichsschießen, bei dem die junge Marie Engels ums Leben gekommen ist.«
Randersacker lächelte. »Normalerweise töten ja unsere Granaten nur Männer, und wenn es damals auch einmal eine Frau getroffen hat, dann ist das nur Gottes ausgleichende Gerechtigkeit.«
So viel Zynismus war Gontard nicht gewohnt, und so dauerte es einen Moment, bis er sich gefangen hatte und Randersacker fragte, welche Konsequenzen der Schießunfall für ihn gehabt habe.
»Keine. Weshalb denn auch?«
Gontard war nicht bereit, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. »Weil Sie die Schussbahn der Kanonen mit den neuartigen Kolbenverschlüssen falsch berechnet hatten und der verantwortliche Mann auf dem Schießplatz waren.«
Randersacker winkte ab. »Da war vorher nichts abzusehen und zu berechnen, das war alles technisches Neuland. Keiner kann mir in dieser Hinsicht einen Vorwurf machen.«
Gontard schwieg jetzt lieber. Seiner Meinung nach hätte man exakter rechnen können und mehr Vorsicht an den Tag legen müssen. Wäre Randersacker vor ein Gericht gebracht worden und er der Richter gewesen, so hätte er ihn wegen fahrlässiger Tötung zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Aber Randersacker war nicht angeklagt worden, dazu hatte er viel zu gute Beziehungen zum Hofe und zu einflussreiche Freunde im Kriegsministerium.
»Nichts für ungut«, sagte Gontard, als er sich von Randersacker abwandte.
»Sollten Sie in Ihrer Anstalt etwas von sich geben, das meine Ehre antastet, dann gnade Ihnen Gott!«, zischte Randersacker noch.
Die Wilhelmstraße war nach 1731 auf Geheiß von Friedrich Wilhelm I. bei der Erweiterung der Friedrichstadt angelegt worden. Anfangs hatte sie noch den Namen Husarenstraße getragen. In ihrem nördlichen Teil hatten sich bald darauf Minister und Vertraute des Königs ihre Palais hinstellen lassen, so auch Richard von Randersacker.
Getrieben von Langeweile, streifte der nach dem Frühstück durch die Gänge seines Prunkbaus. Vielleicht traf er auf das neueingestellte Dienstmädchen, diese Auguste Gärtner, und vielleicht ließ die sich für ein paar Thaler kurz von der Arbeit ablenken. Auch eine Küchenmamsell war ihm recht. Die fühlte sich womöglich sogar noch geehrt, wenn er sich herabließ, ihr kurz beizuwohnen. Und wenn sich in dieser Hinsicht nichts ergab, dann wollte er wenigstens auf Menschen treffen, mit denen er sich streiten konnte.
Doch das Glück war ihm hold, denn als er an der Wäschekammer vorbeikam, sah er durch die offenstehende Tür Auguste, wie sie Tischtücher von der Leine nahm und in eine Truhe legte. Dabei beugte sie sich so weit nach unten, dass ihn der Wunsch überkam, hinter sie zu treten und ihr auf der Stelle die Röcke hochzuschieben. Er wollte schon zur Attacke übergehen, da tauchte seine Frau hinter ihm auf.
»Hände weg von dem Mädchen!«, zischte sie. »Nicht, dass ich dir den Spaß nicht gönne, aber Augustes Bräutigam schlägt dir den Schädel ein, wenn er davon erfährt.« Auguste hatte alles mitbekommen, drehte sich um und lachte. »Ja, det stimmt, gnä’ Frau, den Ferdinand Dünnebier ham se wejen mir schon erschlagen.«
Randersacker machte, dass er weiterkam. Als Nächstes lief ihm sein Kammerdiener über den Weg.
»Ist Ihnen nicht wohl, Herr Baron?«, fragte der. »Sie sehen so blass aus.«
Randersacker stöhnte laut. »Jacques, ich brauche unbedingt eine Frau …«
Der Kammerdiener grinste. »Da trifft es sich ja gut, dass Flora wieder in Berlin ist …«
»Was, sie ist hier?«
»Ja, ich habe sie vor ein paar Tagen bei Doktor Kußmaul aus der Ordination kommen sehen.« Jacques beugte sich vor, weil er den nächsten Satz nur noch zu flüstern wagte. »Soll ich wieder etwas arrangieren, Herr Baron?«
»Dafür wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Und so bald wie möglich!«
Damit machte er sich auf den Weg zu seinem Bureau im Kriegsministerium, das an der Leipziger Straße lag und in den letzten drei Jahren ausgebaut und um ein Stockwerk erhöht worden war. Es war ein großartiges, palastähnliches Gebäude. Die beiden Portale in der Fassade waren mit lebensgroßen Figuren eines Garde-Kürassieres, eines Garde-Infanteristen und eines Husaren geschmückt, die man aus sogenannter Chaussée-Masse gefertigt hatte.
Im Treppenhaus traf er auf seinen Vorgesetzten, den Kriegsminister Ferdinand von Rohr, mit dem er ein wenig über den Krieg zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika redete. Der bot in diesen Tagen am meisten Gesprächsstoff.
»Es erreichen uns immer mehr Details«, begann Randersacker seinen Bericht. »Generalmajor Robert Patterson hat mehrere seiner Soldaten wegen begangener Kriegsverbrechen hinrichten lassen.«
»Interessant«, murmelte von Rohr.
»In Huamantla haben Mexikaner einen amerikanischen Major ermordet, und daraufhin hat der Brigadegeneral Joseph Lane seine fast zweitausend Mann starke Truppe auf die Bevölkerung losgelassen. Sie haben geplündert, die Stadt zerstört, vielfach gemordet und die Frauen geschändet.«
»Fürchterlich! Und undenkbar in Deutschland.« Randersacker nickte. »Fürwahr! Außerdem wird von vielen Desertionen berichtet. Der Dienst in der amerikanischen Armee ist beschwerlich, nicht hochangesehen und schlecht bezahlt. Es sollen viele Soldaten, insbesondere Katholiken und Neu-Einwanderer, zu den Mexikanern übergelaufen sein.«
Der Minister seufzte. »Das könnte auch für uns ein Problem werden, wenn es zum Krieg zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland kommt, was mir unausweichlich erscheint.«
»Nachdem die Amerikaner die nächsten Schlachten gewonnen hatten, haben sie die Rädelsführer der Deserteure hängen oder erschießen lassen. Richtig so!«
»Und wie wird es weitergehen?«, wollte der Kriegsminister wissen.
»Man sitzt jetzt in einem Nest mit dem schönen Namen Guadaloupe beisammen und verhandelt über einen Friedensvertrag. Es heißt, Mexiko werde fast die Hälfte seines Staatsgebietes an die Amerikaner abtreten müssen.«
Ferdinand von Rohr geriet ins Träumen. »Stellen Sie sich einmal vor, Randersacker, wir führten Krieg gegen Österreich, Bayern und Sachsen, gingen daraus als Sieger hervor und hätten dann unser Guadaloupe …«
Damit verabschiedete er sich von Randersacker. Der verbrachte die nächsten Stunden in Vorfreude auf das erhoffte private Vergnügen. Und wirklich, als er dann nach Hause kam, konnte Jacques ihm ins Ohr flüstern, dass Flora Morave ihn erwartete.
»Und wo?«
»Im ›König von Portugal‹.«
»Sehr gut.«
Dieses Lob bezog sich darauf, dass besagtes Hotel in der Burgstraße No. 16 zu finden war – und man nur drei Häuser weiter die Kriegsakademie untergebracht hatte, in der Randersacker mehrmals in der Woche preußische Offiziere unterrichtete. Und so konnte er jetzt seiner Magdalene zurufen, dass er schnell noch einmal in die Burgstraße müsse, ohne dabei rot zu werden.
Die Burgstraße zog sich am östlichen Spreeufer entlang und durchquerte das Heilig-Geist- und das Nikolaiviertel. Neben dem »König von Portugal«, dessen Fassade von keinem Geringeren als Karl Friedrich Schinkel gestaltet worden war, und der Kriegsakademie gab es hier noch weitere Glanzpunkte preußischer Baukunst: das alte Posthaus, das Palais des Grafen von Wartenberg und das Palais Itzig. Die Gegend war so belebt, dass Randersacker nicht besonders auffiel.
Bereits erregt ob dessen, was ihn erwartete, betrat er das Hotel. Ein in die Hand gedrücktes Goldstück, ein kurzes Flüstern und schon wies ihm der Portier den Weg. »Dritter Stock, Zimmer 310, mit Spreeblick.«
Randersacker stieg die Treppen so schnell hinauf, wie es ihm in seinem Alter noch möglich war. In der dritten Etage angekommen, verschnaufte er erst einmal ein wenig, um nicht sofort Floras Spott herauszufordern. Er orientierte sich kurz und fand heraus, dass ihr Zimmer am Ende des Ganges gelegen war. Zwanzig Schritte noch … Er konnte es kaum mehr erwarten und ging noch ein wenig schneller. Da ging vor ihm eine Tür auf, und ein Mann trat ihm entgegen. Maskiert und mit einer Pistole in der Hand.
Der Portier unten in der Empfangshalle hörte einen Schuss und einen Schrei.
Criminal-Commissarius Waldemar Werpel und sein Constabler waren weiterhin nach Kräften bemüht, das Rätsel um den angeblich erschlagenen und dann wieder von den Toten auferstandenen Arbeitsmann Ferdinand Dünnebier zu lösen.
Krause hatte schon eine Idee. »Wir müssen ihn bloß mal fragen, wie det allet jekomm is.«
Werpel fasste sich an den Kopf. »Um ihn zu befragen, müssen wir ihn erst einmal haben, aber er ist und bleibt nun mal verschwunden.«
Der Constabler feixte und zeigte nach oben. »Vielleicht issa doch aufjefahr’n gen Himmel.«
»Dann passen Sie nur auf, dass er nicht wieder runterkommt und Ihnen uff ’n Kopp fällt!«
Werpel überlegte, und das ging nicht so schnell, weil es für ihn Schwerstarbeit war. Natürlich war Dünnebier nicht in den Himmel aufgefahren. Es blieben drei Möglichkeiten. Erstens: Der Mörder war zurückgekommen und hatte Dünnebier mitgenommen, um die Spuren seiner Tat zu beseitigen oder um den Arbeitsmann nun endgültig totzuschlagen. Zweitens: Dünnebier war wieder zu sich gekommen und hatte sich, betrunken wie er war, davongemacht. Es konnte ja sein, dass gar niemand versucht hatte, ihn um die Ecke zu bringen, und er in seiner Trunkenheit nur gestürzt und mit dem Kopf auf die Stufen der Kohlenhandlung aufgeschlagen war. Drittens: Es hatte wirklich ein Fremder Dünnebier die Kopfverletzung zugefügt – dass es die wirklich gegeben hatte, war von Kugler und dem Nachtwächter bestätigt worden –, aber der Verletzte war wieder zu sich gekommen und hatte sich davongemacht.
Während Werpel noch all dies gegeneinander abwog, wurde Krause langsam ungeduldig. »Watt is’n nu, Herr Commissarius, wen soll ick’n festnehm?«
»Den Dünnebier.«
»Wieso’n ditte?«
Werpel tat amtlich. »Weil er eine Straftat vorgetäuscht hat.« Das war eine weitere Variante, die ihm eben erst eingefallen war. Dünnebier hatte die Obrigkeit hinters Licht führen wollen.
»Jut, wenn Se mir zeigen, wo a is, nehm ick ihn ooch fest«, erklärte Krause. »Aba wo issa?«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Krause?«
»Gerne, wenn det ’n Befehl is.« Er setzte wirklich an, den Commissarius hochzuheben, und da Werpel sich wehrte, konnten die umstehenden Berliner ein kleines Schauspiel genießen.
Als sich beide wieder voneinander gelöst hatten, machten sie sich auf den Weg zur Nikolaikirchgasse, um mit dem Kohlenhändler Wilhelm Wenzel und seiner Frau zu reden. Aber die konnten ihnen auch nicht mehr berichten, als dass sie in die hinteren Räume gelaufen waren, um Wasser und Verbandszeug zu holen, nachdem ihnen der Nachtwächter und ein Bürger den vermeintlich toten Arbeitsmann auf die Treppen zu ihrem Kohlenladen gelegt hatten.
»Als wa dann wieda vorne waren, da war der Tote verschwunden.«
Unverrichteter Dinge und leise vor sich hin fluchend, kehrten Werpel und Krause nun zur Stadtvogtei am Molkenmarkt zurück. Und wer wartete da auf sie? Ferdinand Dünnebier! Mit einem riesigen Verband um den Kopf.
»Biste nu als Tota hier oda als Lebenda?«, rief Krause.
»Als Sultan«, antwortete Dünnebier und zeigte auf seinen Turban. »Ick dachte ma, ick melde mir nach allet, wat jestern Nacht passiert is.«
Werpel nickte. »Da sind Sie uns in der Tat eine längere Erklärung schuldig.«
»Na, lang isse nich, aber klar wie Kloßbrühe. Ick bin nich jestürzt, et hat mir wirklich eena niederjeschlagn. Ick war wohl ooch ’ne Weile weg. Als ick dann wieda zu mir jekommn bin, da dachte ick, bloß weg von hier, und bin ab zu’m Freund von mir, dem Liepe.«
»Wer ist Liepe?«
»Gottlieb Letschinski.« Mit dem habe er sich neulich um die schöne Auguste geprügelt, Auguste Gärtner, aber man habe sich längst schon wieder versöhnt. »Sie wissen doch, Herr Commissarius: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.«
»Nun ja …« Werpel mochte dem nicht widersprechen.
»Aber was meinen Sie denn nun, wer Sie in der Nikolaikirchgasse niedergeschlagen hat?«
Da war Dünnebier um eine Antwort nicht verlegen.
»Ick vamute mal, det det der Auguste ihr Bräutigam jewesen is.«
»Und wer ist das?«
»Der Watzlawiak is det, der Franz. Den finden Se bei Borsig draußen in’t Feuerland.«