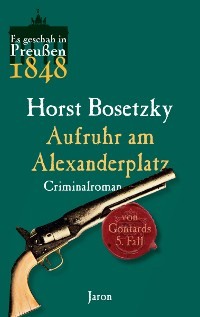Kitabı oku: «Aufruhr am Alexanderplatz», sayfa 3
Fünf
Ein Feuerland gab es 1848 nicht nur am südlichen Ende Südamerikas, sondern auch am nördlichen Rande Berlins, gleich vor dem Oranienburger Thor. Zuerst wurde hier 1804 die Königlich Preußische Eisengießerei in Betrieb genommen, dann hatten sich etliche Fabrikherren mit ihren Eisengießereien und Maschinenbauanstalten niedergelassen, so Franz Anton Egells (1826), August Borsig (1837), Friedrich Adolf Pflug (1839) und Johann Friedrich Ludwig Wöhlert (1842). Inzwischen zählte das Handelsministerium 33 Firmen mit über dreitausend Beschäftigten im Feuerland. Da alle Betriebe für ihre Produktion Eisen schmelzen, gießen oder bis zur Glut erhitzen mussten, brannten überall Feuer und aus unzähligen Schornsteinen stiegen Rauchschwaden in den Himmel, so dass im erfindungsreichen Berliner Volksmund das Areal bald den Namen Feuerland bekam.
Der König vom Feuerland war eindeutig August Borsig, geboren 1804 in Breslau und 1823 nach Berlin gekommen. Begonnen hatte sein Aufstieg mit der Produktion von Kleineisenteilen für den Gleisbau, dann hatte er englische und amerikanische Lokomotiven repariert, und schließlich baute er selbst welche. 1841 hatte die Borsig 1 auf der Strecke Berlin—Jüterbog eine Wettfahrt gegen eine Maschine des großen George Stephenson gewonnen, und schon 1846 war Borsigs hundertste Lokomotive aus der Halle gerollt. Wer bei Borsig arbeitete, war stolz darauf und rief gerne aus: »Ich bin kein Proletarier, ich bin Maschinenbauer!«
Einer dieser Maschinenbauer war Franz Watzlawiak. Er bediente eine der Drehbänke, an denen die Pleuelstangen der berühmten Borsig’schen »Schnellläufer«-Lokomotiven entstanden. Ringsum kreischten die Bohrer, dröhnten die Schmiedehämmer, in den Werkstätten nebenan flackerten die Schmelzöfen. Schlagartig aber brachen die Geräusche ab, als einer der Meister »Feierabend!« gerufen hatte. Es war Sonnabend, und ein jeder strebte voller Vorfreude auf das Wochenende seiner Wohnstatt entgegen. Watzlawiak hatte sich bei der Witwe Grimnitz in der Linienstraße eingemietet und eilte nun mit einer Geschwindigkeit durch das Oranienburger Thor, die die Wache denken ließ, hier sei ein Verbrecher auf der Flucht. Ein kleines Stück ging es die Friedrichstraße entlang, dann musste er nach links in die Linienstraße abbiegen. Die zog sich ewig an der nördlichen Berliner Peripherie entlang, erst hinter der Alten Schönhauser Straße war er am Ziel. Nur schnell aus den alten Klamotten raus, die er bei der Arbeit trug, sich waschen, etwas Anständiges anziehen, und dann ab zu Auguste. Er liebte es, sich als ganzer Mann zu geben, und so stand er auch Ende Februar an der Pumpe unten im Innenhof, die vor ein paar Tagen noch eingefroren war, und ließ sich das eiskalte Wasser über den nackten Oberkörper rinnen.
Über ihm wurde das Fenster aufgerissen, und die Witwe Grimnitz oben am Fenster begann zu zetern. »Sie, det is unschickllich!«
Watzlawiak lachte. »Sie müssen ja nicht hingucken. Weg vom Fenster, gleich wasche ich mich in den unteren Regionen!«
Das wagte er natürlich nicht, dennoch kreischte die Grimnitz und drohte wieder einmal, ihm zu kündigen. Er war sich aber sicher, dass sie ihre Drohung nicht wahr machen würde, denn er hatte den Ruf, ein gewalttätiger Mensch zu sein. Und darauf war er auch stolz. Als er mit seiner Wäsche fertig war, nahm er dennoch eine Rose aus Papier, die er bei einem Maskenball erbeutet hatte, und trat an, sich bei ihr zu entschuldigen.
Sie rollte mit den Augen. »Ihnen kann man auf Dauer nich böse sein …« Seufzend nahm sie die Papierblume entgegen und gestattete ihm sogar, in ihrer Vossischen zu blättern und nachzuschauen, was Berlin am 19. Februar 1848 an Amüsements im Angebot hatte. Es war eine Menge.
Im Königlichen Schauspielhaus gab es ein Lustspiel von Gustav zu Putlitz mit dem langweilig klingenden Titel Ein Hausmittel. Nein, das war nichts für seine Auguste. Eher wäre sie noch ins Königsstädtische Theater gegangen, wo die Compagnia Italiana gastierte, aber da fiel die angekündigte Oper wegen einer Unpässlichkeit der Signora Fodor heute aus. Schade.
Groß waren die Programme der Circusse angekündigt, zum Beispiel:
Circus von Alessandro Guerra
Große Damen-Vorstellung mit neuen Abwechselungen
Zum Schluß: Grand Steeple chase, geritten von 8 Damen der Gesellschaft
Anfang: 7 Uhr abends
Das klang nicht schlecht, aber wie immer war Watzlawiak knapp bei Kasse, und beim Kauf zweier Eintrittskarten hätte er sich wieder etwas von der Witwe Grimnitz borgen müssen. Ausgeschlossen! Weiter im Text. Einige Etablissements priesen Interessantes an. Nicht ganz klug wurde er aus dem, was die Erste Corso-Halle zu bieten hatte: Fortsetzung der eingeübten fahrenden Bedienung, wobei Prell’sches Bier in neuem Costüm verabreicht wird. Kamen da die Serviererinnen mit einer Draisine an die Tische? Kroll’s Garten kündigte für sieben Uhr abends schon den vorletzten Bal Masqué an: Der Königl. Tänzer Hr. Sergeois leitet die Tanzordnung. Die Herren Noack und Hoffmann werden eine vollständige Maskengarderobe aufgestellt haben. Angelangt bei Krumhorn’s Caffeehaus, bekam er das große Gähnen: Große Abendunterhaltung mit Gesang. Launige Vorträge von dem jetzt mit vielem Beifall aufgenommenen Herrn von Bergen nebst Kapelle. Das Maaß’sche Lokal und Sommer’s Salon boten auch nichts Aufregendes. So blieben für Auguste und ihn nur noch zwei Attraktionen:
Bude auf dem Alexanderplatz
Die 7 Wunder der Welt in sieben Bildern
5 großartige Gemälde von J. Lera
Die außerordentliche Naturerscheinung, ein 15 Jahr altes, lebendes Mädchen, welchem Theile eines zweiten Kindes angewachsen sind
Eldorado (Thorstraße 12)
Grand Bal masqué et paré
Nach der Pause: Bohnenfest: die Königin des Festes erhält ein werthvolles Geschenk
Anfang: 8 Uhr abends
Mit diesen Programmen im Kopf machte er sich auf den Weg zum Randersacker’schen Palais, um Auguste abzuholen. Es war ein gewaltiger Fußmarsch bis zur Wilhelmstraße, aber um sie in den Armen zu halten, wäre er auch bis ans Ende der Welt gelaufen. Über die Prenzlauer Straße kam er zum Alexanderplatz, dann ging es die Königstraße entlang zum Schloßplatz, weiter über den Werderschen Markt und den Hausvogteiplatz zur Mohrenstraße und schließlich in die Wilhelmstraße. Auch einem Kraftprotz wie ihm ging da die Puste aus.
»Da biste ja endlich!« Auguste hatte schon eine Viertelstunde auf ihn gewartet.
»Tut mir leid.« Er umarmte sie. Dabei streifte sein Blick die Fassade des Palais, und er sah Randersacker am offenen Fenster stehen. »Der lässt dich wohl nicht mehr aus den Augen …«
»Wer?«
»Na, dein Brötchengeber. Aber wenn er dir zu nahe treten sollte, findet er sich auf ’m Friedhof wieda, sag ihm dit!«
Auguste verfluchte die Eifersucht ihres Verlobten einerseits. Andererseits freute sie sich über die Morddrohungen, die er gegenüber allen ausstieß, die als Nebenbuhler in Frage kamen, waren sie doch ein Zeichen dafür, wie heiß und innig er sie liebte.
Paul Quappe, im Dienstgebrauch nur Kaulquappe genannt, teilte das Schicksal der Offiziersburschen, die es wie er nicht bis zum Gefreiten gebracht hatten: Er war Offizieren aller Dienstgrade, Militärärzten und Zahlmeistern zur persönlichen Bedienung zugewiesen. Quappe war im Jahre des Herrn 1828 auf die Welt gekommen.
Wenn er nach seinem Alter gefragt wurde, musste er jedes Mal mühsam nachrechen. Noch größere Probleme als mit Zahlen hatte er jedoch mit dem Schreiben und Lesen. Um das zu verbergen, hatte er eine Reihe von Techniken und Tricks entwickelt – und war dadurch ein recht schlaues Kerlchen geworden, viel schlauer, als ihn alle einschätzten. Schnell hatte er herausgefunden, dass er viel leichter durchs Leben kam, wenn er sich dumm stellte. Schwierige und kraftraubende Arbeiten wurden dann anderen übertragen. Außerdem brauchten die Preußen, insbesondere die Autoritäten, ihren Hofnarren. Wer andere zum Lachen brachte, war beliebt und konnte viele Vergünstigungen erwarten. Hätte Quappe ein paar Jahrzehnte später gelebt, dann hätte man ihn mit dem von Jaroslav Hašek ersonnenen braven Soldaten Schwejk vergleichen können. Mit dem tschechischen Bruder im Geiste hatte er nicht nur die Freude am exzessiven Erzählen von Anekdoten gemein. Sollte sich Schwejk der Einberufung dadurch zu entziehen versuchen, dass er im Rollstuhl zur Musterung erschien, so hatte Quappe den Ärzten einen Epileptiker vorgespielt – allerdings mit demselben Misserfolg wie der brave Soldat.
Quappe hatte zwei linke Hände, und wo er war, da war das Chaos. Dazu kam, dass man ihm als Kind zu viel von Till Eulenspiegel vorgelesen hatte und er seither danach trachtete, es dem großen Schalksnarren gleichzutun. Schon der Ort seiner Geburt war außergewöhnlich, wenigstens dem Namen nach: Schönschornstein. Das war ein Weiler südlich von Erkner, umfangen von der dort mäandernden Spree, die vor Köpenick und dem Zusammenfluss mit der Dahme kaum breiter war als ein Bach.
Abgesehen von der Leidenschaft für Streiche verband ihn noch ein besonderes Tauferlebnis mit Till Eulenspiegel: Auch seine Amme, die ihn im Anschluss an die Feier nach Hause trug, fiel mit ihm – ein wenig trunken, wie sie war – stracks ins Wasser, als man einen Kahn besteigen wollte. Die Quappes waren nämlich eine alte Schifferfamilie. »Nun ratet mal alle, ob ich damals ertrunken bin oder noch gerettet werden konnte«, sollte Quappe später immer wieder sagen. Mit Spreewasser war Paul Quappe also getauft – und vielleicht hatte der Pfarrer beim Schöpfen des Taufwassers wirklich eine Kaulquappe mit aus dem Fluss geholt, wie man schon in Erkner gespottet hatte, wo Quappe zur Schule gegangen war.
1842 hatte Paul Quappe in Frankfurt an der Oder beim Leib-Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm III. seine militärische Laufbahn begonnen – und war seitdem weitergereicht worden wie die berühmte heiße Kartoffel. Ende Januar 1848 war er dem preußischen Kriegsminister Ferdinand von Rohr als Bursche zugeteilt worden.
Ferdinand von Rohr saß in seinem Dienstzimmer im preußischen Kriegsministerium, Leipziger Straße No. 5–7, zwischen Wilhelmstraße und Pariser Platz, und quälte sich durch die ihm vorgelegten Akten. Endlos erschien ihm auch dieser Tag. Das Atmen fiel ihm immer schwerer. In der Schlacht bei Bautzen, 1813, hatte er einen Schuss in die Brust bekommen, und seitdem war seine Lunge spürbar geschwächt. Er schloss die Augen und versuchte, Bilder seiner Kindheit herbeizuzaubern. Die Domkirche St. Peter und Paul … der Roland … das Baden im Fluss … Am 17. Mai 1783 war er in Brandenburg an der Havel geboren worden. Mit vierzehn Jahren hatte er den Dienst beim Infanterieregiment Herzog von Braunschweig begonnen. Dann war Napoleon über Preußen hergefallen. Als Grenadieroffizier hatte Ferdinand von Rohr die Schmach von Jena und Auerstedt miterlebt und war danach als Hauptmann in den Stab des Generals von Yorck gekommen. Bei Halle und bei Großgörschen war er in die Schlacht gegen den Franzosenkaiser gezogen, bei Bautzen war dann Schluss gewesen.
Er hörte einen Schuss und fuhr hoch. Nein, die Ordonanz hatte gegen die Tür geklopft, nichts weiter. »Ja, herein!«
Draußen stünde ein entfernter Verwandter von ihm, ein Herr Leopold von Rohr.
»Ja, soll reinkommen.«
Wer eintrat, war sein Cousin Leopold. Sie hatten sich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, und so gab es mancherlei zu erzählen.
»Ich war erst Regierungsdirektor in Stettin und später Regierungspräsident in Stralsund«, berichtete Leopold von Rohr. »1833 bin ich dann in den Ruhestand getreten und nach Berlin gezogen. Seitdem verfasse ich Gedichte.«
»Ich habe davon gehört«, versicherte der Kriegsminister.
»Und du?«
Ferdinand von Rohr überlegte. »Du wirst wissen, dass ich schon einmal im Kriegsministerium gewesen bin: 1813 als Major und als Leiter der Bekleidungsabteilung. Schrecklich! Ich wollte wieder zurück in die Kaserne. Da war ich dann erst beim Alexander-Regiment hier in Berlin und dann in Glogau, wo ich eine neue Art der Ausbildung ins Leben gerufen habe: keine mechanische Dressur mehr, sondern eine Erziehung mit Verständnis für die Rekruten, auf dass sich alle ihre geistigen und körperlichen Kräfte voll entfalten können.«
»Davon wiederum habe ich gehört«, warf nun auch der Vetter ein.
»Von Glogau bin ich dann nach Breslau gegangen … Aber da haben meine Kräfte schon erheblich nachgelassen – und ich habe den Antrag gestellt, in den Ruhestand treten zu dürfen. Und was passiert? Man ernennt mich am 7. Oktober letzten Jahres zum Kriegsminister.«
Die Ordonanz klopfte abermals, bat um Entschuldigung und drängte den Minister, ein vorbereitetes Schreiben auf den Weg zu bringen. »Die Sache Randersacker.«
»Ich habe das Schriftstück schon unterschrieben. Der Quappe soll es sofort nehmen und hinbringen.«
»Sehr wohl!«
Paul Quappe eilte mit dem gesiegelten Kuvert zur Wilhelmstraße. Wo das Randersacker’sche Palais zu finden war, wusste er. Weit war es nicht. Nur ein paar Minuten, aber Zeit genug, sich einen jener kleinen Scherze auszudenken, für die er bekannt und gefürchtet war.
Als er am Dienstboteneingang des Palais am Klingelzug riss, öffnete ihm ein Dienstmädchen.
»Ick hab hier wat vom Kriegsminister Herrn von Rohr.« Damit reichte er dem Mädchen das Schreiben aus der Leipziger Straße. »Aba bitte nich den Boten umbringen, der die schlechte Nachricht übabringt!«
»Wat isset denn?«
»Herr von Randersacker is vom Könich rausjeschmissen worn und soll wejen Hochverrat vors Jericht.«
»Det is ja entsetzlich!«
»Ja, mehr als det.«
Sechs
Der Hausvogteiplatz gehörte nicht zu den beliebtesten Orten der preußischen Residenz. Das lag weniger an dem Namen, den er vordem getragen hatte: Schinkenplatz, benannt nach dem hier verkauften Fleisch wie auch den »unehrbaren Frauen«, die an dieser Stelle ihr Quartier hatten, den »Schinken«
– ein Begriff, der sich vom jiddischen Schickse ableitete. Vielmehr war ein ganz bestimmtes Gebäude an der Ostseite der Grund für die Unbeliebtheit des Platzes: das Hausvogtei-Gefängnis. Dies war die Haftanstalt für Personen, die der Hofgerichtsbarkeit unterstanden, also Bedienstete und Handwerker des königlichen Hofes, für die Bewohner des Stadtteils Friedrichswerder sowie für die Berliner Juden. Besonders in der Zeit der sogenannten Demagogenverfolgung hatten die Berliner einen mächtigen Bammel vor der Hausvogtei und reimten: »Wer die Wahrheit weiß und saget sie frei, / der kommt in Berlin in die Hausvogtei.”
Auch Criminal-Commissarius Werpel liebte diesen Ort nicht besonders, nichtsdestoweniger musste er ihn mehrmals in der Woche aufsuchen, um Delinquenten zu vernehmen. Am späten Abend des 19. Februar 1848 hatte man ihm gemeldet, ein gefährliches Subjekt namens Franz Watzlawiak sei gerade dort eingeliefert worden, arretiert nach einer heftigen Schlägerei auf dem Alexanderplatz.
Werpel arbeitete sich langsam durch die Gänge und Räume. Auf hölzernen Bänken lagen Männer in den seltsamsten Stellungen und schliefen ihren Rausch aus. Einige waren sogar auf den Boden gefallen, ohne es zu bemerken. Andere irrten umher und hatten noch nicht begriffen, wo sie sich befanden. Ein hünenhaft gebauter junger Mann randalierte, sprach von einem Irrtum der Behörden und forderte im Namen Gottes und des Königs seine Freilassung.
Der Aufseher, ein alter Soldat, zog an seiner Pfeife und suchte den Mann zu beruhigen. »Nu schlafen Se endlich! Morjen is ooch noch ’n Tag.«
»Geben Sie mir eine Pistole, ich will mich erschießen!«
»Vorsicht, junger Mann! Wenn eena droht sich umzubringen, kommta inne Zwangsjacke.«
Werpel schob sich zwischen die beiden. »Bist du der Watzlawiak?«
»Ja – warum?«
»Weil du …« Werpel wurde nun etwas amtlicher. »Watzlawiak, Sie werden gesucht wegen versuchten Totschlags, womöglich sogar wegen Mordes.«
»Det ick nich lache! Wer sagt denn det?«
»Ferdinand Dünnebier. Das ist der Mann, den Sie in der Nikolaikirchgasse ins Jenseits schicken wollten, weil er versucht hat, Ihnen eine gewisse Auguste Gärtner abspenstig zu machen.«
»Det is doch Kokolores, Herr Commissarius! Der Dünnebier, diese Nappsülze, kann doch bei meine Juste nie und nimmer wat ausrichten.«
»Und wenn seine Avancen doch erfolgreich waren?
Sie sehen offenbar sofort rot, wenn jemand Ihrer Braut schöne Augen macht, und schlagen blind auf ihn ein, wie gestern da an der Bude auf dem Alex.«
Je erregter Watzlawiak wurde, desto mehr verfiel er nicht nur ins Berlinische, sondern desto ausfallender wurde er auch. »Det war der Liepe, dieset Arschloch, und der hat der Juste anne Brust jefasst!«
Werpel hatte genug gehört. Er holte seine Kladde heraus und notierte:
Dem Watzlawiak ist eine Bluttat durchaus zuzutrauen. Nicht laufen lassen, unbedingt vors Gericht bringen!
Der Kalender zeigte den 2. März 1848 an, einen Donnerstag. Es war für Christian Philipp von Gontard und seinen Freund Friedrich Kußmaul zum Ritual geworden, sich zur Mittagszeit im Café Stehely zu treffen. Gontard hatte dann seine ersten Vorlesungen hinter sich, Kußmaul die Vormittagssprechstunde, und sie genossen es, sich im Café über Weltpolitisches, Berlinisches und Privates auszutauschen.
»Du kennst doch den Randersacker persönlich«, begann Kußmaul. »Hast du gehört, was dem passiert ist?«
Gontard nickte. »Selbstredend.« In den Zeitungen war zu lesen gewesen, dass sich aus der Waffe Randersackers versehentlich ein Schuss gelöst hatte, als er bei einem geheimen Treffen mit einem portugiesischen General im Hotel »König von Portugal« gewesen sei. Es habe aber keine Verletzten gegeben.
»Man sollte diesem Menschen den Umgang mit Schusswaffen strikt untersagen«, fand Kußmaul, »gleichviel, ob es nun Kanonen oder Pistolen sind.«
»Na, wenigstens hat es diesmal keine Toten gegeben«, stellte Gontard fest, »anders als damals in Altenrath, als die arme Marie Engels starb.«
»Was gibt’s ansonsten Neues?«, fragte Kußmaul und blätterte in der Staats-Zeitung.
»Gestern haben sie über die Pariser Revolution berichtet«, sagte Gontard. Die war derzeit bei den gebildeten Schichten Preußens das Thema Nummer eins. Am 21. Februar hatte es in Paris die ersten öffentlichen Proteste gegeben, am 23. und am 24. Februar waren Straßen und Barrikadenkämpfe zwischen den Aufständischen und den königlichen Truppen gefolgt. König Louis Philippe hatte abgedankt und war nach England geflohen, man hatte die Republik ausgerufen. Die Revolutionsregierung hatte dem Volk die Pressefreiheit, das allgemeine Wahlrecht, die Abschaffung der Todesstrafe für politische Delikte und ein Recht auf Arbeit versprochen.
»Diese Rechte würden auch Preußen gut zu Gesicht stehen«, murmelte Gontard, nachdem er sie aufgezählt hatte.
Kußmaul nickte. »Du hast recht. Man munkelt schon, dass unsere Regierung Frankreich den Krieg erklären will, um diese revolutionären Umtriebe zu unterbinden.«
»Psst!«, machte Gontard schnell und legte den Finger auf den Mund, denn soeben war Dr. Joel Jacoby eingetreten, ein Agent des Innenministeriums. Jacoby trat in immer neuen Verkleidungen auf und sollte herausfinden, was man im Volk redete. Seine Berichte gingen direkt an den Polizeipräsidenten Julius von Minutoli.
Gontard und Kußmaul redeten über Unverfängliches, bis Jacoby außer Reichweite war. Dann kam Gontard wieder auf die Französische Revolution und die möglichen Reaktionen der preußischen Regierung zu sprechen.
»Ich bin gespannt, ob ich nachher mehr erfahren kann«, schloss er.
»Bist du etwa zum Abendmahl beim König eingeladen?«, fragte Kußmaul.
»Nein, aber zu einer kleinen Feier bei unserem lieben General von Pfuel. Der König hat ihn zum Gouverneur von Berlin berufen.«
Kußmaul lachte bitter. »Damit hat Friedrich Wilhelm IV. jemanden, der statt seiner die Soldaten auf die Bürger hetzt, wenn sie es wagen sollten, den Franzosen nachzueifern.«
Gontard schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass das so einer ist.«
Die Pfuels waren ein uraltes Adelsgeschlecht aus dem Barnim und dem Kreis Lebus. Es hieß sogar, ihre Vorfahren seien schon nach der Vertreibung der Wenden im Jahr 926 in der Mark ansässig geworden. Der Besitz der Familie vergrößerte sich von Jahr zu Jahr. Unter den Pfuels gab es nicht nur sehr viele Generäle, sondern auch hohe Staatsbeamte, Kurfürstliche Räte, Doktoren der Rechte und Geistliche.
Das wohl bekannteste Mitglied dieser Familie war der 1779 geborene Ernst von Pfuel. Er hatte den preußischen Angriff bei Waterloo geplant und war schließlich Stadtkommandant von Paris sowie preußischer Gouverneur des Schweizer Kantons Neuenburg geworden. Ernst von Pfuel war nicht nur ein Jugendfreund Heinrich von Kleists, sondern verkehrte auch mit Bettina und Achim von Arnim sowie Karl August und Rahel Varnhagen. Theodor Körner, Gerhard von Scharnhorst, August Neidhardt von Gneisenau und der Freiherr vom Stein gehörten ebenso zu seinem Freundeskreis. Im März 1848 wurde Pfuel zum Gouverneur von Berlin ernannt.
Gontard sprach ihm seine Glückwünsche aus. »Berlin kann sich freuen über einen solchen Gouverneur. Ich bin mir sicher, dass man Sie später wegen Ihrer Amtszeit rühmen wird.«
Pfuel lächelte. »Ich hoffe, dass die Berliner dermaleinst wenigstens eine kleine Straße nach mir benennen werden.«
Die nächste politische Größe, mit der Gontard ins Plaudern kam, war der Polizeipräsident Julius Freiherr von Minutoli, der trotz seines exotischen Namens ein angestammter Berliner war. Er war 1804 an der Spree auf die Welt gekommen. Sein Vater Heinrich von Minotuli war vor allem als Altertumsforscher bekannt geworden und hatte es 1810 sogar zum Erzieher des Prinzen Carl gebracht. Seit Heinrich diese Ehre zuteilgeworden war, hatte er mit seiner Familie im königlichen Palast Unter den Linden gewohnt. Sein Sohn Julius hatte als Kind zu den Spielkameraden des Kronprinzen gehört, und so war es nicht verwunderlich, dass Friedrich Wilhelm IV. ihn 1847 in das hohe Amt des Polizeipräsidenten berufen hatte. Vorher hatte Julius von Minutoli sich in der preußischen Provinz Posen als Regierungs- und Landrat sowie als Polizeidirektor seine Meriten erworben. Auf verschiedenen Dienstreisen hatte er halb Europa und sogar Algerien kennengelernt, er war also alles andere als ein bornierter preußischer Kleingeist. Gontard schätzte ihn auch wegen seiner wissenschaftlichen Schriften und seiner kunstvollen Zeichnungen.
»Nun, mein Lieber«, begann Gontard in einem spöttischen Ton, den er sich Minutoli gegenüber durchaus erlauben durfte, »man hört, dass Sie die Polizei erheblich aufstocken wollen – schon im Hinblick darauf, dass Berlin ein zweites Paris werden könnte …?«
Von Minutoli lachte. »Sie meinen, dass die preußische Residenzstadt bald ebenso viele Gäste wird anlocken können?«
»Nein, ich dachte an eine Februarrevolution.«
»Ich bitte Sie, Gontard, wir sind in Preußen! Außerdem ist der Februar längst vorüber. Nein, im Ernst: Gemessen an unseren vierhunderttausend Seelen, hat Berlin viel zu wenig Polizeibeamte, gerade einmal 27 Kommissarien, gut 40 einsetzbare Sergeanten und etatmäßig 110 Gendarmen, von denen mir aber viele wegen Urlaub, Krankheit sowie Ordonanz- und Patrouillendiensten außerhalb der Stadt gar nicht zur Verfügung stehen. Und die berittenen Gendarmen, Gott, die wohnen weit weg von den Stallungen, und ehe die bei Aufläufen oder Gefahren alle auf ihren Gäulen sitzen, vergehen Stunden.«
Gontard schmunzelte. »Das zu hören dürfte alle revolutionär gestimmten Kräften freuen.«
»Da freuen sie sich aber zu früh, denn wenn mir nicht genügend Polizisten zur Verfügung stehen, dann wird der König das Militär marschieren lassen.« Jetzt wechselte von Minutoli doch lieber das Thema. »Doch kommen wir zurück zu unserer viel zu geringen Personalstärke. Die wird glücklicherweise dadurch gemildert, mein lieber Gontard, dass Sie regelmäßig auf Mörderjagd gehen und mir dadurch mindestens drei Kommissare ersetzten. Darf ich wissen, wessen Fährte Sie gerade verfolgen?«
»Minutoli … Pardon, Herr Polizeipräsident, Sie wissen doch selbst am besten, dass im Augenblick kein Fall anliegt, den der wackere Werpel nicht selber lösen könnte.«
»Nun hindert mich mein hohes Amt leider, Ihnen einen spektakulären Fall zu wünschen, aber … Ich bin gespannt!« Damit verabschiedete er sich von Gontard und wandte sich anderen Gästen zu.
Hinter Gontard stand nun Werpel. »Habe ich nicht eben meinen Namen gehört?«
Gontard gab sich ahnungslos. »Nein, wir haben nur von Goethes Werther gesprochen, da müssen Sie sich verhört haben. Aber sagen Sie, was ist denn aus dem Mann geworden, der den Dienstmann Dünnebier ermorden wollte?«
»Sie meinen diesen Franz Watzlawiak? Der hat wegen einer erneuten Gewalttätigkeit auf dem Alexanderplatz eine Nacht in der Hausvogtei zugebracht, ist aber nach einer Intervention des Fabrikherrn Borsig wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Wir können also hoffen, Herr von Gontard, dass wir bald etwas zu tun bekommen.«
Gontard verbot sich diesen Gedanken. »Hören Sie auf, Werpel! Das ist zutiefst unchristlich.«
»Unchristlich ist, dass in jedem Menschen eine Bestie steckt!«, rief Werpel. »Das hätte unser Gott auch anders einrichten können.«
Gontard nickte zustimmend. »Also wird es in Berlin tausend weitere Morde geben, bevor dieses Jahrhundert zu Ende geht.«
Von wegen Schönschornstein! Der Schornstein auf dem Häuschen des Schiffers Konrad Quappe war alles andere als schön. Der erste Frühlingssturm hatte ihn weithin zum Einsturz gebracht. Aber es lag kein Geld mehr auf dem Grund des irdenen Topfes, den der alte Quappe als Versteck nutzte. Wo hätte das Geld auch herkommen sollen?
Wenn Flüsse, Seen und Kanäle vom Eis bedeckt waren, ruhte die Schifffahrt. Nun aber, in den ersten Märztagen, konnte man schon mal den Schiffsmakler in Erkner fragen, den Gliesche, ob bald Fracht zu erwarten war.
»Kommste mit?«, fragte Konrad Quappe seinen Sohn Paul.
Paul Quappe erzählte mal wieder von den Streichen, die er und seine Kumpane unliebsamen Vorgesetzten gespielt hatten. »In Frankfurt hatten wa einen Lieutenant, der uns fürchterlich jepiesackt hat, und der hatte sich nu ’n neuet Pferd jekooft, ’n Rappen. Janz stolz war a. Und am nächsten Morjen jeht er in Stall rin – keen Rappe mehr da. Nur ’n Schimmel. Wat war passiert? ’n paar von uns hatten sich weiße Farbe besorjt und det Tier die Nacht üba anjestrichen.«
Sein Vater verzog das Gesicht. Ihm war nicht zum Lachen zumute. Dazu ging es ihm derzeit zu schlecht: keine Arbeit, kein Geld, die Frau im letzten Jahr gestorben. »Los, Paul, ab die Post, machen wir uns auf die Socken!«
Es waren, über den Daumen gepeilt, etwas mehr als drei Kilometer bis zum Schiffsmakler. Das schafften sie locker in einer Dreiviertelstunde. Zuerst ging es auf der Neu Zittauer Straße schnurgerade nach Norden, die ersten hundert Meter dicht an der Spree entlang, dann durch Wiesen und Felder. Rechts kam der Karutzsee zum Vorschein. Kurz danach erreichten sie die Stadtgrenze. Erkner machte sich langsam: An der Friedrichstraße reihte sich ein Neubau an den anderen.
»Unsere Friedrichstraße in Berlin is aba doch wat anderet«, fand Paul Quappe. »Allein schon der Bahnhof.«
»Einen Bahnhof haben wir seit ’42 auch«, hielt ihm sein Vater entgegen.
Sie überquerten das Flakenfließ auf einer ansehnlichen steinernen Brücke.
»Hier kommt der ganze Kalk aus Rüdersdorf lang«, erklärte ihm der Vater.
»Ick weeß, Berlin is aus’m Kahn jebaut.«
Sie bogen nun links ab, liefen ein Stückchen am Flakenfließ entlang, das den Dämeritzmit dem Flaken- und dem Kalksee verband, und kamen dann zu der Villa des dicken Schiffsmaklers Gustav Gliesche. Der stand gerade am Gartenzaun und prüfte, ob an seiner Hecke schon das erste Grün zu entdecken war. Dabei gab er sich alle Mühe, Konrad Quappe und seinen Sohn zu ignorieren.
Konrad Quappe hüstelte. »Entschuldigung, Herr Gliesche …«
»Es ist keine Geschäftszeit!«, brummte der Schiffsmakler.
»Ich wollte auch nur höflich darum bitten, dass Sie an mich denken, wenn wieder einmal eine Fracht von Rüdersdorf nach Berlin zu bringen ist.«
»Nich, wenn Se mich nich in Ruhe lassen!«, herrschte Gliesche ihn an. »Ich muss außerdem gleich nach Berlin. Dringende Angelegenheit. Auf Wiedersehen!«
Die Quappes traten den Rückzug an. Paul murmelte, dass er dieses fette Schwein am liebsten abstechen würde.
Sein Vater nahm es zwar gelassener, brauchte aber jetzt einen Doppelkorn. »Komm, Paul, ich hab da in der Stadt meine Quelle.«
1842 hatte die Eisenbahn auf der Strecke Berlin—Frankfurt/Oder ihren Betrieb aufgenommen, wobei für Erkner nur eine einfache Haltestelle abgefallen war. Vier Jahre später aber war die Linie bis nach Breslau verlängert worden, und da Erkner inzwischen so wichtig geworden war, hatte man der Stadt einen richtigen Bahnhof nicht länger verwehren können.
Paul Quappe liebte die neumodischen Eisenbahnen, besonders deren Lokomotiven. Von denen konnte er stundenlang schwärmen. »Die 2’A1-Lokomotive von Borsig für die Anhaltische Bahn hab ick mit eijene Oojen fahren jesehn!«, erzählte er mit leuchtenden Augen. »Das war die erste, die se im Feualand jebaut ham. Mit ’nem Stehkessel noch. Und die Wettfahrt mit dem Stephenson seine Maschine nach Jüterbog, die hat der Borsig ooch jewonnen.« Er blickte seinen Vater bittend an. »Du, könn wa nich noch ’nen kleen Abstecha uffn Bahnhof machen?«
Sein Vater zeigte sich von dieser Idee wenig begeistert.
»Da bist du doch gestern erst gewesen, bei deiner Ankunft.«
»Ich kann ma nich sattsehen an allet, wat mit da Bahn zu tun hat.«
»Na gut, meinetwegen.«
Paul Quappe umarmte seinen Vater, obwohl dem so viel »Gefühlsduselei« eigentlich zuwider war.
Nach nicht einmal zehn Minuten standen sie auf dem Bahnhof und warteten auf einfahrende Züge. Ihre Blicke gingen in Richtung Berlin wie in Richtung Frankfurt an der Oder. Da näherte sich von Fürstenwalde her eine Eisenbahn. Die Fahrgäste, die auf dem Perron standen und warteten, reckten die Hälse.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.