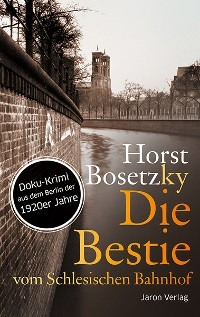Kitabı oku: «Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof», sayfa 3
Fünf
1876 bis 1879
Die Fleischerei Ferdinand Kliefoth hatte einen guten Ruf in Neuruppin, und so konnte eigentlich niemand so recht verstehen, warum der Meister einen solchen Tunichtgut wie Karl Großmann als Lehrling angenommen hatte. Der würde ja jede Kundin abschrecken! Fragte man nach, bekam man aber eine Antwort, die durchaus einleuchtete: »Der ist hart im Nehmen, der Karl, der fällt nicht gleich um wie andere, wenn er mal Blut fließen sieht. Und außerdem soll er ja nicht vorne verkaufen, sondern hinten Wurst machen – und was sonst noch so anliegt.« Darüber äußerte sich der Meister nicht konkreter, was Wunder, war doch damit gemeint, dass er sich von Karl Großmann regelmäßig bedienen ließ. Er genoss es, und seinem Lehrjungen war es nach eigener Aussage völlig egal, wo er sein Ding reinsteckte. Was so aber nicht ganz stimmte, denn abends, wenn er neben Franz auf seinem Strohsack lag, erklärte er, dass er eigentlich nur eins im Sinn habe, nämlich der Meisterin »einen zu verpassen«. Wenn er sie nur sähe, würde ihm schon einer abgehen. Was aber auch nicht die ganze Wahrheit war, denn so richtig kam es ihm erst, wenn er gleichzeitig frisches Blut sah und besser noch schmeckte, und so stellte er sich immer wieder vor, im selben Moment, wo er unten in Dorothea Kliefoth eindrang, ihr oben in den Hals zu stechen, dass das Blut nur so spritzte. Dann presste er seinen Mund auf die Wunde und trank ihr Blut, während er unten rammelte und wartete, bis der Samen aus ihm herausgeschossen kam. Mit diesem Bild schlief er oft ein, und sogar einer wie Franz war entsetzt, als ihm der kleine Bruder eines Abends von seiner Besessenheit erzählte.
»Das kannst du doch der Frau nicht antun.«
Karl verstand den Einwand nicht. »Was geht mich die Frau an?«
»Denk doch mal daran, wenn das einer mit dir machen würde.«
»Ist mir doch egal, was sie mit mir machen. Machen sie’s eben.«
Franz ging es nun pragmatischer an. »Keiner schlachtet doch die Kuh, die ihm Milch geben soll.«
»Versteh’ ich nicht.«
»Na, man muss doch zu den Frauen nett sein, damit man was von ihnen hat. Wenn man sie quält, lassen sie einen doch sitzen und suchen sich ’n anderen.«
»Dann such’ ich mir ’ne andere, es gibt ja genug Fotzen auf der Welt.« Damit drehte Karl sich um und war im Handumdrehen eingeschlafen.
Am nächsten Vormittag war er dann bei Kliefoth mit dem Reinigen von Schweinsdärmen beschäftigt. Das war gar nicht so einfach. Der Meister erklärte es ihm einige Male: »Darm zuerst vom Nicker lösen, dem Darmfett. Anschließend ausleeren, dann umdrehen und reinigen.« Den ersten Darm verschmutzte Karl – und bekam kräftig ein paar hinter die Ohren. Später ging es um einiges besser. Nicht sehr geschickt stellte er sich aber beim Wenden des Dickdarms an. »Der Darm läuft in sich durch«, sagte Kliefoth mehrmals, doch Karl verstand nicht so recht, was damit gemeint war. Schließlich bekam er die Aufgabe, den Speck abzuschwarten, zu schneiden und zu Schmalz auszukochen.
Am Nachmittag durfte er der Meisterin bei der Wurstherstellung helfen. Hüfte an Hüfte standen sie nebeneinander; er fuhr mit der Schöpfkelle in die Schüssel mit der Kochwurst, während sie den Handtrichter hielt, an dem unten die Därme befestigt wurden. Dabei trug Dorothea Kliefoth eine weiße Kittelschürze, die ihr um einige Nummern zu eng war und vorne gewaltig klaffte. Oben gab sie ihre Brüste frei und unten die Innenseiten ihrer Schenkel. In ihrer Größe gab es nur schwer passende Schürzen zu kaufen. Sie schwitzte und stöhnte. So wie seine Mutter immer stöhnte, wenn der Vater sie gebrauchte. Karl Großmann atmete schon schwer, und sein Schwengel war hart wie Holz geworden. Er hielt es nicht mehr aus, er fuhr ihr mit der rechten Hand zwischen die Beine. Sie ließ es geschehen. Ihr fleischfarbener Schlüpfer war feucht. Das kam unerwartet für ihn. Bei seinen Ziegen war das alles anders. »Nun komm schon.« Voller Ungeduld schob sie seine Hand unter ihren Schlüpfer. »Rein mit dem Finger.« Was er sich nicht zweimal sagen ließ. Sie legte sich mit dem Rücken halb auf den Tisch, wo die Schüsseln mit dem Blut und den Innereien standen und warteten. Dann zog sie ihren Schlüpfer so weit zur Seite, dass er freien Blick und Zugang zu ihrer Möse hatte. Er knöpfte sich die Hose auf und wartete, bis sie sich seinen Schwengel gegriffen hatte und nun mit der hohlen Hand auf ihm auf und ab fuhr. Nun quetschte er sich zwischen ihre wulstigen Schenkel, um in sie einzudringen. Als er es geschafft hatte, rammelte er wie wild geworden. Mit jedem Stoß wurde es schmerzhafter, doch es wollte und wollte ihm nicht kommen. Erlöst wurde er erst, als er ihr die Schüssel mit dem Blut über die Brust gegossen hatte. Er schlürfte es, saugte an ihren Nippeln und biss sie in die Halsschlagader. Er war von Sinnen. Jetzt das Messer! Seine rechte Hand angelte nach ihm.
In diesem Augenblick stürmte Kliefoth in den Raum. Als er realisiert hatte, was da in seiner Wurstküche passierte, stürmte er auf Karl Großmann los, schlang seinen Unterarm um dessen Hals, zog ihn von seiner Frau herunter und würgte ihn dabei. Karl Großmann schnappte nach Luft, griff in seiner Not nach dem Messer und stach Kliefoth, voller Panik, erwürgt zu werden, in den Arm. Der schrie auf, ließ ihn los, beschimpfte ihn mit den unflätigsten Ausdrücken und hieß ihn seine Sachen packen. »Raus hier, du elende Drecksau, du! Und wenn du den Leuten erzählst, was hier alles los war, dann kastrier’ ich dich mit meinem schärfsten Rasiermesser. Und außerdem: Dir Drecksack glaubt ja sowieso keiner.«
Zu Hause erzählte Karl Großmann, der Fleischermeister hätte ihn auf die Straße gesetzt, weil er sich zu dämlich angestellt habe und beim Abreißen des Dünndarms vom Nicker der Dreck aufs gute Fleisch gelaufen sei. Daraufhin wurde er von seinem Vater so durchgeprügelt, dass er mehrere Tage lang nicht richtig sitzen konnte. Zudem sperrte man ihn in den Ziegenstall. Da lag er dann auf dem dünnen Stroh, fror erbärmlich und konnte nicht einschlafen. Das einzige, was ihn trösten konnte, war seine Luststange unten am Bauch. Er brauchte nur an die dicke Dorothea Kliefoth oder die Arbeiterinnen in der Tuchfabrik zu denken, und schon hatte er all sein Elend vergessen. Nach 20 Minuten konnte er bereits ein zweites Mal – und so weiter, pausenlos. Franz sagte immer, sie würden reiche Leute werden, wenn er mit dieser seiner Gabe im Zirkus auftreten könnte. Karl war dem Schicksal dafür unendlich dankbar. Was hatte er denn sonst vom Leben?! Das Essen war meistens ein fürchterlicher Fraß, seine Kleidung stammte aus dem Lumpensack seines Vaters, und außer ein paar billigen Murmeln hatte er nie ein Spielzeug gehabt. Eine Freude war für ihn schon, einmal im Monat zu hören, dass der Gendarm seinen Vater für eine Nacht weggesperrt hatte. Weil es da keine Prügel gab.
In der Zwischenzeit, bis sich unten wieder etwas regte, stellte er sich vor, ein Wolf zu sein, der durch Neuruppins Straßen lief, alle Menschen riss, die ihm über den Weg liefen, und sie verspeiste. Aber erst, nachdem er sich an ihrem Blut satt getrunken hatte. In dieser Nacht fiel er über Kliefoth her. Am schönsten aber war es, wenn er sich beides vorstellte: Wie er mit einer Frau rammelte und gleichzeitig der Wolf war. Lehrer Schwill hatte einmal erzählt, dass bei fernen Völkern die Halbgötter in Tiergestalt aufträten, und in solchen Augenblicken war er nicht mehr der kleine hässliche Zickenkarl, sondern einer dieser Halbgötter.
So vergingen die Neuruppiner Jahre. Erst half er eine Weile seinem Vater beim Lumpenhandel, dann schickte man ihn in die Tuchfabrik, wo er die niedrigsten Arbeiten verrichten musste, als da waren: Ausfegen der Arbeitssäle, Reinigung der Toiletten, Heranschaffen von Garnrollen und Putzen der Maschinen. Alle trampelten auf ihm herum, er war der letzte Dreck. Einmal hörte er den Direktor sagen: »Dieser Großmann gehört für mich zum Abschaum der Menschheit.«
Trotzdem ging Karl Großmann gern in die Fabrik, und das lag vor allem an Luise, einer Arbeiterin, die für das Zusammenfalten der Tuchbahnen verantwortlich war. Immer wieder versteckte er sich hinter den Pfeilern und Maschinen, um sie zu beobachten. Bei ihr war alles ganz anders. Sie war nicht wie die anderen Weiber. Er betete Luise an, und wenn er an sie dachte, stellte er sich dabei nie etwas Säuisches vor. So wie sie musste seine Mutter in ihrer Jugend ausgesehen haben. »Gott, der ist verliebt in die!«, rief Franz. Es stimmte wohl, und Karl Großmann bekam eine Ahnung davon, wie das Leben sein konnte. Auch sein konnte. Und er tat alles, um Luise zu gefallen, sorgte dafür, dass seine Kleidung gepflegter aussah, wusch sich jeden Morgen und stand lange vor dem Spiegel, um sich zu kämmen. Einem Nachbarn stahl er sogar eine halb volle Flasche mit Rasierwasser, um wie ein Herr zu duften. Und obwohl er nur drei Jahre lang zur Schule gegangen war, machte er sich daran, Luise einen Liebesbrief zu schreiben. Drei Abende saß er daran.
Werthes Frollein Louise! Ich waage es hiermitt, ihnen näher zu treeten. Jeden Tak seh ich sie bei die Arbeit zu u. schmachte ihnen an. Ich verere ihnen u. kan ihnen glüklich machen. Komen sie doch am Freitag Abent um 8 Uhr bei die Löven Apotheke. Ich warrte da auf ihnen. Mein Härtz schläkt gans wild. Ihr ergebender Karl Großmann.
Der Freitag wurde lang, und die Zeit bis zu seinem ersten Rendezvous wollte nicht vergehen. Zu Hause ging es hoch her. Der Vater war betrunken nach Hause gekommen und wand sich nun mit schrecklichen Krämpfen auf dem Fußboden, schrie dabei wie ein Soldat, der eben einen Bauchschuss erhalten hatte. Erst als die Mutter ihm mehrere Eimer mit kaltem Wasser über den Kopf gegossen hatte, wurde es besser mit ihm. Dafür aber bekam Johanna ihre »Tour«, wie sie das nannten. Zwölf Jahre war sie jetzt. Der Arzt hatte gesagt, sie werde mal eine »Hysterikerin«. Seit sie mit ihrer Schulklasse im Theater gewesen war, gab sie sich immer wie eine Schauspielerin. Sie sprang auf die Ofenbank und spielte ein Mädchen, das nahe daran ist, dem Wahnsinn zu verfallen: »O du mein himmlischer Herrgott, erlöse mich von dem Übel. So schön, wie ich bin, gehöre ich nicht in dieses Haus. Noch bin ich ein Aschenputtel, aber bald kommt der Prinz, der mich heimholt in sein Schloss.«
In diesem Moment wurde laut gegen die Wohnungstür gebummert. »Aufmachen!« An der Stimme erkannte man sofort, wer es war: der Gendarm. Karl wurde in den Flur geschickt, ihm zu öffnen.
»Vater ist doch schon lange zu Hause …«
»Um den geht es heute mal nicht, sondern …« Der überaus korpulente Beamte musste erst einmal die Mütze vom Kopf nehmen, um sich mit Hilfe eines rotgemusterten Taschentuchs den Schweiß von der Stirn zu wischen. »Bei Gustav Kühn ist ein Diebstahl begangen worden. Während der Arbeitszeit hat sich jemand ins Comptoir geschlichen und dort 200 Mark entwendet.«
»Was haben wir damit zu tun?«, fragte Karls Mutter.
»Euer Franz ist zur Tatzeit in der Nähe gesehen worden.«
»Na sicher, wird er. Er arbeitet ja jetzt beim Scherenschleifer Ferch, und die sind überall unterwegs.«
»Nun tu nicht so, Sophie, als hätte er überhaupt nichts auf dem Kerbholz. Wo ist er denn?«
»Auf’m Hof hinten, Holz hacken.«
»Dann hol ihn gefälligst her.«
Sophie Großmann riss das Küchenfenster auf, und kurz darauf erschien Franz, das Beil noch in der Hand. Als der Gendarm das sah, zog er sich ein paar Meter zurück und legte seine Hand demonstrativ auf die Pistolentasche. Wo er, Franz, heute um zwölf Uhr gewesen sei?
Franz tat so, als müsse er lange nachdenken. »Tja … Mit Ferch am Siechenhaus … Aber woher soll ich’n das so genau wissen?«
»Bei Gustav Kühn in der Fabrik warst du nicht zufällig?«
»Was soll ich’n da?«
»Dem Bürovorsteher fehlen 200 Mark aus seinem Pult.«
»Was soll ich mit so viel Geld? Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen: Ich war es nicht.«
»Dann darf ich mich hier mal umsehen?«
»Nur zu, wir haben nichts zu verbergen«, sagte Sophie Großmann.
Der Gendarm begann mit der Hausdurchsuchung. Doch er fand nichts, sosehr er sich auch mühte. Mit einem »Pardon!« ging er schließlich wieder.
Karl hatte die ganze Zeit über wie auf Kohlen gesessen, war aber doch noch fünf Minuten vor acht an der Löwen-Apotheke, um auf Luise zu warten. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie kommen würde. Und richtig, vom Bahnhof her kam sie die Straße herauf. Karl stellte sich auf Zehenspitzen und winkte ihr zu. Da erscholl dicht hinter ihm schallendes Gelächter, und um die Ecke kam ein Schwarm junger Frauen angefegt. Alles Kolleginnen aus der Tuchfabrik, wie er schnell erkannte. Eine trug einen Kartoffelsack in der Hand. Karl Großmann verstand das alles nicht. Und schon hatten ihn die Frauen gepackt und ihm den Sack über den Kopf gestülpt. Sein Inhalt bestand aus Ziegenmist.
»Für Zickenkarl!«, hörte er sie lachen. »Damit keiner mehr sein Gesicht sehen kann. Da erschrickt man sich ja zu Tode.«
»Der wird mir nie wieder einen Brief schreiben.« Das war Luise, seine Angebetete. »Dieses Arschgesicht!«
In diesem Augenblick starb in Karl die letzte Hoffnung, ein Mensch wie jeder andere zu sein, auch ein Mensch. Sogar einer wie sein Vater hatte eine Frau gefunden, doch er bekam ganz sicher keine ab, er war noch schlimmer dran als sein Vater. Nie würde er eine finden, die ihn heiratete. »Doch nicht dieses Arschgesicht!« Alle würden sie das ausrufen. Und dennoch: Er brauchte die Frauen, wollte er leben. Wie ein Vampir das Blut seiner Opfer. Nur eines hielt ihn am Leben: der Samenerguss und die Hoffnung auf ihn. Er lebte recht eigentlich nur, wenn er ejakulierte – und immer nur mit sich selbst zu spielen war auch keine Lösung. Wie aber kam er zu einer Frau, wo doch alle vor ihm davonliefen, wenn sie ihn nur sahen?
»Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt«, erklärte Franz seine neue Strategie. Nett zu den Frauen zu sein, um sie zu halten – davon hielt er schon länger nichts mehr.
Karl stimmte ihm zu. »Ja, wenn sie’s nicht anders wollen.«
»Oder du bezahlst sie. Da gibt es Zehntausende in Deutschland, die machen dir sofort die Beine breit, wenn du nur mit deinen Geldscheinen winkst. Fahr bloß mal nach Berlin.«
»Ich hab’ kein Geld dazu.«
»Ich aber.« Franz führte ihn zu einem Versteck hinten am Predigerwitwenhaus und zog, nachdem er mehrere Backsteine herausgenommen hatte, ein dünnes Geldscheinbündel heraus.
Karl feixte. »Warste also doch bei Gustav Kühn.«
»Die haben genug, die können das verschmerzen.« Franz spielte nun den großen Gönner. »Damit fahren wir beide nach Berlin und verficken das ganze Geld.«
So kam Karl Großmann zum ersten Mal nach Berlin und in die Gegend um den Schlesischen Bahnhof, denn zuerst führte ihn Franz, sein großes Vorbild und ein Halbgott in seinen Augen, in ein Bordell in der Madaistraße. Dort aber fand Karl nicht die erhofften Genüsse, denn die Damen ließen sich bei aller Bereitschaft, auch ausgefallene Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen, nicht mit der ganzen Hand in die Scheide fassen, nicht in den Hals beißen und das Blut aus den Adern saugen – und erst recht nicht mit dem Messer in Bauch und Brüste stechen. Als Karl brutal wurde, kam ein Zuhälter ins Zimmer gestürzt und schlug ihn zusammen. Die Puffmutter schrie, er sei ein perverses Schwein und erteilte ihm Hausverbot.
Der Besuch in Berlin geriet so zu einem ziemlichen Fiasko, und Karl Großmann begriff, dass Geld allein noch lange nicht zum Ziel führte. Jedenfalls nicht, wenn man sich die Frauen im Freudenhaus suchte. Die machten die Sachen nicht mit, von denen er wirklich etwas hatte.
Wieder in Neuruppin, ging er nicht mehr in die Tuchfabrik zurück. Luise jeden Tag vor Augen zu haben, das hielt er nicht aus. Seine Liebe war umgeschlagen in Hass, und immer wieder stellte er sich vor, sie mit einer Wäscheleine zu erdrosseln und dann zu zerstückeln und in den Ruppiner See zu werfen. Nur noch ein Gefühl war in ihm, nur ein Wort dachte er noch: »Rache!« Dass er es nicht tat, war wohl einzig und allein darin begründet, dass Luise seiner Mutter so ähnlich sah.
Nur selten noch half er dem Vater, dem er längst über den Kopf gewachsen war, so dass ihn dessen Ärger über seine Untätigkeit nicht im Geringsten scherte. Er hasste ihn. Warum? Weil er sein Vater war. Für ihn war er der Schuldige: Es gab Millionen Väter auf der Welt, die gute Menschen waren, hohes Ansehen genossen und eine Menge Geld verdienten, und nur er hatte das Pech, dass ihn dieses Scheusal gezeugt hatte. Im Suff. Ihm alles vererbt hatte, was böse war, was schmutzig war, auch sein »Arschgesicht«.
Den ganzen Tag über lungerte Karl Großmann nun in Neuruppin herum. Vormittags streifte er durch die Straßen, um zu sehen, ob sich etwas »finden« oder abschrauben ließ, was er seinem Vater nachher verkaufen konnte. Spezialisiert hatte er sich auch auf etwas abseits gelegene Hühnerställe.
Die Bauersfrauen wunderten sich dann, dass ihre Hennen so schlecht legten, der eine oder andere Gastwirt konnte aber seine Eierspeisen etwas billiger anbieten. Nachmittags stand er am Bahnhof und suchte sich von ankommenden Fahrgästen ein paar Groschen zu erbetteln. Manchmal half er auch beim Auf- oder Abladen, beim Streichen von Zäunen oder Ernten von Kirschen und Äpfeln. Gern hielt er auch in Biergärten und Kneipen Ausschau nach Gläsern, die von den Besuchern nicht gänzlich geleert worden waren, und trank dann die Reste aus, fuhr bei Likörgläsern auch mit der Zunge hinein. Das meiste Geld verdiente er sich, wenn er den Bauern um Neuruppin herum beim Leeren ihrer Jauchegruben half und die stinkende Brühe dann auf die Felder fuhr, um sie dort zu verteilen. Mochte sich jeder andere davor noch so ekeln, ihm machte es nichts aus, schließlich besaß er ja nach der Nebenhöhlenvereiterung, unter der er in seiner Kindheit so gelitten hatte, praktisch keinen Geruchssinn mehr.
Wenn er überhaupt eine Begabung hatte, dann die, mit Freude zu handeln. Etwas zu verhökern und dabei Gewinne zu machen. Und oft musste er an die Berliner Wurstmaxen denken, wie die mit ihrem kleinen Stand beziehungsweise ihrem umgehängten Kessel Lange Wiener, Landjäger oder Jauersche verkauften. Das wäre was für ihn gewesen! Schlug er den Kragen seiner weißen Jacke hoch und zog die Mütze weit hinunter ins Gesicht, dann war sein »Arschgesicht« verdeckt, und die Kunden kauften und kauften. Ja, Träume hatte er schon noch. Aber wie sollte er jemals das Startkapital zusammenbekommen?
»Man müsste seine Würste selber machen, wenn es was bringen soll«, sagte er zu Fritz Schirrmeister, seinem Freund.
»Ich hab’ das ja bei Kliefoth alles gelernt, aber wie soll ich ein Schwein großziehen? Und wo?«
»Am besten, du stichst die dicke Kliefoth ab. Das reicht für ’ne ganze Ladung Würste.«
»Das schmecken die doch.«
Fritz Schirrmeister lachte. »Musst du nur alles vernünftig würzen.«
Die Vorstellung, Menschen zu verwursten, ließ Karl Großmann so schnell nicht wieder los. Ob Schwein, Rind oder Mensch: Fleisch war Fleisch, Blut war Blut.
Die Idee mit dem Wurstkessel beschäftigte ihn weiter. Wenn er nur ein paar hundert Mark gehabt hätte. Er dachte daran, es wie Franz zu machen und das Geld bei Gustav Kühn zu stehlen, doch davon ließ er wieder ab: Die würden jetzt ganz besonders wachsam sein. Und die Tuchfabrik, wo er sich bestens auskannte? Die hatten alles im Tresor, das packte er nicht.
Da kam eines Tages sein Vater jubelnd nach Hause: »Da, seht mal her!« Er hatte in einem alten Mantel, eingenäht im Futter, drei Goldstücke gefunden. Eines gab er seiner Frau, zwei behielt er, um sie zu verstecken und später für den Ankauf eines neuen Fuhrwerks zu verwenden. Wo, verriet er natürlich niemandem. Karl sah das als Geschenk des Himmels und suchte, fühlte er sich unbeobachtet, überall in der Wohnung. In den Matratzen, im Abflussrohr, unter den Dielen, im Ofen, hinter den Türpfosten. Ohne Erfolg. Je länger seine Suche dauerte, um so ungeduldiger und gieriger wurde er – und um so unvorsichtiger. So stieß er eines Tages, als er sich die Speisekammer vorgenommen hatte, den gerade angesetzten Rumtopf vom Regal. Mit einem explosionsartigen Knall zerbrach er am Boden. Und, Karl traute seinen Augen kaum, zwischen den bräunlich gewordenen Apfelstücken, den Erd- und Stachelbeeren, Kirschen und Brombeeren lagen die beiden Goldstücke auf den Dielen.
Schon kniete er am Boden, um sie an sich zu bringen. Da stand aber auch schon der Vater in der Küche. Ein Beil in der Hand.
»Raus hier aus dem Haus, du verkommenes Subjekt! Raus, sonst erschlag’ ich dich auf der Stelle.«