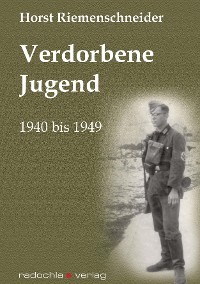Kitabı oku: «Verdorbene Jugend», sayfa 3
Der erste Fliegeralarm
Wir sollten unsere Kleidung so auf unseren Schemeln ablegen, dass wir uns schnell anziehen konnten. Man sagte dazu auch „Päckchen bauen“. Das wurde in der freien Zeit im Lehrlingsheim geübt. Auch Probealarme wurden durchgeführt, wobei es vor allem darum ging, uns im Dunkeln schnell anzuziehen.
Der Heimleiter war mit uns zufrieden. Wir hatten im Heim keine Keller und so auch keine Schutzräume. Dazu war vereinbart, dass wir in die Keller der Einfamilienhäuser gehen könnten, die am Berg über dem Arbeitsdienstlager standen. An der oberen Grenze dieses Lagers war noch ein Tor, von dem aus man über eine etwa 80 Meter breite Wiese in mittlerer Hanglage zu diesen Häusern gelangen konnte. Unsere Baracke stand etwa zehn bis zwölf Meter vom oberen Zaun entfernt, wo es natürlich auch schräg nach oben ging, aber wesentlich steiler als auf der Wiese. Man konnte das eher als eine Böschung betrachten. Dazu kam noch, dass man von der linken Seite aus einen Weg aufgeschüttet hatte, der mindestens mit einem Gespann befahren werden konnte.
Durch dieses Tor sind wir bei schönem Wetter zur Arbeit gegangen. Da war es etwas näher zum Betrieb. Wir konnten einen hinteren Betriebseingang nutzen und so war der Weg nicht zu weit. Für Lehrlinge, die im oberen Betriebsbereich eingesetzt waren, wirkte sich das besonders günstig aus. Doch dazu gehörte ich noch nicht. Bei schönem Wetter deshalb nur, weil der Hang in das Tal bei Heinrichs schlammig und glatt wurde. Da konnte man sich gut die „Klamotten einsauen“. Wenn wir auf der Anhöhe zum Betrieb gingen – wir marschierten da nicht mehr – war es interessant zu sehen, wie sich der Dampf der Lokomotiven bei ruhiger Morgenluft wie eine Perlenkette über den Zug und dann über das Tal streckte. Eine Zeit lang konnten wir auch zusehen, wie ein Flugzeug, eine Dornier II, gegen die Nonnen, einen Holzschädling, Gift versprühte. Das Flugzeug stürzte ab und es kreiste dann kein anderes mehr.
Inzwischen lernten wir unsere Leute vom Luftschutzkeller kennen und es gab ein „Probesitzen“. Die Häuser gehörten zur Lauterbergsiedlung in der auch das Haus meines Onkels Hans stand. Unsere „Kellerhäuser“ standen am Rand des Berges und das Haus von Onkel Hans befand sich am anderen Ende dieser Siedlung. Ich hab mich dort bei Tante Lotte ab und zu einmal sehen lassen. Onkel Hans war ebenfalls eingezogen.
Der Krieg war nun schon über zehn Monate lang und keiner von uns glaubte, dass es einmal in dieser Gegend zu einem Bombenangriff kommen werde, zumal wir nun schon Frankreich besiegt hatten. Doch da ertönten in einer Nacht die Sirenen. Wir verhielten uns wie geübt und saßen dann im zugewiesenen Keller. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Alarm andauerte. Wir waren endlich froh, wieder in unsere Koje zu kommen.
Nach unserem Ermessen war weiter nichts geschehen. Wir hatten uns aber getäuscht. Nicht einmal so sehr weit entfernt von unseren Kellern, aber in Richtung unseres Betriebes, waren drei Bomben eingeschlagen. Erhard Haider, der Heimleiter, schlug uns vor, die Bombentrichter gemeinsam aufzusuchen. Erwartungsvoll ging es los. Zum oberen Tor hinaus gingen wir an den „Kellerhäusern“ vorbei in Richtung Albrechts. Etwa auf der halben Strecke zu diesem Ort bogen wir nach links in die Richtung zu unserem Betrieb ab. Bald sahen wir drei große Löcher, die Bombentrichter. Wir erkannten auch, dass die Bomben fast in den Betrieb gefallen wären. Das abwerfende Flugzeug hatte genau die Richtung zur Mitte des Betriebes gehabt und die Bomben zwei oder drei Zehntelsekunden zu früh ausgelöst. Der letzte Trichter war am Rand des Hanges, der zum Betrieb abfiel. Und der war steil. Wir konnten das alle gar nicht fassen. Keiner von uns hatte ein Flugzeugbrummen oder die Bombeneinschläge gehört. Wir redeten von einem Geisterflugzeug. Später, in den letzten Kriegsmonaten wurde die gesamte Lauterbergsiedlung, wo vor allem Gustloff-Arbeiter wohnten, von Bomben zerstört.
Als ich in den 1980er Jahren einmal kurz dort oben war, fand ich zwar neue Häuser aber nicht die alte Struktur wieder. Tante Lotte war 1942 in das Stadtzentrum von Suhl gezogen.
Eine Fahrradtour
Ich kann nicht genau sagen, ob die Fahrradtour nach dem Städtchen Römhild vor oder nach den Ferien statt fand. Jedenfalls durften alle, die ein Fahrrad besaßen, bei dieser Tour mitfahren, egal in welchem Lehrjahr sie gerade waren. Ich hatte kein Fahrrad und hätte mir auch keines kaufen können. Der Betrieb verkaufte damals noch Fahrräder zum Preis um die 70 bis 80 Reichsmark. An diesen Fahrrädern war die Bezeichnung BSW, was die alte Betriebsbezeichnung war und Berlin-Suhler-Waffenwerk bedeutete. So ein Fahrrad hatte ich mir gewünscht, aber mein Weihnachtsmann hatte kein Geld und verzichten hatte ich inzwischen gelernt.
Bald war auch die Möglichkeit nicht mehr gegeben, ein solches Fahrrad zu erstehen. Doch irgendwie hatte ich herausbekommen, dass bei Tante Lotte ein Damenfahrrad herumstand. Ich ging also dahin und fragte, ob sie mir das leihen würde. Mit zögern und zaudern stimmte sie zu. Sie benötigte es dringender, als zu einer Fahrradtour. Nun konnte ich doch mitfahren.
An dem vorgesehenen Sonnabendnachmittag ging es los. Vor Themar hatte ich einen Platten. Haider beorderte einen zweijährigen Lehrling zu mir, der den Weg kannte und der etwas mehr Ahnung vom Flicken hatte als ich. Die Panne erwischte mich bei der Abfahrt nach Themar. Wir fuhren nicht sehr schnell, denn Haider hielt das Tempo so, dass man gefahrlos anhalten konnte. Als wir in Themar ankamen, wartete noch ein weiterer zweijähriger Lehrling auf uns. Zu dritt ging es dann die Straße in Richtung Römhild hoch. Die Gleichberge, die durch einen Sattel verbunden sind, waren links von unserer Fahrtroute zu sehen. Bald waren wir in Römhild. Unser Ziel war das Kinderheim in dieser Stadt.
Es war wohl so, dass man zwischen beiden Heimen Verbindung hielt. Die Heimkinder hatten dadurch bessere Möglichkeiten, einen guten und gefragten Beruf zu erlernen. Ich erfuhr, dass Robert Kleingünter, unser Stubenältester, auch aus diesem Heim stammte. Geboren war er aber in Österreich.
Das schönste war aber, dass in diesem Heim ein kleines Schwimmbad war. Wir konnten uns nach Herzenslust im Wasser tummeln. Das war die schönste Badegelegenheit die ich jemals hatte. Wir konnten bis zum Dunkeln im Wasser bleiben. Übernachtet haben wir auf einem Dachboden von einem Nebengebäude des Heimes. Früh ging es gleich mit einem kühnen Sprung ins Wasser. Am Nachmittag traten wir die Heimfahrt an, die ohne Probleme vonstatten ging.
Ein lustiges Ereignis
Es ging auf den Herbst zu und im Betrieb kamen Studenten aus Jena zum Einsatz. Man hatte vor, gemeinsam mit den Studenten und den Lehrlingen des Lehrlingsheimes einen Abend zu gestalten. Nun war gefragt, was wir dazu alles beitragen können und wir sollten uns etwas für diesen Abend einfallen lassen. Mit dem Einfallen war das kein Problem, waren wir doch aus sehr vielen Gegenden Deutschlands zusammengewürfelt und viele kannten einen Sketsch oder andere spaßige Dinge.
Nun wurde ausgeknobelt, was man alles anstellen wollte. Es war bekannt, dass der Betriebsberufsschulleiter Dr. Wacker zugegen sein und auch übernachten würde. So war nun vorgesehen, dass einer, der einen Clown spielen sollte, mit Hüsings Luftgewehr über dem dunklen Anzug von Dr. Wacker eine Portion Mehl verschießen sollte. Das sollte die Krönung werden. So war es dann auch. Den Clown spielte der Lehrling Schönfelder, der aus der Sonneberger Ecke stammte. Er hatte dann alles in der Hand und wir hielten uns die Bäuche vor lachen. Der Mehlschuss wurde natürlich vorher ausgetüftelt, bis er so ankam, wie man sich das vorgestellt hatte. Keiner hätte gedacht, dass Schönfelder so etwas drauf hatte. Er sprach so eigenartig, dass man schon darüber lachen musste.
Mit dem Mehlschuss sollte das so dargestellt werden, dass es dem Tell’schen Schuss glich. Schönfelder holte sich dann einfach Dr. Wacker und postierte ihn. Da man nun keinen Apfel zur Verfügung hatte, war ein Käseschachtel aus Pappe dazu auserkoren. Die hat er versucht mit der hohen Kannte auf den Kopf von Dr. Wacker aufzubringen, was natürlich nicht gleich gelang. Das ergab schon allerhand Spaß. Er versuchte das mehrmals mit den entsprechenden Kommentaren. Zuletzt sollte Dr. Wacker die Dose selbst festhalten, was er aber spaßig verweigerte. Schönfelder legte schließlich die Käsedose flach auf den Kopf und schoss nun mit dem erwarteten Erfolg. Das war der Schluss dieses Abends. In der Nacht haben Lehrlinge des dritten Lehrjahres das Gesicht des Dr. Wacker noch mit schwarzer Schuhkreme eingeschmiert, während Wacker in seinem Gästebett schlief. Das wurde vom Heimleiter nicht sehr freundlich aufgenommen.
Die Studenten und Wacker mit Anhang schliefen in einer der Baracken, die unterhalb der Lager- oder Hohen Feldstraße lagen. Dr. Wacker war berüchtigt ob seiner Maulschellen, die er verteilte, wenn etwas nicht ordnungsgemäß oder jemand zu frech war. Die Schläge kamen so schnell, dass man Mühe hatte, das Geschehen zu verfolgen. Klatsch, klatsch und man war bedient. Mir ist es zum Glück nicht passiert. Diese Vorfälle gab es vor allen in oberen Lehrjahren, weil da die Lehrlinge schon frecher waren.
Das Geld
Das Lehrlingsentgelt oder die Lehrbeihilfe gab es monatlich. Halbjährlich wurde es erhöht. Die genauen Summen sind mir entfallen. Es steigerte sich von 13 Komma und zerquetschte im ersten Halbjahr auf 28 Komma und zerquetschte Mark im sechsten Halbjahr. Für die, die noch ein siebtes Halbjahr absolvieren mussten, wie Maschinenbauer und Werkzeugmacher, gab es dann noch einmal einen Aufschlag, wonach es dann über 30 Reichsmark ging.
Das Geld war knapp. Es reichte gerade dazu aus, den Bedarf an Essenmarken zu decken und wenn noch ein Heft, Stift oder Radiergummi gebraucht wurde, sah es schon recht dünn aus. Von den Eltern hatte ich im ersten Lehrjahr nichts zu erwarten, mussten sie doch schon die 35 Mark für das Lehrlingsheim monatlich aufbringen.
Im Betrieb konnte man sich zum Frühstück eine Tasse „Muckefuck“ mit Milch kaufen. Die kostete fünf Pfennige. Selbst diese wenigen Pfennige konnte ich oft nicht aufbringen und bettelte mir von diesem oder jenem Lehrling einen Schluck Kaffee. Das war mir recht peinlich, aber was sollte ich tun, wenn es beim Essen recht trocken wurde im Mund. Die drei Doppelstullen, die mir der Hunger gebot hinunterzuwürgen, benötigten schon ab und zu etwas Nasses. Drei Doppelstullen bekamen wir vom Heim mit. Die waren meist vom Brot von gestern. Also etwas trocken.
Mit dem Geld musste ich aber auch so haushalten, damit ich, wenn ich heimfahren wollte, auch noch das Fahrgeld hatte. Der Kilometer bei der Bahn kostete damals vier Pfennige. Bis Ronneburg waren es rund 150 Kilometer von Suhl. Nach Bürgel war es etwas kürzer, aber da musste ich in Jena auf den Bus umsteigen, wenn ich nicht die siebzehn Kilometer „mit dem Esel“, wie wir die Eisenbahn in Bürgel nannten, fahren und warten wollte. Also sechs Reichsmark und eine Reserve musste ich beisammen haben. Wenn ich daheim war und mein Großvater Josef hatte das mitbekommen, kam er immer heimlich, meist am Sonntag Vormittag, weil ich nachmittags fahren musste, und drückte mir ein paar Mark in die Hand. Das sollte niemand wissen. Er versuchte dabei immer, mich außerhalb unserer Wohnung zu erwischen, damit das auch meine Mutter, seine Tochter, nicht mitbekommen sollte.
Noch einmal zu den Essenmarken, die wir täglich benötigten. Auch am Sonnabend wurde gegessen. Es waren also in einer Woche sechs mal 30 Pfennige aufzubringen. Das waren wöchentlich 1,80 RM und im Monat meistens über acht Reichsmark. Es blieb mir somit im zweiten Halbjahr etwas mehr Geld in meine Kasse.
Die Appelle und die Arbeitszeit
In einer jeden Woche hatten wir zwei Appelle. Einen Wochenanfangsappell und einen Wochenschlussappell. Zu diesen Appellen mussten wir uns in den großen Festsaal begeben. Alle vier Lehrjahre waren dann zugegen. Im 4. Lehrjahr waren jene, die 3 ½ Jahre lernen mussten.
Der Wochenanfangsappell dauerte in der Regel eine halbe Stunde und der Schlussappell eine viertel Stunde. Die Appelle dienten zur Entwicklung und Festigung der nationalsozialistischen Ideologie. So lang wie die Appelle waren, wurde geredet. Einer dieser Redner, der oft auftrat, hieß Weisheit. Seine Reden waren besonders unbeliebt und langweilig.
Für uns war es wichtig, pünktlich beim Appell zu sein. Am Wochenanfangsappell war das weiter kein Problem. Mussten wir sonst fünf Minuten vor Arbeitsbeginn in der Werkstatt sein, wurden wir ebenso fünf Minuten vor Appellbeginn im großen Saal erwartet. Da gab es kein Ausweichen und wenn geschludert, keine Ausrede. Beim Wochenanfangsappell wurde die „Wochenlosung“ bekannt gegeben, die dann in das Werkbuch, auch Berichtsheft genannt, im Kopf eines jeden Wochenblattes eingetragen werden musste. Da ärgerten wir uns über lange Losungen und freuten uns natürlich über kurze.
Mussten wir von der Lehrwerkstatt aus zum Wochenschlussappell, war das kein Problem. Am Sonnabendvormittag, so gegen zehn Uhr, wurde ein großer Teil von uns zum Maschinenputzen in andere Werkstätten beordert. Meistens war das im Werkzeugbau, der in einem großen und neuen Gebäude untergebracht war. Hier mussten wir uns sputen, rechtzeitig fertig zu werden, damit wir unsere Putzgeräte an der betreffenden Werkzeugausgabe abgeben und unsere Werkzeugmarken zurückerhalten konnten. Klappte das nicht so richtig, weil der Werkzeugausgeber gerade nicht zugegen war, konnte es passieren, dass man zum Schlussappell im 100-Meter-Tempo sausen musste.
Es gab zwei unterschiedliche Arbeitszeiten. Für Lehrlinge unter 16 Jahren galt eine wöchentliche Arbeitszeit von 47 ¾ Stunden. Täglich waren das 8 Stunden und 35 Minuten, wobei die Sonnabendszeit vier Stunden und 50 Minuten betrug. War man 16 Jahre geworden, stieg die wöchentliche Arbeitszeit auf 54 Stunden, wobei neun Stunden und 50 Minuten, außer Sonnabends, täglich geleistet werden mussten. Sonnabends wieder vier Stunden und 50 Minuten.
Meine persönliche Arbeitszeit betrug im ersten und im zweiten Lehrjahr bis zum 8. Januar 1942 47 ¾ Stunden. Danach kamen dann die langen Tage, die kein Ende nehmen wollten. Bei der 54-Stundenwoche war am Nachmittag von 15 : 50 bis 16 : 00 eine Vesperpause, bei der man nur am Arbeitsplatz ein paar Krumen hinunter muffelte.
Die Berufsschule im ersten Lehrjahr
Meine Lust zur Schule hatte sich bisher kaum geändert. Besonders „madig“ war es, wenn wir beim Meister Dietz Arbeitstechniken hatten. Ich hatte große Mühe, die Augen offen zu halten.
Ähnlich war es im Fach Technisches Zeichnen. Das hat mir außerdem gleich den Appetit auf den Beruf verdorben, obwohl die Sache an sich interessant war. Alle Zeichnungen mussten wir ohne Lineal ausführen. Und dann noch die Normschrift, eine Druckschrift, die eine vorgeschriebene Schräglage von 75 Grad nach rechts besitzen musste. Das durften wir dann in Hausaufgaben ausgiebig üben. Es gelang uns immer besser, gerade Linien zu ziehen. Das war aber dann auch nicht besonders schwer, weil wir kariertes Papier verwendeten, wo die Linien einen Abstand von fünf Millimetern hatten. Wir sollten das deshalb so lernen, damit wir dann später in einer Werkstatt ordentliche Skizzen anfertigen könnten.
Bis auf den Sport machte mir die Schule keine Freude. Der Sportlehrer nahm uns tüchtig heran. Besonders hart war das Lauftraining. Man merkte aber auch, dass unsere Laufleistungen besser wurden, obwohl das nur zwei Stunden in der Woche waren, an denen wir Sportunterricht und somit Lauftraining hatten. Zum Sportunterricht und zu anderen Gelegenheiten, stand ein großer Sportplatz zur Verfügung und bei schlechtem Wetter oder im Winter eine große Sportbaracke.
Die Leibesübungen, die wir ab und zu kurz während der Arbeitszeit durchführten, absolvierten wir auf einem großen gepflasterten Platz, der seitlich vor dem Sportplatz lag. Der Sportplatz lag außerdem längs im Tal, das die Hasel durchzog und in dem sich auch der Betrieb befand. Zwischen dem Sportplatz und der Hasel war ein hoher Damm aufgeschüttet. Das Flüsschen wurde hinter der am unteren Ende des Sportplatzes liegenden Sportbaracke zur Mitte des Tales geleitet und neben einem Tor verließ es den Betrieb.

Im Sommer gab es ein großes Sportfest, bei dem wir Lehrlinge mit Leibesübungen auftreten sollten. Dazu wurde natürlich tüchtig geübt, vor allem, dass wir Vordermann und Seitenrichtung einhalten konnten. Es gab dafür keine Markierungen. Als wir das fertig brachten und die Übungen ordentlich ausführten, wurde mit der betrieblichen Blaskapelle geübt, bis alles klappte.
Mit „Heizelmännchens Wachparade“ sind wir aufgelaufen, von dem großen gepflasterten Platz kommend, liefen wir erst zur Mitte der diesseitigen Schlackebahn, wo wir dann nach rechts abbogen. Wir liefen eine halbe Stadionrunde und wendeten uns danach zum Spielfeld. Diese Wendung war nahe der Mitte des Platzes, von wo wir uns dann strahlenförmig auf dem Sportfeld verteilten. In der folgenden Woche waren davon Bilder in der Betriebszeitung. Es war jedoch kaum einer von uns zu erkennen. Aber Freude hat es uns gemacht.
Am Schluss fand noch ein Fußballspiel von damals bedeutenden Mannschaften statt. Ich sah das erste Mal in meinem Leben das Spiel zwischen zwei guten Mannschaften. Die Spielernamen Kupfer und Kissinger sind mir noch in Erinnerung. Das Ergebnis nicht.
Die Hauptsache
Wir sollten möglichst viele Arbeitstechniken am Schraubstock erlernen. Die Mädchen und Hüsing sind nach sechs, sowie acht Wochen in andere Abteilungen gekommen. Sie sollten nur einmal die Nase in die Arbeit stecken, damit sie auch Achtung vor dem Mann an der Werkbank oder der Maschine bekommen.
Das hatte man bei uns Technischen Zeichnern ebenfalls vor. Damit wir uns besser die Fertigung eines Werkstückes vorstellen könnten, mussten wir den Grundlehrgang Metall vollständig absolvieren. Zuerst war natürlich das Feilen das Wichtigste. Aber dann kamen andere Dinge an die Reihe, die größtenteils dazwischen erfolgten. Nicht alles ging am Schraubstock. Wenn also ein Platz zum Bohren, Schleifen oder so frei wurde, spannte man das zu bearbeitende Werkstück aus und wechselte an den betreffenden Platz. So haben wir alle möglichen Arbeitstechniken erlernt. Hatte man beim Feilen mit großen Blasen in der rechten Hand zu tun, schlugen wir uns beim Meißeln immer schön auf die Finger der linken Hand oder auf deren Daumen. Wir glaubten erst nicht, dass man beim Meißeln nicht auf den Meißelkopf blicken darf, sondern nur auf die Schneide. Die Lehrausbilder bestätigten uns, dass sie sehen würden, wo wir hinschauen. Bald hatten wir das auch heraus mit dem Meißeln und es ging an andere Techniken.
In unsere eben und winklig gefeilten U-Stähle wurden Löcher in die Stegflächen gebohrt und dann Gewinde hinein geschnitten. Auch das Sägen mit der Handsäge lernten wir, als wir Winkel aussägten, aus denen die Werkzeugmacherlehrlinge später rechte Winkel durch Feilen herstellen mussten. Bestimmte Teile benötigten wir selbst, um dann in dem schon einmal genannten Flachstück, in das ein quadratisches Loch eingebracht war, ein verschiebbares Vierkant einzupassen.
Wir erlernten den Umgang mit dem Reifkloben und vor allem mit dem Feilkloben, mit Hilfe dessen wir von Hand einen Körner wirbeln mussten. Den Reifkloben benutzt man um Fasen zu feilen oder dünneres Material zu sägen. Das Wirbeln ist eine anstrengende Arbeit. Dazu führt man mit einer Hand eine Feile und mit der anderen das runde Werkstück, was auf einem eingekerbten abgebogenen Winkel aufliegt, der in den Schraubstock eingespannt ist.
Bei dem Körner musste erst das Material von zehn Millimeter Durchmesser auf neun Millimeter heruntergewirbelt werden. Dabei war das Werkstück während des Hin- und Herdrehens ein Stück weiter zu drehen. Mit der Schieblehre konnte man kontrollieren, ob man das Werkstück während des Wirbelns gleichmäßig gedreht hatte. War der Durchmesser erreicht, wurde der kegelige Teil zur Körnerspitze hin und auch der kurze Kopfteil mit Fase gewirbelt.
Das Härten erlernten wir etwas später. Wir wurden immer sicherer beim Führen der Werkzeuge. Natürlich war es mitunter hart, mit einer großen Blase in der Hand das Feilenheft zu führen. Da nutzte man jede Gelegenheit, um auszuspannen. Eine gute Gelegenheit dazu war längeres Messen mit der Schieblehre oder das Prüfen mit dem Haarlineal oder dem Winkel.