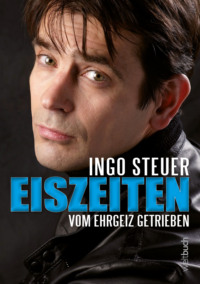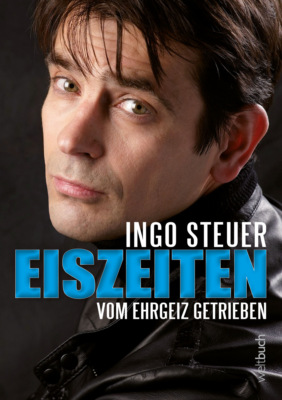Kitabı oku: «Eiszeiten», sayfa 3
Wir hatten in der DDR immer gute Pflichtläufer, Anett Pötzsch war eine von ihnen. Von ihr konnten wir uns viel abschauen, doch für uns war es furchtbar stumpfsinnig! Eine Stunde lang übten wir die Figur „Paragraph“ oder den großen Kreis-Auswärtsdreier. Danach schlängelten wir die Schlinge, heute Rückwärts-Einwärtsschlinge, morgen die Schlangenbogenschlinge. Oh je, wenn ich daran zurückdenke! Und das jeden Tag und für ein paar Stunden, das war schrecklich!
Natürlich haben Nils und ich uns zu diesem Pflichttraining etwas ausgedacht.
Ich weiß nicht, ob es die Pflichtschiene heute überhaupt noch gibt, diese besondere Kufe am Schlittschuh, die nur eine Zacke nach oben, zum Abstoßen besaß. Zum Bremsen war keine Zacke da. Im Gegensatz zur Kürschiene, die Zacken nach unten besaß, um vor dem Springen bremsen zu können. Wir besaßen also verschiedene Trainingsschuhe, Kürschuh und Pflichtschuh. Mit jedem kompletten Paar ließ es sich gut laufen – doch wie wäre es eigentlich, wenn wir mal links den Pflichtschuh und rechts den Kürschuh anlegten? Müsste doch lustig werden, dachten wir, weil man auf diese Art überhaupt nicht laufen, sondern maximal stolpern könnte. Ja, das müsste wirklich sehr, sehr lustig werden! Gedacht, getan, mit verschiedenen Schuhen zum Pflichttraining aufs Eis. Nils wandte sich als Erster an unseren Trainer Peter Meyer. Er käme nicht zurecht, hätte wohl verschiedene Schuhe an! – Nils durfte zum Schuhwechsel in die Kabine. Als ich einige Minuten später mit der gleichen klugen Bemerkung kam, hatte Meyer Lunte gerochen und bemerkte nur, dass ich dieses bedauerliche Missgeschick, diesen unglaublichen Zufall, der auch mir passiert sei, nun leider ausbaden müsse. Na ja, da war ich wieder einmal zweiter Sieger und stolperte bis zum Trainingsende wie ein betrunkener kleiner Bär übers Eis.

Es gab noch eine weitere Möglichkeit, die Pflichtübungen ein wenig zu reduzieren. Bevor wir begannen, unsere Kreise und Schlingen zu laufen, ritzten wir die Übungselemente selbst ins Eis. Mittels eines riesigen Holzzirkels – heute wird dafür ein Zirkel aus Metall genutzt – zeichneten wir sie uns auf die spiegelglatte Fläche.
tc
Später, bei der Pflicht, mussten wir ohne diese Vorgaben dreimal so genau wie möglich die geforderten Figuren nachlaufen.
So manchen Eiskunstläufer machte die Abschaffung der Pflicht bei den Wettkämpfen überglücklich. Für Kati Witt beispielsweise war es wunderbar! Ihr lag die Kür viel mehr. Manche, unter anderem Jan Hoffmann, beherrschten sowohl Kür als auch Pflicht sehr gut.

So nahmen wir das Vorzeichnen mit dem Zirkel sehr genau! Wir mussten schließlich Zeit schinden, fuhren gleich dreimal mit der Zirkelspitze im Kreis herum und ließen uns dabei so viel Zeit wie möglich – bis es den Trainern zu weit ging. Manchmal bestritten Nils und ich nur zu zweit eine solche Einheit und dann ließen wir unter großem Gejohle die Hölzer übers Eis schlittern, bis sie an die gegenüberliegende Bande krachten. Unsere Trainer gönnten uns die Abwechslung; nur wenn es gar zu schlimm wurde, zogen sie uns an den Hörnern.
Dazwischen bestritten wir unser altersgebundenes Aufstiegslaufen in regelmäßigen Wettkämpfen. Wir liefen unsere Pflichtfiguren, um danach die Kür vor der Kommission zu laufen. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der Dresdner Eishalle die Norm meiner Altersklasse erfüllen musste. Meine Eltern kamen später aus Chemnitz hinterher und wurden mit der Frage empfangen, wo denn ihr Sohn stecken würde.
Völlig aufgelöst suchte uns eine Schar Erwachsener. Sie fanden uns in der neben der Halle gelegenen Kiesgrube, glücklich spielend, in völlig verschmierten Küranzügen. Jeder weitere Leistungsbeweis hatte sich an diesem Nachmittag für uns erledigt. Generell gelang es mir immer erst recht spät, die Norm zu erfüllen, da mir die Pflichtaufgaben Probleme bereiteten. Entweder schob ich mich mehr ab, als erlaubt war, oder ich lief die Kreise ungenau, mit meinen Gedanken sonst wo, nur nicht bei den monotonen Übungen. Trotzdem oder gerade deshalb wurde ich mehrere Male Spartakiade-Sieger. Man kann die Spartakiade mit einer Mini-Olympiade im eigenen Land vergleichen. Diese Siege flogen mir mehr oder weniger zu, da ich zu den Älteren meiner Gruppe gehörte, während meine Altersgenossen im Gegensatz zu mir die höhere Normstufe schon erreicht hatten und während der Spartakiade auch mit strengeren Maßstäben gemessen wurden.
Manchmal, wenn wir zum Pflichttraining mussten, stiegen wir absichtlich in den falschen Bus, der uns von der Schule – natürlich ganz aus Versehen – nicht in die Eishalle, sondern in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Jede Minute, die wir uns drücken konnten, war uns ein Gewinn. Auch der Zigarre rauchenden, streng polternden Pförtnerin spielten wir manchen Streich, spuckten einmal sogar durch ihr Pförtnerfensterchen hinein – um am nächsten Tag einen ordentlichen Anpfiff zu erhalten.
Später kamen weniger lustige Geschichten dazu. Trinkfest starteten wir in Trainingslagern durch – was auch immer wir uns da beweisen mussten. Einmal torkelten wir vom Flaschendrehen direkt in einen Swimmingpool hinein; was konnten wir schließlich dafür, dass die Schnapsflasche ausgerechnet immer wieder vor uns zum Stehen kam?
In meiner Erinnerung leuchten diese „schweren Vergehen“ aus dem durchgeplanten Trainingsalltag heraus. Es könnte diese Zeit gewesen sein, in der ich etwas vorsichtiger und schweigsamer wurde. Wie erkläre ich es am besten? Ich war nicht wirklich geschmeidig, tappte in jeden Fettnapf, der zu finden war. Manchen verfehle ich auch heute nicht. Vielleicht isolierte ich mich, von mir selbst unbemerkt, etwas mehr als vorher. Ich zog mich bisweilen gekränkt zurück und schaute von drinnen trotzig auf draußen. Es kann gut sein, dass mich das prägte und ich diese Schwarzer-Peter-Position ein Stück ins Erwachsenenleben mitnahm.
Auf jeden Fall blieben jene heiklen Aktionen nicht unbemerkt, doch man ließ uns gewähren und hatte aus der Entfernung – vielleicht auch ganz aus der Nähe – ein wachsames Auge auf uns. Wir „Goldkufen“ bewegten uns in einem großen Freiraum; was wir auch anstellten, wir liefen an der langen Leine.
Schwierigkeiten
In jedem von uns steckte ja zu dieser Zeit ein Stück Hoffnung, das Land einmal im Eiskunstlauf zu repräsentieren. Unser Erfolg würde mit der positiven Außenwirkung des Landes verschmelzen. Jeder von uns Jungs träumte davon, als Einzelläufer einmal eine olympische Medaille zu erringen. Und der Einzellauf stand für uns klar über dem Paarlauf. Waren wir arrogant? Natürlich waren wir das, wir hatten ja auch keine Ahnung, was das Paarlaufen im Eiskunstlauf bedeutete.
Dann kam es für mich zum großen Knall. Um die beiden Jungen zu trennen, die ständig miteinander stritten oder Unsinn anstellten, überlegten die Trainer zuerst, einen von uns beiden ganz vom Eis zu nehmen. Dann zogen sie in Erwägung, Nils oder mich in den Schnelllauf wechseln zu lassen. Das war nicht unüblich; musste sich jemand vom Kunstlauf verabschieden, wechselte er manchmal in diese Disziplin. Mein Vater arbeitete einige Zeit hobbymäßig als Übungsleiter im Eisschnelllauf. Einmal durfte ich mich im Training dazugesellen und kam wirklich gut zurecht. Doch Schnelllauf kam für mich als Alternative zum Eiskunstlauf ganz und gar nicht infrage, zumal ich ja im Grunde meines Herzens noch immer Einzelläufer war.
Es kam ganz anders. Sie steckten den größeren der beiden, also mich, in den Paarlauf. Auch diese Entscheidung ist nachzuvollziehen, denn der Größere machte mit einer Partnerin nicht nur eine bessere Figur; es galt ja auch zu werfen und zu halten und letzten Endes physikalische Gesetze wie zum Beispiel das Hebelgesetz auszunutzen. Tja, der Größere war nun eben ich.
Ich erinnere mich noch heute an den Moment, in dem ich erfuhr, dass ich aus dem Einzellauf raus sollte. Mehr noch, anfangs sollte meine Zeit auf dem Eis gänzlich vorbei sein. Zu sehr aus der Reihe getanzt, hieß es, zu wenig Disziplin. Zu poltrig, unbedacht und laut. Um Haaresbreite hätte ich mit dem Eiskunstlauf bald nur noch ein schönes Hobby gehabt.
 Fürsprecherin Jutta Müller. (Foto: Wolfgang Thieme)
Fürsprecherin Jutta Müller. (Foto: Wolfgang Thieme)
Nur weil Jutta Müller ganz entschieden intervenierte, durfte ich bleiben – unter der Voraussetzung, dass ich fortan in den Paarlauf wechselte. Und es kann sein, dass nur ihre Fürsprache von damals weite Schatten vorauswarf und mich mit Aljona Savchenko und Robin Szolkowy 2014 nach Sotschi zu Olympia fahren lässt.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass damals überall, wo ich auftauchte, Ärger entstand. Machte ich den Menschen um mich herum wirklich das Leben schwer oder hatte ich irgendwann einfach diesen Ruf weg? Konnten sich andere besser ins Licht setzen und war ich schlicht und ergreifend etwas zu schwerfällig, um den Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen?
Ich redete eben auch immer, wie ich dachte. Letztendlich ist das immer richtig gewesen, denn ging ich zu weit, habe ich dafür eben Dresche gekriegt.
So will ich auch bleiben. Nicht taktieren. Ich bemühe mich, etwas leiser zu werden, denn manchmal komme ich einfach zu laut daher. Dann hole ich erst einmal Luft und suche bessere Worte, um mich oder etwas zu erklären. Die Jahre haben mich hinsichtlich meiner Ansprüche nicht verändert, ich will keine Kompromisse eingehen und an das, was ich erreichen will, keine Zugeständnisse machen. Anderen Menschen aber muss ich meine Ansprüche nicht mehr „überhelfen“. Ich verstehe, wenn sie andere Prioritäten setzen oder ihren Zielen nicht alles unterordnen, so wie ich es tat und teilweise noch immer tue. Dieses Lebensmotto „Alles oder nichts“ muss es meinen Kollegen und meinen Sportlern manchmal sehr schwer gemacht haben, mit mir auszukommen.
Heute verstehe ich vieles besser als früher. Vielleicht, weil ich die halbe Welt durchreist und manchen Menschen getroffen habe, der mich etwas dazulernen ließ. Vielleicht auch, weil ich mitfühle mit dem Ingo von früher, der, sehr jung noch, viel mit sich selbst ausmachen musste.
tc
Zu zweit
Für mich bedeutete es damals fürs Erste, aus dem Einzellauf in den Paarlauf zu wechseln und ein Mädchen an der Seite zu haben. Manuela Landgraf hieß die Zehnjährige, die man für mich ausgesucht hatte, da sie in Körpergewicht, Größe und sportlichem Entwicklungsstand zu mir passen könnte. Mit meinen 14 Jahren durchwanderte ich die Hölle. Ich fühlte mich degradiert. Aus der Traum; der Weltuntergang wäre nicht halb so schlimm gewesen.
An diesem Abend lag ich auf meinem Bett und heulte wie ein Schlosshund. Ich schämte mich, denn der Wechsel in den Paarlauf war für mich ein Abstieg, doch das war nur einer der Gründe.
Die Trainingsgruppe war mein zweites Zuhause. In diesem sozialen Umfeld wuchs ich heran, feierte meinen 10., 12. und 14. Geburtstag. In dieser Gruppe übte ich, mich zu anderen ins Verhältnis zu setzen, denn hier spielte sich meine gesamte Freizeit ab. Ich agierte zwischen Bande und Umkleidekabine, zwischen Trainergespräch und Trainingslager. Mitten unter all diesen jungen Spunden begann ich zu verstehen und zu begreifen, dass wirkliche Freude immer mit einem Sieg über sich selbst zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man den ersten doppelten oder dreifachen Sprung gestanden hat.
Wenn einer den Sprung am Anfang der Trainingsstunde stand, dann wollte der andere das auch können und übte so lange und so intensiv, bis er am Ende der Stunde den Sprung auch draufhatte. Sobald jemand etwas besser beherrschte als der andere, distanzierte er sich von der Gruppe und das Gemeinschaftsgefühl, der Spaß verlor sich für den Moment. Unsere Trainer meinten, auf dem Eis gebe es keine Freundschaft. Uns war nicht klar, was damit gemeint war. Das war es, war einer besser, wollte der andere nachziehen. Mit zehn Jahren stand ich den dreifachen „Salchow“, mit elf stand ich den dreifachen „Toeloop“ und mit zwölf stand ich den ersten „Axel“. Ich lernte, Sprünge so lange zu wiederholen, bis ich den richtigen Dreh raushatte. Den Rittberger mochte ich, der lag mir. Der dreifache „Lutz“ fiel mir hingegen schwer. Das ist ein Kantensprung, der von der Rückwärts-Auswärtskante gesprungen wird und mit dem ich nie richtig warm geworden bin. Ich musste ihn immer mehr üben als die anderen.
Im Training begriff ich, dass Enttäuschungen zum Leben dazugehören und dass das nicht das Schlimmste ist. Und, obwohl ich manchmal danebenlag, schätzte und achtete ich meine Übungsleiter, wenn mir auch nicht jeder ans Herz wuchs – wie auch ich nicht jedem gleichermaßen sympathisch wurde. Aber ich begriff, dass jeder seinen Teil zum Ganzen zu leisten hatte.
In der großen Eismanege mussten Sportler, Trainer, technische Mitarbeiter und die Frauen in der Verwaltung einen guten Job machen. Wer nicht zuverlässig war, hatte in diesem Team nichts verloren. So wurde den Damen in der Verwaltung ebenso Respekt entgegengebracht wie dem Masseur.
Wir lernten, dass wir unseren Mädchen die Taschen zu tragen hatten. Wir hielten ihnen die Tür auf und halfen ihnen in die Jacken. „Kinderstube“ sagt man wohl dazu. Das Wort klingt altmodisch, ich weiß. Und ich fühle mich selbst nicht alt genug, um zu lamentieren, aber wir lernten in diesen Jahren, uns zu benehmen. Im Sport kann einer ohne den anderen nicht sein und immer steht das Team über dem Einzelnen. Doch jeder Sportler träumt von olympischem Gold, beäugt die Fortschritte der Trainingskameraden und schielt manchmal nach dem kleinen Vorteil für sich selbst. In diesem Spannungsfeld wuchsen wir heran, Freunde und Konkurrenten. Wir stritten uns und loteten auf dem Eis unsere Grenzen aus.
Weit und bunt war das Terrain nicht, auf dem wir uns austobten, obwohl wir das Eis liebten. Sicher war es nicht immer leicht, mich so anzunehmen, wie ich war. Ehrgeizig und trotzig und dabei bestimmt liebenswert und frech, wie die meisten Jungs auf dieser Welt. Es hätte mir gut getan, angenommen zu werden.
Vielleicht fehlten mir ein paar Lausbubensommer auf dem Land, während derer ich den Unsinn für ein ganzes langes Schul- und Trainingsjahr hätte machen können. Herumtollen, schreien, leise sein, lachen und weinen. Wann immer es geht, nutze ich die Gelegenheit und versuche, gemeinsam mit meinem Jungen Unsinn zu treiben und nachzuholen, was ich versäumte.
Unterdessen hatte ich an vielen Spartakiaden teilgenommen. Im Winter 1981/82 richtete Karl-Marx-Stadt, unser heutiges Chemnitz, die Eissportdisziplinen im Rahmen der Winterspartakiade aus. Auf Landesebene nahmen die besten Nachwuchssportler teil. Mit prächtigen Eröffnungsfeiern und viel Show ging es zur Sache.
Die Stimmung war für junge Sportler herrlich, die Atmosphäre gespannt und doch ausgelassen. Für jeden, der teilnehmen konnte, ein Vorgeschmack auf künftige, internationale Wettkampfatmosphäre. Ich sollte in diesem Winter das Spartakiade-Feuer entzünden.
Heute noch erinnere ich mich an diese kalte, fantastische Nacht. Ich lief mit der Fackel die lange Treppe, die nach oben hin immer schmaler wurde, bis zur letzten Stufe hinauf, und entzündete in der Schale das Spartakiade-Feuer. Es fühlte sich großartig an. Für einen Jungen von 15 Jahren, der nur für den Sport lebte, konnte es kein schöneres Erlebnis geben.

4. Kapitel Traum und Wirklichkeit gehen manchmal sehr weit auseinander
Paarläufer – rausgeworfen und doch dabeigeblieben
Nun sahen die Trainer also keine Zukunft mehr für mich als Einzelläufer. Dabei sollte ich noch froh sein, denn, wie gesagt, nur Jutta Müllers Intervenieren war es damals zu verdanken, dass ich überhaupt bleiben durfte: „Der hat Mut, der bleibt!“
Noch heute hat die schmale Frau eine stolze, Respekt gebietende Ausstrahlung, doch ist sie für mich inzwischen nahbarer.
Da blieb ich also, aber wo war ich hingeraten?
Ich lebte als Leistungssportler und fand natürlicherweise darin schon früh meine Bestätigung. Im internationalen Leistungsvergleich der gesellschaftlichen Systeme spielte ich meine Rolle, wenn ich mir dessen auch nicht bewusst war. Wir jungen Sportler fühlten aber, dass man unser Streben und Trainieren aufmerksam beobachtete. Trainer und Sportwissenschaftler, Ärzte und Betreuer führten uns durch den Trainingsalltag. Mein Trainingsplan gab fast minutiös vor, was und wie trainiert werden sollte und an welchen Schwachstellen ich zu arbeiten hatte. Das war gut so. Ballett-, Athletik- und Eistests, in diesem geplanten Training steckte auch ein großer Teil unseres Erfolges.
Bevor ich aber zum Paarlauf wechselte, hatte man mir ein halbes Jahr Athletiktraining verordnet. Ein Intensivtraining zum Muskelaufbau. Nicht, dass ich bis dahin keine Muskeln gehabt hätte! Trotzdem sah ich aus wie ein Streichholz mit Schlittschuhen unten dran. Im Paarlauf werden an den männlichen Läufer aber ganz andere Anforderungen gestellt.
Dazu bekam ich täglich eine kleine blaue Pille mit den Worten „die nimmst du jetzt mal eine Weile“. War das Doping? Ich weiß es nicht, dazu müssten andere befragt werden.
Auch unser mittäglicher Eiweißshake gehörte wie Butter aufs Brot dazu. In meiner Laufbahn hat Doping später nie eine Rolle gespielt, für mich ist das ehrenrührig, wenn man chemische Substanzen nimmt. Und die Dopingkontrollen nisten sich wie Läuse im Leben eines Eiskunstläufers ein, sodass ich mir das hierzulande nur schwer vorstellen kann. Wie das in anderen Ländern aussieht, kann ich nicht sagen, in Deutschland sind sie geradezu penetrant. Jeder Läufer, der Erfolg hat, wird stark kontrolliert und richtet sein Leben förmlich auf ständige, unangekündigte Besuche der Dopingkontrolleure ein. Siegen kann man in diesem Sport also nur, wenn man eisern an sich arbeitet.
Aber zurück zu meinen Anfängen im Paarlaufen. Von einem Tag auf den anderen hatte ich im Training ein kleines Mädchen an der Hand.
Während ich meine Verzweiflung überwinden musste, hatte sie wohl anfangs mit ihrer Furcht zu kämpfen. Bald legte sich unser „Fremdeln“ und ich merkte, dass sie eine sehr mutige kleine Person war, die durchaus mit dem „großen Jungen“ mitziehen konnte. Wir kamen sehr schnell und gut voran. Eine um die andere Figur erkämpften wir uns. Es dauerte nicht lange, da begriff ich, dass mich der verflixte Paarlauf auch glücklich machen könnte. Dass eben nicht alles vorbei, sondern ein neuer Anfang möglich war. Mit der Zeit fühlte es sich sogar richtig gut an. Manuela war wild entschlossen, sich meinem Ehrgeiz zu stellen. Mich beseelte bald der Wunsch: „Euch zeig ich es im Paarlauf, wartet nur ab!“

Ich glaube, das holte mich auch etwas aus meiner Einsiedelei heraus, denn ich musste kommunizieren. Nun war ich Teil einer Mannschaft, zwar der kleinsten denkbaren Mannschaft, aber ich spielte im Team, anders ging es nicht.
In der Eissporthalle trainierten wir unter hervorragenden Bedingungen. Nicht nur, dass die Eisfläche in Schuss war und stets in guter Qualität gehalten wurde und wir für sehr wenig Geld viel Zeit zum Training hatten. Unsere Stadt galt damals als Hochburg des Eiskunstlaufs, war auch international bekannt.
1980 feierte die Eiskunstlaufwelt Jan Hoffmann und Anett Pötzsch als neue Weltmeister. Immer spornten uns auch die Großen unserer Zunft an. Manchmal lief Tassilo Thierbach mit uns, der mit Sabine Baess ein Paar bildete. Beide waren in der Welt des Eiskunstlaufs hoch angesehen und wurden 1982 in Lyon Europameister und im gleichen Jahr in Kopenhagen Weltmeister. Da schauten wir schon einmal hin und versuchten, uns etwas Technik abzuschauen oder bekamen im Vorübergehen den einen oder anderen Hinweis.
Wir bewunderten verstohlen ihre Eleganz. Der Kampfgeist unserer berühmten Teamkollegen machte uns Mut, wenn es einmal nicht so gut lief.
Spitzbübisch ging es dagegen in den Pausen zu, wenn wir Jungs und Männer in den Umkleideräumen zusammensaßen. Die Eisläufer, die von internationalen Wettkämpfen nach Hause kamen, hatten nicht nur ihre Medaillen im Gepäck. Wir probierten Walkie-Talkies und andere „Souvenirs“ aus, erzählten und lauschten Geschichten, die natürlich nicht immer jugendfrei waren, und konnten einfach heranwachsende junge Männer sein.
Manuela und ich wuchsen unterdessen auf dem Eis als Paar zusammen. Wir brauchten zwei Jahre, dann hatten wir uns für die Juniorenweltmeisterschaften qualifiziert.
Sapporo, fremde Welt
Ging das schnell! Wir fuhren ins japanische Sapporo!
Für uns war schon die Reise im Dezember nach Asien überwältigend. Japan hatte als Ausrichter der Juniorenweltmeisterschaften die Spielorte exzellent vorbereitet. Ungeachtet der fantastischen Bedingungen in den Stadien und Mannschaftsquartieren zog ich staunend durch diese fremde Welt. Ich war gerade 17 geworden. Hunderte Autos fuhren an mir vorüber, ich durchreiste Tokio mit der U-Bahn und sah fassungslos, dass immer noch ein paar Menschen mehr in den schon überfüllten Zug stiegen. Ich erinnere mich an mein Hotelzimmer, das wie ein Saloon anmutete. Grandioserweise trennte Vorraum und Zimmer eine Schwingtür, wie ich sie aus Western kannte; meine Begeisterung war grenzenlos. Noch steigern konnte diese ein Fernseher mit ganz flachem Bildschirm, wie er mir als Ostdeutschem erst gefühlte hundert Jahre später wieder begegnen sollte.
Und dann war da dieser wunderbare Kräutertee, den ich mir aufbrühte, um meinen fürchterlichen Durst zu stillen. Nachdem ich den duftenden grünen Krümeln zirka zehn Minuten im dampfenden Wasser gegeben hatte, nahm ich einen kräftigen Schluck. Nun, ich brauchte zehn Jahre, ehe ich es erneut mit grünem Tee versuchte.
Die Farbe Grün spielte noch in anderer Hinsicht eine Rolle. In der Eissporthalle lag grünes Linoleum auf dem Weg zum Eis – und das liegt heute noch dort! Ich konnte mich 25 Jahre später bei einem Schaulaufen davon überzeugen.
In unserer Vier-Minuten-Kür hatten Manuela und ich 1983 eine Passage, bei der wir mitten in der Kür, vielleicht auch im letzten Drittel, eine Spirale liefen, die uns bis knapp vor die Bande führte.
Dort stand ein kanadischer Trainer und der rief uns, als wir der Bande am nächsten waren, „Bravo!“ zu und klatschte wie ein Verrückter. Das bleibt für immer, die Erinnerung an jene, kleine Passage in der Kür. Das ist etwas Besonderes für mich, denn normalerweise nimmt man eine solche Bemerkung nicht wahr, weil man die Kür läuft, als sei man im Tunnel.
Die zarte kleine Manuela lief großartig und ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich ein überirdisches Körpergefühl. Ich war in der Lage, alles zu tun, vermochte meinen Muskeln und Gelenken alles abzuverlangen und hatte das Gefühl, als stünde ich über meinem Körper.
Eine andere Erinnerung führt mich in Sapporos verschneite Straßen. Ich stand vor dem Hotel und sah zur anderen Seite hinüber. Dort standen kleine japanische Häuser und die Straße zwischen den verschneiten Straßenseiten war schwarz. Wie ich erfuhr, wärmten die Abwasserrohre des Hotels unterirdisch die Straße, sodass weder Split noch Salz zum Einsatz kommen mussten – faszinierend!
Genau am 5. Dezember liefen wir unser Kurzprogramm. Das kann ich nie vergessen, denn immer am darauffolgenden Tag füllt in der Heimat ein gütiger Nikolaus dem braven Eiskunstläufer die Schlittschuhe. Am nächsten Morgen hing an meiner japanischen Hotelzimmertür tatsächlich eine Kleinigkeit an der Klinke. Ein japanisches Spiel, das bei mir zu Hause in einer Kiste voller Erinnerungen seinen Platz gefunden hat.

Am 7. Dezember liefen wir dann unsere Kür. Daten, die mein Gedächtnis nie löschen wird.

Bis zu diesem Jahr, 1983, nahmen die Goldmedaillen ausschließlich russische Eisläufer mit nach Haus. Bei diesen Meisterschaften jedoch standen wir zwei Ostdeutschen ganz oben und ließen uns die Goldmedaillen umhängen. Wir unterbrachen damit eine jahrzehntelange Serie und zeigten, dass auch andere als russische Eiskunstläufer die Weltspitze anführen konnten. Manuela und ich galten auf einen Schlag als Ausnahmeläufer und erhielten international unglaublich viel Anerkennung.
In diesem Jahr kamen die besten Nachwuchs-Eiskunstläufer aus der DDR, dem „kleinen Bruder“ der Sowjetunion. Hier fand im übertragenen Sinne Ausdruck, was sich Länder wie Bulgarien, Polen oder Rumänien ebenso sehr wünschten wie die politische Führung in der DDR: eigenständig handeln, ohne dass erlaubt, geführt und bevormundet wurde. Endlich konnte man glänzen, ohne dass der Erfolg verordnet worden war oder geteilt werden musste. Und nicht nur die Sportfunktionäre der DDR waren überglücklich, dass die Kette der russischen Siege durchbrochen war.
tc
Ich hatte mich mittlerweile ganz und gar in dieses neue Feld des Eislaufens hineinbegeben. Vieles musste ich lernen, denn es war ungewohnt, alles gemeinsam zu meistern. Plötzlich musste ich für meine Partnerin vorausschauend mitlaufen. Mit den Würfen und Sprüngen hatte ich mit einem Male viel größere Verantwortung. Manuela war noch so jung, daher auch federleicht; auf die Dauer kann aber aus einer kleinen Feder auch ein gutes Stück Gewicht werden, das ich halten, fangen und werfen sollte.
Letztendlich hatten wir es allen gezeigt und ich blieb dem Eis weiter treu ergeben und verbunden. Mehr noch, eine neue Perspektive tat sich auf – der Himmel leuchtete wieder.

Nach den Wettkämpfen in Sapporo flogen wir weiter nach Tokio, um dort an einem Schaulaufen teilzunehmen. Als ich das Hotel in Tokio verließ, lief ich einer Tänzerin in die Arme, die mir auf der Stelle einen riesengroßen Schal schenkte.
Mitten auf der Straße stand ich da und ließ mir diese Wollschlange umlegen. Warum? Keine Ahnung, mein Japanisch war noch nicht ganz so geschliffen, sodass ich mit meinen zwei Vokabeln für „Bitte“ und „Danke“ ihrer Erklärung einfach nicht schnell genug folgen konnte. Ich freute mich riesig, nahm es als Kompliment für den jungen deutschen Läufer und verstaute ihn schnell in meinem Hotelzimmer. So geschehen vor dreißig Jahren; den Schal besitze ich heute noch.
Natürlich machte ich zum ersten Mal mit der japanischen Mentalität Bekanntschaft. Freundlich und zuvorkommend, aber durch und durch leistungsorientiert. Diese Zielstrebigkeit bewirkte zum einen, dass japanische Wissenschaftler und Ökonomen das Land in allen Bereichen in die obersten Ligen katapultierten. Aus den Startlöchern heraus schnellte die japanische Wirtschaft nach vorn, und auch im Sport eroberte sich der Inselstaat respektable vordere Plätze. Der politischen Führung kam das in den 1980er Jahren sehr zupass. Für uns spielte das damals alles keine Rolle, wir waren in unserem eigenen Rausch.
In den Jahren zuvor hatten künftige Weltmeister immer zuerst bei den Junioren Gold, Silber oder Bronze geholt; somit waren diese Entscheidungen immer wie Seismographen, die auf zukünftige Sieger hinwiesen. Manuela und ich holten im Dezember 1983 in Sapporo den ersten und bislang einzigen deutschen Juniorenweltmeistertitel.
Ich weiß noch: Da standen wir auf dem Podest, mir war heiß und kalt zugleich, und in diesem Augenblick wurde mir klar, dass wir in unserer Altersklasse weltweit zu den Besten zählten; dass wir bei den Paarläufern im Eiskunstlauf soeben die höchste Anerkennung erhalten hatten. Ich jubelte innerlich. In diesem Moment wusste ich, wenn uns das gelingen konnte, dann würden wir auch bei den nächsten Meisterschaften chancenreich sein. Plötzlich schien noch viel mehr möglich zu sein.
Immer nur für den Augenblick zufrieden
Dazu kam, dass unsere Erfolge anerkannt wurden. Nicht dass das bis dahin nicht der Fall gewesen wäre. Doch jetzt gehörten wir zu denen, auf die man auch im Ausland aufmerksam wurde, und so besaßen die Ehrungen einen anderen Wert. Ich erinnere mich heute noch an unseren ersten großen Empfang nach unserer Rückkehr aus Japan – mit Rede, Buffet und großem Tamtam.
Jetzt war die Richtung klar: Der Profisport rief nach uns. Unser Trainingsziel hieß Olympia! Das war zwar an sich nicht unrealistisch, doch wir liefen gänzlich ohne Angst einfach auf dieses Ziel zu. In stillen Minuten zweifelten wir sicher auch einmal oder sahen uns verwundert um. In welcher Liga fanden wir uns da unversehens wieder?
Doch so jung, wie ich war, so mutig und zuversichtlich war ich. Die Juniorenweltmeister des Vorjahres standen im darauffolgenden Jahr oft auf der obersten Treppe des Siegerpodestes, und so war es nicht aus der Luft gegriffen, dass wir dieser verheißungsvollen Spur folgen wollten.
Tassilo Thierbach und Sabine Baess beendeten gerade ihre Laufbahn, Katarina Witt holte sich olympisches Gold und wir wollten zukünftig im großen Eiskunstlaufzirkus auch in der Manege unsere Rolle spielen.

1985 nahmen wir an den Europameisterschaften in Göteborg teil und brachten einen guten 5. Platz mit nach Haus. Im gleichen Jahr fanden die Weltmeisterschaften in Tokio statt und wir belegten den 8. Platz. Nicht schlecht, fanden wir. Die Anforderungen waren ja viel höher, wir liefen eine Kür mit großen technischen Schwierigkeiten und wussten: Um erfolgreich zu sein, mussten wir ausdauernd sein und jedes Jahr ein bisschen mehr zeigen, choreografisch und athletisch. Am Anfang hatten wir den Eindruck, dass uns der Druck wirklich „drückte“. Dann passten wir uns an, eigentlich lief alles ganz gut für uns, Manuela und ich packten den Eiskunstlaufstier bei den Hörnern.
Aber es sollte anders kommen. Bis 1987 noch blieben wir auf dem Eis ein Paar, aber unmerklich hatte sich doch der Stress eingeschlichen.
Verlangten wir zu schnell und zu viel von uns ab? War ich Manuela gegenüber zu ungeduldig? Zogen zu viele an ihr herum? In diesen zwei Jahren sollten wir jedenfalls viele Male Krankenhäuser von innen sehen. Im Laufe unseres Trainings, das wir sofort verstärkt und mit Richtung Weltmeisterschaft aufgenommen hatten, ereilte uns schnell eine erste, dann eine zweite Verletzung. Keine leichten Bänderzerrungen oder Prellungen – von diesen alltäglichen kleinen Gegebenheiten lernen Eiskunstläufer sehr schnell zu schweigen –, sondern langwierige und komplizierte Brüche. Wochenlang konnten wir nicht trainieren, lagen im Krankenhaus und kurierten zahlreiche Operationen aus.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.