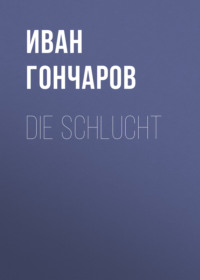Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Die Schlucht», sayfa 12
›Zu spät! Zu spät!‹ rief ihm die Verzweiflung ins Ohr, und ihr schwerer Atem bestätigte das Wort.
Er stellte sich vor, wie er damals, als sie noch das einzige Ziel seines Lebens war und er sein eigenes Glück in Gedanken ganz mit ihrer Erscheinung verwob, gleich der Schlange, die sich der Farbe ihrer Umgebung anpaßt, sich ganz nach ihr gerichtet, gleichsam selbst ihr still leuchtendes Wesen angenommen hatte; die Aufrichtigkeit und Zärtlichkeit, die ihr sittliches Ich ausmachte, schien auch auf ihn übergegangen, ihr Lächeln war auch das seinige, er konnte mit ihr entzückt sein beim Anblick eines Vogels, einer Blume, er freute sich kindlich mit ihr über ihr neues Kleid, weinte am Grabe ihrer Mutter und ihrer Freundin, weil sie weinte, pflanzte mit ihr zusammen Blumen auf die Grabhügel der Toten . . .
In alledem, in seiner Freude über den Vogel, seinem Lächeln, seiner Trauer war er ebenso aufrichtig gewesen wie sie selbst. Wo waren diese Tränen, dieses Lächeln, diese naive Freude geblieben, warum erschienen sie ihm jetzt abgeschmackt, warum bedurfte er ihrer nicht mehr? . . .
›Worüber sinnst du nach?‹ ließ ihre schwache Stimme sich an seinem Ohr vernehmen. ›Gib mir zu trinken . . . Nicht doch, sieh mich nicht an!‹ fuhr sie fort, als sie getrunken hatte – ›ich bin so häßlich geworden! Gib mir den Kamm. . . und das Häubchen, ich will es mir aufsetzen. Sonst hörst du am Ende noch auf, mich zu lieben . . . weil ich so gar nicht mehr hübsch bin!«
Sie glaubte immer noch, daß er sie liebe! Er reichte ihr den Kamm und das kleine Häubchen; sie wollte sich kämmen, aber die Hand mit dem Kamme fiel ihr in den Schoß zurück.
›Es geht nicht, ich bin zu schwach!‹ sagte sie und verfiel in schwermütiges Sinnen.
Ihm aber ward zumute, als schnitte man ihm mit Messern ins Fleisch. Der Kopf brannte ihm heiß, er sprang auf und schritt, von den Bildern seiner Phantasie gejagt, hastig im Zimmer auf und ab. Wie nicht bei Sinnen, stürzte er bald in diese, bald in jene Ecke und wußte nicht, was er tat. Er ging zur Wirtin hinaus und fragte, ob der Arzt, den er Natascha geschickt hatte, sie auch wirklich besucht habe. Die Wirtin berichtete ihm, er sei dagewesen und habe auch noch andere Ärzte mitgebracht, und sie habe ihnen soundsoviel bezahlt: ›Ich habe alles aufgeschrieben,‹ fügte sie hinzu.
›Und was taten sie?‹ fragte er.
›Was sie immer tun: sie beguckten sie, behorchten ihre Brust, gingen ins andere Zimmer, zuckten schweigend die Achseln, nahmen den Geldschein, den ich ihnen in die Hand drückte, knöpften den Überrock zu und gingen eilig davon.‹
Raiski hörte mit innerem Erschauern diesen kurzen Bericht und trat wieder an das Bett. Das lustige Gelage mit den Freunden, der fröhliche Kreis der Künstler und Sängerinnen – alles das schwand mit der Hoffnung, ihr Leben zu verlängern, ganz aus seiner Vorstellung.
Er sah nur noch dieses verlöschende Antlitz, das da litt, ohne anzuklagen, das da lächelte voll Liebe und Demut; dieses hinschwindende Wesen, das um nichts bat, nicht einmal um ein wenig Hilfe, um ein wenig Kraft!
Und er stand da, voll Gesundheit und strotzender Kraft – dieser Kraft, die er noch heute so unnütz verschwendet, die er nicht dazu verwandt hatte, dieses Vögelchen vor Sturm und Unwetter zu behüten!
Warum hatte er sich nicht mit aller Gewalt hier festgekettet, warum war er fortgegangen, nachdem ihre Schönheit ihm etwas Alltägliches geworden, nachdem das Bild dieses ihm einst so lieben, süßen Köpfchens in seiner Phantasie verblaßt war? Warum war er, als andere Bilder sich dazwischendrängten, nicht standhaft und fest geblieben, nicht in stiller Treue bei ihr, der Treuen, verharrt?
Das wäre kein Opfer gewesen, sondern einfach eine Pflicht. Ohne Opfer, ohne Entbehrungen und Verzicht geht es nun einmal nicht ab im Leben: das Leben ist kein Garten, in dem nur lauter Blumen wachsen, dachte er unwillkürlich, während das Rubenssche Gemälde ›Der Liebesgarten‹ ihm vor die Seele trat. Glückliche, schöne Paare, von Amoretten umflattert, hat der Künstler dort unter den Bäumen abgemalt.
›Er ist ein Lügner!‹ schalt Raiski den flämischen Meister in Gedanken. ›Warum hat er in seinem Garten neben den Liebespärchen nicht auch armes Bettelvolk in Lumpen und sterbende Kranke dargestellt? Das würde der Wahrheit entsprechen! . . . Aber wäre ich denn imstande gewesen, dieses Opfer zu bringen?‹ fragte er sich selbst. Wie wäre es gekommen, wenn er wirklich sein Leben an das ihre gekettet hätte? Wäre solch ein Dasein nicht gleichbedeutend gewesen mit Schlaf, mit Apathie? Wäre der schlimmste Feind, die Langeweile, nicht sogleich bei ihm zu Gaste erschienen? In seiner Phantasie tauchte die ganze Perspektive dieses Lebens auf, das Bild dieses Schlafes, dieser Apathie, dieser Langenweile: er sah sich selbst, finster, rauh, unfreundlich – würde er sie durch solch ein Wesen nicht noch eher ins Grab gebracht haben? Verzweifelt wehrte er die Vorstellung dieser Möglichkeit ab.
›Die Wut, die Raserei kann man beherrschen,‹ so begann er sich vor sich selbst zu rechtfertigen, ›nicht aber die Apathie und die Langeweile! Die lassen sich nicht verbergen, beim besten Willen nicht! Mit der Zeit würde sie es erraten haben, wie es um mich steht, und das hätte sie getötet . . . Mit der Zeit? . . . Ja, nach Jahren vielleicht – und dann hätte sie sich damit ausgesöhnt, sich gewöhnt und getröstet— und hätte doch gelebt! Jetzt aber stirbt sie!‹ – Und sogleich wieder schwebte seinem Geiste ein ganzer Roman vor, eine ganze Tragödie, mit tiefen psychologischen Verwicklungen und dramatischen Effekten.
›Komm, setz’ dich hierher, zu mir!‹ ließ Nataschas Stimme sich vernehmen, und er ward aus seinen Gedanken gerissen . . .
. . . Acht Tage später ging er mit gesenktem Haupte hinter Nataschas Sarge einher; er war ganz verzweifelt darüber, daß er sie so vernachlässigt, so wenig sorgsam behütet hatte, tröstete sich jedoch andererseits damit, daß er sein Herz nicht habe zwingen können, daß er sie nie bewußt gekränkt habe, daß er immer, wenn er in ihrer Gesellschaft war, aufmerksam und zärtlich gegen sie gewesen, und daß nicht in seinem, sondern in ihrem Wesen jenes Element gefehlt habe, das ihren Herzensbund zu einem dauernd glücklichen hätte machen können. Und schließlich sei sie doch im Gefühle ihrer Liebe gestorben, sei nie erwacht aus ihrem stillen Traum, habe nie erfahren, daß er die Leidenschaft in ihr vermißte, diese Peitsche, die das Leben vorwärts treibt und die schöpferische Kraft, die produktive Arbeit in ihm auslöst . . .
›Nein, nein – sie ist nicht die, welche ich suchte: ein Täubchen ist sie gewesen, nicht ein Weib!‹ dachte er, während sein tränengefülltes Auge auf dem Sarge ruhte.
In stillem Sinnen stand er in der Kirche und sah, wie die erwärmte Luft um die Flammen der Kerzen vibrierte; nur wenige Leidtragende waren anwesend: allen voran stand ein dicker, hochgewachsener Herr, ein Verwandter der Toten, der gleichgültig eine Prise nahm. Neben ihm sah er das rote, ganz in Tränen aufgelöste Gesicht einer Tante, dann waren noch etliche Kinder und ein paar arme alte Frauen da.
Neben dem Sarge kniete eine Freundin Nataschas; sie war nach den anderen gekommen, schien aber mehr als sonst jemand durch den Todesfall ergriffen: ihr Haar war zerzaust, sie blickte in wildem Schmerz um sich, heftete dann den Blick auf das Gesicht der Toten, neigte die Stirn wieder tief bis zum Boden, daß sie diesen berührte, und brach in krampfhaftes Schluchzen aus . . .
Er schritt langsam nach Hause und ging nun zwei Wochen lang wie vor den Kopf geschlagen umher, ließ sich im Studiensaal nicht sehen, mied den Freundeskreis und durchirrte die einsamen Straßen der Vorstadt. Allmählich legte sich sein Schmerz, die Tränen versiegten, die herbe Qual verging, und in seiner Vorstellung blieb nur das Bild der vibrierenden Luft um die Kerzenflammen, der leise Grabgesang, das tränenfeuchte Gesicht der Tante und das wortlose, krampfhafte Schluchzen der Freundin . . .«
Hier endete das Manuskript.
Als Raiski es durchgelesen hatte, saß er eine Zeitlang in düsterem Nachsinnen da.
»Eine recht blasse Skizze!« sagte er für sich. »Jetzt schreibt man anders. Das ist ganz im Stil der ›Armen Lisa‹ gehalten. Auch ihr Porträt« – er trat an die Staffelei heran— »ist kein Porträt, sondern eine ganz flüchtige Studie.«
»Arme Natascha!« sagte er, gleichsam mit einem Seufzer ihr Andenken ehrend, und betrachtete das Bild. »Auch im Leben warst du nur sozusagen eine Studie, eine Skizze, kaum untermalt mit den Farben des Lebens – ganz wie auf meiner Leinwand hier und in meinem Manuskript! Ich muß beides umarbeiten, das Bild wie die Skizze!« Dann legte er mit einem Seufzer das Heft in den Schreibtisch zurück, nahm eine Anzahl weißer Blätter und begann den Plan seines neuen Romans zu entwerfen.
Die Episode, die er selbst erlebt hatte, erschien ihm jetzt als eine bloße Erinnerung, ja als ein fremdes Erlebnis. Er betrachtete sie ganz objektiv und stellte sie in den Vordergrund seines Programms.
Er schrieb bis zum Tagesanbruch, kehrte im Laufe des Tages mehrmals zu seinen Heften zurück, setzte sich, als er des Abends nach Hause kam, wieder an den Schreibtisch und notierte alles, was in seiner Vorstellung bereits festere Gestalt angenommen hatte.
Szenen und Charaktere, Porträts von Verwandten und Bekannten, die Gestalten der Freunde, der Frauen, die er gekannt, wurden ihm zu typischen Gebilden, und er füllte ein ganzes Heft mit ihrer Schilderung an. Er trug stets ein Notizbuch bei sich, zog oft mitten auf der Straße, in einer Gesellschaft, beim Mittagessen ein Blatt Papier und einen Bleistift heraus, schrieb ein paar Worte hin, steckte das Blatt weg, nahm es wieder vor und schrieb wieder, ging sinnend, wie selbstvergessen, umher, blieb mitten in der Rede stecken und lief plötzlich aus der Gesellschaft fort, um die Einsamkeit zu suchen.
Aber das Leben weckte ihn immer wieder aus seiner Träumerei, rief ihn hinweg von der schöpferischen Arbeit, von der Freude und der Qual, die die Kunst ihm gab, zu seinen wirklichen Freuden und wirklichen Qualen, unter denen ihm die Langeweile als die schlimmste erschien. Er eilte von Eindruck zu Eindruck, suchte die Erscheinungen zu erfassen, hielt ihre Bilder fast mit Gewalt in seinem Innern fest, und während er einerseits Nahrung für seine Phantasie verlangte, suchte und ersehnte er andererseits etwas, das seinem inneren Wesen einen festen Halt geben könnte.
Augenblicklich hatte er gewisse ihm selbst noch unklare Hoffnungen auf seine Cousine Bjelowodowa gesetzt und schwelgte in dem eigenartigen Reiz, den ihm die Annäherung an sie gewährte. Er wollte zunächst nichts weiter, als sie so oft wie möglich sehen und mit ihr sprechen, um in ihr das Leben und, wenn möglich, auch die Leidenschaft zu wecken.
Aber sie war unnahbar. Er begann bereits zu ermüden und Langeweile zu empfinden . . .
Sechzehntes Kapitel
Der Mai war vorüber. Allgemein empfand man in Petersburg das Bedürfnis, sich irgendwohin vor der heißen Sommersonne zu flüchten. Aber wohin? Es war Raiski ganz gleich, wohin er ging. Er entwarf verschiedene Projekte, ohne eins von ihnen zu verwirklichen: er wollte nach Finnland reisen, doch verwarf er diesen Plan wieder und beschloß, an die Seen von Pargolowo zu gehen, um dort an seinem Roman zu arbeiten. Auch dieses Projekt gab er auf und dachte allen Ernstes daran, mit den Pachotins auf deren Gut in der Gegend von Rjäsan zu reisen. Aber sie hatten selbst ihre Absichten geändert und waren in der Stadt geblieben.
So wäre er denn schließlich mit dem großen Auswandererstrom ins Ausland abgereist, wenn nicht plötzlich eine ganz neue Wendung eingetreten wäre.
Als er eines Tages nach Hause zurückkehrte, fand er zwei Briefe vor – der eine war von seiner Großtante Tatjana Markowna, der andere von seinem Universitätsfreunde Leontij Koslow, der als Gymnasiallehrer in der dem Raiskischen Gute benachbarten Stadt tätig war.
Die Großtante hatte ihm in den ersten Jahren häufig geschrieben und ihm über die Gutsverwaltung Rechenschaft abgelegt; die Briefe hatte er kurz, doch jedesmal voll Liebe und Zärtlichkeit gegen die wackere Alte beantwortet, die so lange Mutterstelle an ihm vertreten hatte, und der er aufrichtig zugetan war; die Rechnungen hatte er zerrissen und unter den Tisch geworfen.
Dann waren ihre Briefe seltener geworden, sie klagte über ihr Alter, über ihre schlechten Augen und die Sorgen, die sie mit der Erziehung der beiden Großnichten hätte. Wie erfreut war er nun, als er ihre große, deutliche, feste Handschrift auf dem Kuvert erkannte.
». . . Ist es nicht sündhaft von Dir, Boris Pawlowitsch,« schrieb sie unter anderem, »mich alte Frau so ganz zu vergessen? Ich bin doch die einzige Verwandte, die Du auf der ganzen weiten Welt hast. Aber freilich, wir Alten sind in dieser neuen Zeit überflüssig geworden auf der Welt: so wenigstens denkt die Jugend. Und ich kann doch nicht einmal sterben, ich habe die beiden Kinder auf dem Halse, die längst heiratsfähig sind. Bevor ich die nicht sicher versorgt weiß, will ich den lieben Gott immer noch bitten, mein Leben zu verlängern. Dann mag sein Wille geschehen.
»Ich mache Dir keinen Vorwurf weiter daraus, daß Du mich vergißt: aber wenn, was Gott verhüten möge, ich nicht mehr da bin und meine armen Mädelchen allein auf der Welt zurückbleiben! Sie sind ja nur im dritten Grade mit Dir verschwistert, aber Du bist doch ihr nächster Verwandter und ihr berufener Beschützer. Und denk auch an das Gut: ich bin alt und kann nicht mehr lange Deine Verwalterin bleiben – wer soll denn die Sorge um Dein Besitztum tragen? In alle vier Winde wird es zerstieben, nichts wird davon übrigbleiben. Soll es wirklich so zugrunde gehen, was ich so lange gehütet habe? Das Herz krampft sich mir zusammen, wenn ich denke, daß dieses altererbte Silberzeug, diese Bronzen, Gemälde, Brillanten und Spitzen, dieses Porzellan und Kristall dem Gesinde in die Hände fallen und von Juden und Wucherern aufgekauft werden soll, um dann auf der Wolga zum Jahrmarkt zu schwimmen und für einen Spottpreis losgeschlagen zu werden! Solange Deine Großtante lebt, kannst Du ruhig schlafen, nicht ein Faden wird Dir verloren gehen; dann aber weiß ich nicht, wer sich darum kümmern wird. Von den beiden Kleinen kannst Du es nicht verlangen! Wjera ist ein gutes, kluges Mädchen, nur etwas wild und menschenscheu und nicht recht fürs Praktische veranlagt. Marsinka wird einmal eine musterhafte Hausfrau werden, aber sie ist noch zu jung; heiraten könnte sie ja schon längst, aber ihr Wesen ist noch so ganz kindlich, wofür ich wieder Gott nicht genug danken kann. Kommt erst die Erfahrung, dann wird sie schon heranreifen, vorläufig hüte ich sie wie meinen Augapfel, was sie sehr wohl zu schätzen weiß – ja, sie fühlt sich gut aufgehoben bei der Großtante, Gott segne sie dafür. Im Hause ist sie mir sehr zur Hand, doch von der Gutswirtschaft halte ich sie fern, das ist nichts für ein Mädchen. Ich habe jetzt hier einen sehr verständigen Menschen zur Hilfe, ein Bauer mit Namen Ssawelij ist’s: seit es mit mir nicht mehr so recht geht, sieht er im Dorfe zum Rechten, während Jakow und Wassilissa das Haus versehen.
»Schieb’s also nicht länger hinaus und erfreue Deine alte Tante durch Deinen Besuch: sie ist Dir doch nicht nur dem Blute, sondern auch dem Herzen nach verwandt; als Du jung warst, hast Du das wohl gefühlt – ich weiß nicht, wie Du jetzt, in Deinen reiferen Jahren, geworden bist, jedenfalls warst Du damals ein prächtiger Junge. Komm und sieh Dir wenigstens einmal die beiden Schwestern an; und wer weiß, vielleicht blüht Dir auch das Glück . . . Ich wollte eigentlich über diesen Punkt schweigen, bis Du herkämst, aber ich halt’s eben, nach Weiberart, so lange nicht aus. Die Sache ist nämlich die, daß sich hier bei uns ein Großpächter aus Moskau niedergelassen hat, ein gewisser Mamykin, und der hat eine einzige, heiratsfähige Tochter und sonst keine Kinder. Wenn Gott mir noch die Freude gewährte, Dich verheiratet zu sehen und Dir das Gut zu übergeben, dann würde ich ruhig die Augen schließen. Heirate doch, Borjuschka, Du hast schon längst das Alter dazu; dann haben doch meine lieben kleinen Mädchen einmal ein Heim und stehen nicht als obdachlose Waisen da. Du wirst ihr Bruder, ihr Beschützer sein, und Deine Frau wird ihnen eine gute Schwester sein. Solange Du Junggeselle bist, können sie bei Dir nicht bleiben – heirate also, tu der alten Tante den Gefallen, und Gott wird Dir’s vergelten!
»Ich warte sehnsüchtig auf Deine Antwort! Schreib, wann Du kommst, ich lasse Dir die drei Zimmer im unteren Erdgeschoß einrichten, Marsinka muß so lange ins Giebelzimmer ziehen: Du bist doch der Herr im Hause!«
»Tit Nikonytsch läßt sich Dir empfehlen: er ist stark gealtert, jedoch immer noch wohlauf. Sein Lächeln ist noch ganz das alte, und seine kluge Art zu sprechen wie seine netten Verbeugungen haben sich in nichts geändert: die jungen Stutzer steckt er noch alle in die Tasche. Bring ihm doch, mein Lieber, ein Paar gemslederne Beinkleider und eine gemslederne Jacke mit, man trägt das jetzt vielfach zum Schutz gegen den Rheumatismus. Ich will ihn damit überraschen.
»Anbei folgt die Rechnungslegung für die beiden letzten Jahre. Es sendet Dir ihren Segen usw.
Tatjana Bereschkowa.«
»Die Großtante!« rief Raiski voll Freude aus. »Mein Gott— sie ruft mich: ja, ja, ich komme! Dort finde ich Ruhe, und eine herrliche Luft, und vortreffliche Kost, und die mütterliche Zärtlichkeit einer guten, feinfühligen, klugen Frau; und die beiden Schwestern, die lieben Gesichtchen, die ich so, wie sie jetzt sind, noch nicht kenne, und die meinem Herzen doch so nahe stehen . . . Ein paar Provinzdämchen – eigentlich etwas beängstigend, vielleicht sind sie gar häßlich geworden!« dachte er und runzelte unwillkürlich die Stirn. »Einerlei: ich fahre, das Schicksal ruft mich hin . . . Wenn mich aber auch dort die Langeweile überfällt?«
Er erschrak, beruhigte sich jedoch sogleich wieder.
»Sofort reise ich ab, beim ersten Gähnen, das mich anwandelt!« tröstete er sich. »Ja, ich fahre, ich fahre! Dort ist ja auch Leontij!« rief er aus und mußte unwillkürlich lächeln, als er an diesen Leontij dachte. »Was schreibt er denn eigentlich, der gute Leontij?«
»Gestern bin ich ganz wider Erwarten, ich weiß nicht wie, auf Dein Gut gelangt,« schrieb Leontij. »Ich glaube, es geschah in der Zerstreutheit – du weißt ja, daß ich diesen Fehler habe. Ich hatte mich verlaufen, war plötzlich an einen Abhang gekommen, und als ich den hinaufkletterte, da sah ich erst, daß ich im Park Deiner Großtante war. Ich wollte wieder umkehren, aber Tatjana Markowna hatte mich bereits vom Fenster aus bemerkt; anfangs hielt sie mich in der Dämmerung für einen Dieb und schickte mir Leute mit Hunden entgegen, wie sie mich dann aber erkannt hatte, lud sie mich ins Haus ein, war sehr nett zu mir, setzte mir ein treffliches Abendbrot vor und wollte sogar, daß ich über Nacht bleiben sollte. Vor allem schalt sie mich, daß ich so selten hinkomme, und band mir’s auf die Seele, Dir ja zu schreiben, Du möchtest doch nur hierherkommen. Du sollst das Gut übernehmen, sagt sie, sollst Dich hier niederlassen und – heiraten.
»Ich muß Dir gestehen, lieber alter Freund Boris Pawlowitsch, daß ich selbst die Absicht hatte, Dir zu schreiben, daß ich mich jedoch nicht recht getraute, und zwar wirst Du sogleich erfahren, weshalb. Die Gutsübergabe ist, offen gesagt, nur ein Vorwand – die Tante will Dich einfach sehen und weiß nicht, wie sie Dich herlocken soll. Besser, als sie das Gut verwaltet, kann es nicht verwaltet werden. Doch das nur nebenbei: etwas anderes ist’s, was ich auf dem Herzen habe, ich weiß nur nicht recht, wie ich’s anfangen soll, es Dir vorzutragen! Jedenfalls erfordert diese Angelegenheit Dein sofortiges Erscheinen, damit Du als strenger Richter die Strafe über die Schuldigen verhängst. Es handelt sich um Deine Bibliothek.
»So höre denn – Du liebst mich ja, ich weiß es. In der Schule wie auf der Universität warst Du gegen mich besser als alle anderen: Du hast meinen Mut aufrechterhalten, hast mit mir zusammen gelesen und studiert, hast mir so manches Mal ausgeholfen, wenn ich meine Wirtin . . . oder meine Wäscherin . . . nicht bezahlen konnte . . .«
Raiski las rasch über diese Zeilen hinweg. »Du hast mich nicht gereizt und geneckt, hast keine Witze mit mir gemacht, hast mich auch gar nicht oder nur sehr selten geprügelt: zweimal, glaub’ ich, hast Du mich an den Haaren gezogen, während die anderen . . . Doch Gott mit ihnen, ich trag’s ihnen nicht nach! Sie haben es ja auch nicht aus Bosheit getan, sondern nur so, aus Übermut und Windbeutelei! Im Namen dieser Freundschaft also bitte ich Dich: sei mir nicht böse . . . oder zieh mich noch zum drittenmal an den Haaren, wenn Du willst, aber hör’ mich an! Erinnerst Du Dich noch der alten gotischen Klassikerausgabe in den kostbaren Einbänden? Wie solltest Du nicht! Du hattest früher selbst Deine Freude an diesen schönen Bänden. Erinnerst Du Dich der alten Shakespeare-Ausgabe mit den Kommentaren unter dem Text? Erinnerst Du Dich . . . der französischen Enzyklopädisten in Pergament, erste Originalausgabe? Erinnerst Du Dich . . . (natürlich wirst Du Dich erinnern, wenn’s mir auch lieber wäre, Du hättest es vergessen). Ich lege Dir hier den Katalog bei, den ich zusammengestellt habe: die genannten Werke habe ich mit schwarzen Kreuzen bezeichnet, wie auf dem Kirchhof! Und nun hör’ zu und prügle mich: die Werke der heiligen Kirchenväter sind, wie überhaupt die ganze theologische Abteilung, unversehrt geblieben; Plato, Thucydides und die übrigen Historiker und Dichter sind gleichfalls unangetastet. Spinoza dagegen, Machiavelli und noch ein halbes Hundert anderer Werke aus den übrigen Abteilungen sind lädiert – infolge meiner Feigheit, Schwäche und verdammten Vertrauensseligkeit.
»Wer ist dieser Barbar, dieser Omar? wirst Du fragen. Nun denn – er heißt Mark Wolochow: ein Mensch, dem nichts heilig ist auf dieser Welt. Gib ihm die feinste Elzevirausgabe eines Werkes in die Hand – er wird ohne weiteres das erste beste Blatt herausreißen. Er hat, wie ich zu meinem Schrecken – leider zu spät – erfuhr, eine abscheuliche Gewohnheit: wenn er ein Buch liest, reißt er aus dem bereits gelesenen Teil irgendein Blatt heraus und zündet sich damit seine Zigarre an, oder er macht daraus ein Röllchen, das er zum Reinigen seiner Nägel und seiner Ohren benutzt. Es war mir immer so vorgekommen, als ob die Bücher, die ich ihm aus Deiner Bibliothek geliehen hatte, bei der Rückgabe dünner wären als vorher, doch konnte ich nie dahinter kommen, worauf das beruhte, bis er die Sache ohne jede Scheu auch in meiner Gegenwart machte. Als ob nichts wäre, nahm er den Aristophanes – Du weißt, die Ausgabe, in der neben dem griechischen Text die französische Übersetzung steht – und riß plötzlich, ehe ich mich versah, ein Blatt von hinten heraus. Dieser Wolochow ist eine wahre Geißel unserer Stadt. Kein Mensch liebt ihn hier, alle fürchten ihn. Was mich betrifft, so kann ich das allerdings nicht sagen, ich habe ihn ganz gern, und ich fürchte mich auch nicht vor ihm. Er treibt seinen Spaß mit mir, nimmt mir unterwegs die Mütze vom Kopfe und freut sich königlich, wenn ich es nicht bemerke, oder er klopft des Nachts an mein Fenster. Dafür bringt er mir zuweilen wieder ganz unerwartet eine Flasche trefflichen Weins oder – er wohnt hier bei einem Gärtner – eine ganze Wagenladung prächtiger Früchte. Er ist von der Administration hierher verschickt und steht unter Polizeiaufsicht – man kann nicht sagen, daß die Stadt seit seiner Anwesenheit hierselbst besonders an Sicherheit gewonnen hätte.
»Sag’ ihm um Gottes willen nichts von dieser Schilderung, die ich Dir hier von ihm geben. Er würde ohne Zweifel Dir sowohl wie mir aus Rache einen Streich spielen. Ich verlangte von ihm eine Erklärung wegen der lädierten Bücher, aber er steckte ein solches Gesicht auf, daß ich unwillkürlich meine Vorhaltungen abbrach. Er behauptet, er sei zur selben Zeit wie wir auf der Universität gewesen, wenn auch in einer anderen Fakultät. Ich glaube, es ist Schwindel.
»Hier weiß man nur, daß er bei einem Regiment in Petersburg gestanden hat, sich dort jedoch nicht zu stellen wußte und irgendwohin nach dem Innern des Landes versetzt wurde, daß er dann seinen Abschied nahm, in Moskau lebte und in irgendeine Geschichte verwickelt wurde. Jetzt hat man ihn, wie gesagt, hierher geschickt und unter Polizeiaufsicht gestellt. Mit der Polizei steht er natürlich stets auf gespanntem Fuße, und Nil Andreitsch wie auch Tatjana Markowna wollen nichts von ihm wissen. Doch genug von ihm! Wenn Du herkommst, wirst Du ja selbst sehen, was für ein Mensch das ist. Jetzt habe ich Dir die Sache eingestanden, und es ist mir leichter ums Herz. Die Begegnung mit Dir wird nun nicht mehr so schrecklich sein.
»Komm also, alter Freund Boris, und besuche Deine alte Tante! Wenn Du sehen könntest, wie sie Dich liebt, wie sie Dein Besitztum hütet – nicht so wie ich die Bibliothek! Und was für hübsche Mädchen sind Deine beiden Cousinen Wjera und Marfa Wassiljewna! Wie sehnsüchtig das alles Dich erwartet, was für einen Park Du hast, was für herrliche Aussichten auf die Wolga . . . Wenn Du das alles wüßtest, würdest Du nicht einen Augenblick zögern und sogleich herkommen: würdest kommen, um von Tatjana Markowna das Gut und von mir die Bibliothek zu übernehmen, um mir die verdiente Strafe zu diktieren, doch zugleich auch liebend zu umarmen Deinen zwar schuldigen, aber Dir herzlich zugetanen alten Freund und Kameraden
Leontij Koslow.
Meine Frau läßt sich Dir empfehlen und Dir ausrichten, daß sie Dich wie früher liebt und Dich noch mehr lieben wird, wenn Du erst hierher kommst.«
Fast zu Tränen gerührt, las Raiski dieses lange Schreiben, stellte sich lebhaft den Sonderling Leontij mit seiner Bibliomanie vor und lachte über die Sorgen, die er sich der Bibliothek wegen machte.
»Ich will sie ihm schenken,« dachte er im stillen. »Leontij! Die Großtante!« ging’s ihm durch den Kopf – – »Wjerotschka und Marsinka, die beiden niedlichen Cousinchen! Die Wolga mit ihrer Uferlandschaft, die schlummernde, glückselige Stille, in der die Menschen nicht leben, sondern still wachsen und welken wie die Pflanzen, in der es keine stürmischen Leidenschaften gibt mit raffinierten, vergifteten Genüssen, keine quälenden Fragen, kein fortschreitendes Denken und kraftvolles Wollen – dort will ich mich konzentrieren, mein Material sichten und den Roman schreiben. Jetzt will ich nur noch zusehen, daß ich Sophies Porträt so oder so vollende, will mich von ihr verabschieden, und dann dahin, dahin!«