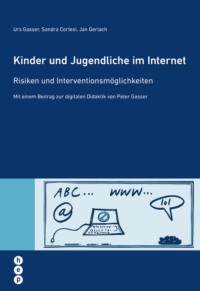Kitabı oku: «Kinder und Jugendliche im Internet», sayfa 2
Abgesehen von den Endgeräten und deren schulischem Einsatz lassen sich auch zentrale Themen der Digitalisierung projektartig bearbeiten. Dabei können beispielsweise Monografien zum Thema »Facebook« alle relevanten Aspekte i. S. eines inhaltlichen Handlaufs für Teilthemen wie die folgenden liefern: Facebook-Zugang – Selbstdarstellung – Reputation – digitale Identität – privater oder öffentlicher Raum – Schutz der Privatsphäre – digitales Dossier – Facebook als Falle – Spurenbeseitigung – Cybermobbing im Facebook – freie Meinungsäusserung – Like-Button – Datenschutzskandale – Facebook im Netz der Interessen.18
(6) Systeme und systematischer Unterricht haben bislang die europäische Bildung dominiert. Wegleitend sind weitgehend auch heute noch die zu Lehrbüchern geronnenen Fachsystematiken der Biologie, Physik, Mathematik, Geschichte usw., die man nach Laienauffassung am besten auswendig lernt. Immerhin scheint manchenorts dieser Bildungstopos im Schwinden begriffen: Das internetdominierte Suchen, Finden, P2P-Bearbeiten, Verwerten, Gestalten und Austauschen ersetzt das öde Dozieren und das kopf- und memorierlastige Lernen. Andererseits breiten sich digital konfigurierte Bildungsangebote und Szenarien aus, die die modernen Fachcurricula (insbesondere an Hochschulen und Universitäten) mit E-Learning, Blended Learning, Lernplattformen, Mobile Learning, Micro-Learning, Online-Moderation, Tele-Tutoring und Aktivitäten im virtuellen Klassenzimmer durchdringen. Meistens sind entsprechende Lehr-Lern-Angebote an spezifische Institutionen (und deren Informatikbeauftragte bzw. Protagonisten) gebunden.19
Zusammengefasst: Viele junge Menschen mit Internetzugang haben heute eine weitreichende und beeindruckende Medienkompetenz, die sie mit selbstorganisiertem, informellem Lernen erworben, ausgetauscht und im Sinne des Web 2.0 eingesetzt haben. Sie holen sich die gewünschten Informationen aus dem Netz, sie nutzen mit ihren Geräten Internet und soziale Netzwerke wie Facebook usw., tauschen Informationen aus, bauen eine digitale Identität auf, nutzen Open-Source-Lernplattformen, übermitteln und teilen Nachrichten, Texte und Bilder, nutzen Film-, Musik- und Spielangebote – oft auch ausserhalb des wünschenswerten Rahmens. Die Schule kann und muss diese Ressourcen nutzen und einbeziehen20 sowie zur Kenntnis nehmen, dass das mit mobilen Endgeräten nutzbare Internet- und Digitalangebot in lerntheoretischer Sicht der bislang exzellenteste und konsequenteste Beitrag zum individualisierenden formellen und informellen Lernen ist. Die Schule muss aber auch den entsprechenden Gefahren gegensteuern und mithin jene jungen Nutzerinnen und Nutzer fördern, deren Teilnahmechancen (im Rahmen des sich manchenorts eröffnenden sogenannten »participation gap«) geringer ausgefallen sind. Wenn die Chancen genutzt werden sollen, ist im geschilderten Sinne teilweise ein Paradigmenwechsel der Lehr- und Lern-Formen nötig. Zudem sind auf verschiedenen Ebenen entsprechende Informatikangebote – inklusiv angemessene Zeitgefässe für den Unterricht – zu machen, finanziell und personell differenziert zu unterstützen sowie die lehrspezifischen Medienkompetenzen der Lehrenden auf- und auszubauen. Die besondere informationelle Qualität der Beiträge von Lehrpersonen liegt meines Ermessens nicht nur im Beschaffen, Einrichten und Betreiben technologischer Geräte, in deren Handhabung und digitale Nutzung im Sinne von ICT, sondern in der weiterführenden und vertiefenden, hintergrundkundigen Aufklärung unter Einschluss nicht nur der jungen Menschen, sondern auch der Erziehungsverantwortlichen (inkl. Eltern), die sich gegen Internetmythen richtet und dem journalistischen und eindimensionalen Feldzug gegen Informatik und Internet entgegenstellt. Dies soll abschliessend an drei brisanten und aktuellen Themen erläutert werden.
(1) Führt das extensive Multitasking junger Menschen vermehrt zu Aufmerksamkeitsstörungen und Konzentrationsdefiziten?
In manchen Hörsälen referiert vorne eine Dozentin oder ein Dozent, die Studierenden sitzen hinter ihren Laptops, machen Notizen, rufen im Internet Schlüsselbegriffe ab, ordnen ihre E-Mails, senden oder empfangen hin und wieder auch Botschaften über iPhone – und fühlen sich nach eigenen Aussagen wohl und überhaupt nicht überfordert. »I multitask every single second I am online. At this very moment, I am watching TV, checking my email every two minutes, reading a newsgroup about who shot JFK, burning some music to a CD and writing this message«, berichtet ein Siebzehnjähriger.21 Dieses Verhalten nennen wir mediales »Multitasking«. Eine Studie aus dem Jahr 2003 belegt, dass »fast ein Drittel der untersuchten Jugendlichen beim Hausaufgabenmachen meistens telefoniert, chattet, fernsieht, Musik hört oder im Internet surft«.22
Multitasking beschäftigt in erster Linie das Arbeitsgedächtnis, mithin Areale des frontalen Cortex. Wenn wir mit Torkel Klingberg annehmen,23 dass Multitasking vom Belastungsgrad des Arbeitsgedächtnisses abhängt und dass gewisse »Exekutivfunktionen« desselben trainierbar sind, lässt sich die Vermutung anstellen, dass Digital Natives, die sich täglich stundenlang mit mehreren digitalen Endgeräten gleichzeitig beschäftigen, sich auch eine entsprechende Parallelverarbeitung aneignen. Und genau dies scheint der kritische Punkt zu sein: Wenn die zu bewältigenden Aufgaben hoch habitualisiert und automatisiert sind, reicht die neuronale Stirnhirn- und Aufmerksamkeitskapazität aus: Wir können durchaus ein Auto lenken und dazu ein Gespräch führen oder Musik hören. Die Kombination von Autofahren und mit dem Handy jemanden anrufen übersteigt diese Kapazitätsgrenze und führt unweigerlich zu hohem Aufmerksamkeitsverlust und zu Fehlreaktionen. Dies hat zum Verbot des Handygebrauchs während des Autofahrens geführt.
Mittlerweile gibt es eine wahre Flut von Multitasking-kritischen Artikeln und Büchern. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Nicolas Carr warnte (2008) nicht nur mit einem wegweisenden Artikel »Is Google making us stupid?« vor den Untiefen des Internets, er befürchtet auch, dass das Multitasking Konzentrationsfähigkeit, Nachdenklichkeit und Reflexionstiefe zerstört. Im deutschen Sprachraum warnt der Journalist Frank Schirrmacher mit deftigen Titeln wie »Multitasking ist Körperverletzung«.24 Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel verweist darauf, dass die konstante Überforderung des Multitaskings zu einer markanten Aufmerksamkeitsstörung führen kann – und sie bezeichnet darüber hinaus Multitasking als Mythos, denn das Gehirn könne niemals gleichzeitig zwei anspruchsvolle Aufgaben parallel bearbeiten. Wir müssten vielmehr eines nach dem andern tun, das heisst ein »serielles Multitasking«25 pflegen – oder zwischendurch »einfach abschalten«.26 Zwar räumt der amerikanische Neurowissenschaftler Gary Small ein, Multitasking bzw. das Hin- und Herspringen zwischen zwei Aufgaben sei offenkundig zu einer notwendigen Fähigkeit geworden, aber mit psychischen Unkosten verbunden, zum Beispiel mit Zeitverlust beim Aufmerksamkeitswechsel und darüber hinaus mit der Gefahr des Erwachsenen-ADHS.27 Small kommt zum Schluss: »Wenn wir das Multitasking minimieren, verbessern wir damit im Allgemeinen unsere Konzentrationsfähigkeit.«28 Prägnant ablehnend äussert sich auch Manfred Spitzer: »Multitasking – Nein danke!«.29 Er belegt seine ablehnende Haltung gegenüber Multitasking (wie übrigens auch Gary Small, Lutz Jäncke und andere) mit dem Hinweis auf eine amerikanische Untersuchung von Clifford Nass et al.,30 in welcher Extremgruppenvergleiche zwischen intensiven und leichten Multitaskern und Multitaskerinnen gemacht wurden. Die Ergebnisse waren eindeutig:
Je mehr Distraktoren (ablenkende Reize) im Spiel sind, desto schlechter sind die Heavy-Multimedia-Users.
Je schwerer die Arbeitsgedächtnis-Aufgabe ist, desto schlechter sind die Heavy-Multimedia-Users.
Je schwerer die Multitasking-Aufgabe, desto langsamer arbeiten die Heavy-Multimedia-Users.
Gesamthaft kann man sagen: Intensives und anhaltendes Multitasken reduziert die Fähigkeit, irrelevante Inhalte auszublenden, verlangsamt den Aufgabenwechsel – und führt schliesslich zu einem oberflächlicheren und weniger effektiven kognitiven Stil.
Einen erhellenden Beitrag zum Problem Multitasking hat jüngst Etienne Koechlin vom Laboratoire de Neurosciences Cognitives in Paris publiziert.31 Er konnte nachweisen, dass zwei konkurrierende Aufgaben auf die Frontalaktivität der beiden Hemisphären aufgeteilt werden – und damit auf eine wohl strukturelle neuronale Kapazitätsgrenze stösst: Die Studie belegt, dass das Gehirn maximal zwei Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann.
Damit ist ein handlungsrelevantes Fazit zu ziehen: Multitasking ist im Normalfall wahrscheinlich gehirnstrukturell und durch die Aufgabenschwierigkeit limitiert. Hoch automatisierte Handlungen erlauben es allenfalls, zwei Aufgaben parallel zu bearbeiten – allerdings mit dem erhöhten Risiko, mehr Fehler zu machen, die Konzentration und Aufmerksamkeit zu überfordern und letztlich mehr Zeit zu benötigen. Bei anforderungsreichen Aufgaben ist das Nacheinander konzentrierter Zuwendung lernpraktisch optimaler – und sogar für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben günstiger.
(2) Machen Computerspiele Jugendliche gewalttätig oder klug?
Das vom Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer 2005 publizierte Buch »Vorsicht Bildschirm« wirkte wie ein Fanal im Feldzug gegen Computer- und Internetspiele – und darüber hinaus gegen deren Einsatz in der Schule. Spitzer erwähnt mehrere Schulamokläufe (Littleton, Erfurt usw.), deren Täterinnen und Täter »sehr viel Zeit mit dem Spielen von Gewaltvideospielen« verbracht, somit Gewalt aktiv und selbstbelohnt trainiert und in das Verhalten implantiert hatten.32 Spitzer resümiert diesen Zusammenhang linear und eindimensional: »Aus der virtuellen Gewalt (wird) grausame Realität.«33
Die monokausale Sicht Spitzers wurde allerdings schon bald durch Untersuchungen infrage gestellt, welche jugendliche Gewalt als mehrfaktoriell verursachtes Phänomen beschreiben.34 Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise geschädigtes Selbstwertgefühl, niedrige Beliebtheit, verletzende häusliche und schulische Realerfahrungen, bedrückende soziale Rahmung – und nicht zuletzt mangelnde Geschmacksbildung im Umgang mit Computerspielen im Einstiegsalter von 8 bis 10 bzw. 12 Jahren. Von Salisch belegt, dass man Gewalt nicht nur als Wirkung von Gewaltspielen, sondern genau umgekehrt die Wahl von Gewaltspielen als Ausdruck personverankerter Aggressionsbereitschaft verstehen kann. Der Zusammenhang zwischen Internetgebrauch bzw. Ego-Shooter-Spielen und Gewalttätigkeit ist durchaus vorhanden, aber gewalthaltige Spiele sind nicht die einzige Ursache. Insbesondere jugendliche Schulamoktaten werden derzeit als Zusammenwirken diverser »Risikofaktoren« erklärt: Sozioökonomischer Hintergrund, Missbrauch, Mobbingerfahrungen, defiziente Schulbiografie, gewalthaltiges Erziehungsumfeld, spezielle Peer-Beziehungen, intensiver Konsum gewalthaltiger Spiele usw. bis zu neuronalen Defiziten im Sinne fehlender Risikobewertung, Verhaltenskontrolle und Impulshemmung … können bei Gewalthandlungen wirksam sein. Überdies können im »Wirklichkeitstransfer« von der virtuellen in die reale Welt und umgekehrt eingeübte Skripts und Schemata, sowohl Leistungs- als auch Flucht- und Vergeltungsmotive eine Rolle spielen.35
Einen eigentlichen Paradigmenwechsel im Verständnis der Bedeutung von Internetspielen wird durch neueste Untersuchungen und Sichtweisen gefördert. Differenzierte Befragungen belegen, dass Computer-, Internet- bzw. Online-Spiele nicht die einzige und schon gar nicht die dominierende digitale Nutzung sind: Sowohl die BITCOM-Studie (2011) als auch die JAMES-Studie von 2010 zeigten höchst differenzierte mediale und digitale Portfolios und Nutzungsprofile:
Nach der JAMES-Studie 2010 umfasst der tägliche oder wöchentlich mehrmalige Medienkonsum beispielsweise folgende Aktivitäten: Handy nutzen (92 %), Internetdienste nutzen (89 %), Fernsehen (81 %), MP3s hören (80 %), Musik-CDs/Kassetten (57 %), Radio hören (56 %), Tageszeitung (Printversion) lesen (48 %), Computer- oder Videogames spielen (36 %), DVDs/Videos schauen (30 %), digitale Fotos machen (28 %), Zeitschrift lesen (26 %), Bücher lesen (26 %), Computer oder Internet nutzen (20 %), Hörspiel hören (16 %), Zeitschrift online lesen (13 %), digitale Videos machen (7 %), Kino besuchen (1 %). Dieser Befund belegt, dass das Computerspiel nur eine unter verschiedenen Aktivitäten ist.36
Ähnliche Fragestellungen liefern auch im Bereich der Video-Games bemerkenswerte Unterschiede: Täglich oder mehrmals pro Woche spielen Konsolenspiele allein 27 %, Online-Spiele allein 25 %, Konsolenspiele mit andern 18 %, alleine offline am PC 17 %, Multi-User-Spiele mit andern Internetnutzerinnen und -nutzern 20 %, mit andern offline am PC spielen 7 %.37 Als Lieblingsgames werden – nach Häufigkeit der Nennung gewichtet – folgende genannt: Sport-Spiele 19 %, First Person Shooters 17 %, Action-Spiele 17 %, Renn-Spiele 11 %, Casual Games 9 %, Simulationen 7 %, Jump’n’Run/Plattformers 7 %, Echtzeit-Strategie-Spiele 5 %, Rollenspiele 4 %, MMORPG (Massively Multi-Player Online Role Playing Games) 3 %, Adventure-Spiele 2 %.38 Zudem ist festzuhalten, dass das Handy als Hybrid-Medium zunehmend dominiert und zum Musikhören, Filmen, Fotografieren, Surfen im Internet – und eben auch zum Spielen eingesetzt wird.
Der erwähnte Paradigmenwechsel manifestiert sich weiter in einer qualitativsystematischen, kontextuellen Sicht, wie sie John Palfrey und Urs Gasser in ihrem Grundlagenwerk »Generation Internet« (2008) entfalten. Sie liefern damit die Grundlinien einer digitalen Spieltheorie, die in mancher Hinsicht traditionelle entwicklungs- und spieltheoretische Aspekte (Spiel als Aktivierung, als Austauschprozess zwischen Personen, als Problemlösung und Realitätsbewältigung) aufgreift.39 Internetspiele enthalten durchaus Elemente der traditionellen Funktions-, Symbol-, Fiktions-, Regel-, Konstruktions- und Rollenspiele, erweitern und betonen darüber hinaus den Aktivitäts- und Intensitätsgrad, den Einbezug der Spieleridentität (z. B. über Avatare) und deren erhöhte Selbstwirksamkeit, die Einbindung in digitale (und oft internationale) Spielgemeinschaften, aber auch die Möglichkeit aggressiven Auslebens: Kinder, die hyperrealistische Gewaltszenarien erleben, sind nicht nur Beobachter, »sie werden zu aktiven Teilnehmern in brutalen Fantasiewelten. Das Spiel veranlasst sie, virtuelle Morde zu begehen.«40 Der erhöhte Intensitäts- und Attraktivitätsgrad führt teilweise zu Spielabhängigkeit, zu Spielsucht und Flucht aus der Offline-Welt in Online-Spielwelten, die als »eigentliches Leben« wahrgenommen werden. Dies wird von der »Abwanderung weg von den Fernsehschirmen und Spielkonsolen hin zum Internet« gefördert.41
Und schliesslich ist ein dritter, didaktischer Aspekt der Spielnutzung zu erwähnen: Digitale Lernspiele können sowohl individualisierend als auch im Partner- oder Gruppenverband zu einem relativ eigenständigen didaktischen Lernmittel werden. Das Angebot von Computerspielen zwischen den Ansprüchen Unterhaltung und Lernen ist kaum mehr überschaubar. Immerhin gibt es seit etwa 10 Jahren eine intensivierte Forschung, die das Bildungspotenzial von Computerspielen, das heisst u. a. Sozialisationswirkungen, Aufbau von Computerspiel-Literalität, Kompetenzerwerb, Lernwirkungen von »Serious Games« und therapeutischen Spielen usw. untersucht.42 Die vielfältige Lernwirkung ist empirisch belegt und ist kaum mehr zu bezweifeln: Computerspielende Kinder lernen nicht bloss, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu klicken bzw. Auge und Hand zu koordinieren, schnell wahrzunehmen und zu reagieren, sondern auch Form- und Mustererkennung, Regeln, Taktiken, kognitive Strategien, Ausdauer und Konzentration.43
Computerspiele sind in pädagogischer Sicht allerdings einer »didaktischen Spielanalyse« zu unterwerfen, die den Lehrenden verschiedener Stufen – über allgemeine Empfehlungen hinaus – konkrete Einsatzhinweise liefern: Worin bestehen Spieloberfläche, Spielhandlungen und Handlungsstrukturen? Welche Inhalte bzw. curricularen Bezüge liegen vor? Wie sieht die Steuerung und Kontrolle der emotionalen, kognitiven, motorischen und sozialen Lernprozesse aus? Welche Lernschwierigkeiten sind zu überwinden, wie sehen Rückmeldungen aus, und wie werden sie verarbeitet? Welche inhaltlichen Lernziele sind (in welcher Zeit) zu erreichen? Wie ist ein Computerspiel methodisch in Lehr-Lern-Prozesse (im Sinne der Annäherung, des Erarbeitens und Vertiefens, der Anwendung und Erfolgskontrolle) einzubetten? Antworten auf derartige Fragen sollen aufzeigen, »wie das Lernen in den Spass verpackt ist« und welche sachstrukturellen Zusammenhänge (beispielsweise zwischen Tangram, Pentaminos und Tetris …) bestehen.44
(3) Führt intensive Internetnutzung zum Verlust von Lesekultur und zur Veränderung jugendlicher Gehirne?
Das Urteil mancher medienkritischer Journalisten ist so klar wie pointiert: Frank Schirrmacher ist der Ansicht, dass die Lesefähigkeit abnimmt – und mit ihr die Lesegeduld: »Wir alle haben zunehmend Probleme, ein Buch zu lesen.«45 Unter dem Druck digitaler Informationsflut beginnt sich nach Schirrmachers Ansicht das Gehirn umzubauen: Geistige Funktionen, insbesondere die Fähigkeit der Konzentration, der gelenkten und ausdauernden Aufmerksamkeit, des vertieften Lesens und selbstständigen Denkens gingen verloren.46 Das Stirnhirn sei im Online-Modus ununterbrochen auf dem Sprung, neue Reize zu beachten, es stehe unter permanentem Aufmerksamkeits- und Zuwendungsdruck. Ähnliches befürchtet auch der amerikanische Wissenschaftsjournalist Nicolas Carr: Das Internet verändere das Denken und das Gehirn Jugendlicher, und es reduziere die Fähigkeit zu linearem und vertieftem, das heisst sinnverstehendem Lesen. Die »Reizkakofonie des Internets« bewirke, »dass unser Gehirn weder konzentriert noch kreativ denken kann. Unser Gehirn wird zu einer simplen, signalverarbeitenden Einheit, die Informationen möglichst rasch durch unser Bewusstsein schleust.«47
Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass »vertieftes Lesen« alles andere als bloss »linear« verläuft, nämlich assoziativ, rekursiv, verknüpfend: Die Oberflächenstruktur der Sätze wird mit dem semantischen Gehalt der Textbasis sowie mit bedeutungshaltigen Situationsmodellen und Weltwissen verknüpft – und genau diese Verzögerung bezeichnen wir (mit Maryanne Wolf) als Nachdenklichkeit. Überdies sind verschiedene Lesemodi zu unterscheiden: Orientierendes Lesen und Navigieren in Hypertexten erweitern schulische Lesenormen, betonen digitale Lesegewohnheiten. Die einseitige Orientierung an literarischen Textsorten wird durch das Internet und durch digitale Kommunikationsformen (E-Mail, SMS, Chat, Blog, Twitter, Facebook) erweitert. Dies mag unter anderem dazu geführt haben, dass sich die 15-jährigen Schweizer Jugendlichen bezüglich Lesekompetenz von 494 Punkten (in der PISA-Studie von 2000) auf 501 Punkte (in der Studie von 2009) verbessert haben. Auch was die Schreibkompetenz betrifft, bewirken die Chat- und Instant-Messaging-Texte Jugendlicher keinen Verlust der Schreibfähigkeit, sondern vielmehr ein gutes Gespür für situativ-mediale und textsortenspezifische Eigenheiten.48 Es ist demnach vielmehr so, dass die digitalen Medien neue Möglichkeiten der Textrezeption und -produktion schaffen, die schulisch fruchtbar zu machen sind.49 Schliesslich ist anzumerken, dass die intensive Internetnutzung tatsächlich das Gehirn von Jugendlichen und Erwachsenen verändert – etwa so, wie intensives Musizieren, Schachspielen, Jonglieren, Lernen einer Fremdsprache oder Orientierungslaufen das Gehirn in seiner Feinstruktur und synaptischen Vernetzung verändern. Jedenfalls bestätigen dies neurowissenschaftliche Ergebnisse.50
Schlussbemerkung
Zweifellos verändern Computer, Internet, Facebook & Co. unseren Alltag, unsere Kommunikation, unseren Beruf und unsere Köpfe. Heranwachsende bzw. die Digital Natives sind davon massiv betroffen und dabei nicht nur den technologischen Segnungen, sondern auch Verführungen ausgesetzt.51 Die Hoffnung, digitale Phänomene mit gelehrter Ignoranz und Ablehnung52 oder mit Regulierung und Verboten in den Griff zu bekommen, ist relativ minim. Uns bleibt nichts anderes, als zwischen blinder Begeisterung und überheblicher Ablehnung zu erforschen und zu überlegen, wohin sich der junge »homo digitaliensis« entwickelt und wie wir als Lehrende und Erziehende diese Entwicklung unterstützen und begleiten können.53 Der Didaktik sind dabei enge Grenzen gesetzt, weil ausserschulische Akteure, Medienschaffende und -anbieter, die Inhalte (z. B. Apps) anbieten, Werte setzen und die Nutzung der neuen Medien informell didaktisieren.
Politiker, Gesetzgeber, Erziehende und Lehrende, aber auch Produzenten und Distribuenten – und nicht zuletzt die Forscher-Community können sich der Verantwortung nicht entziehen, sich mit der neuen Bildungsmacht rezeptiv und mitgestaltend auseinanderzusetzen. Diesem Anliegen will das vorliegende Buch dienen.